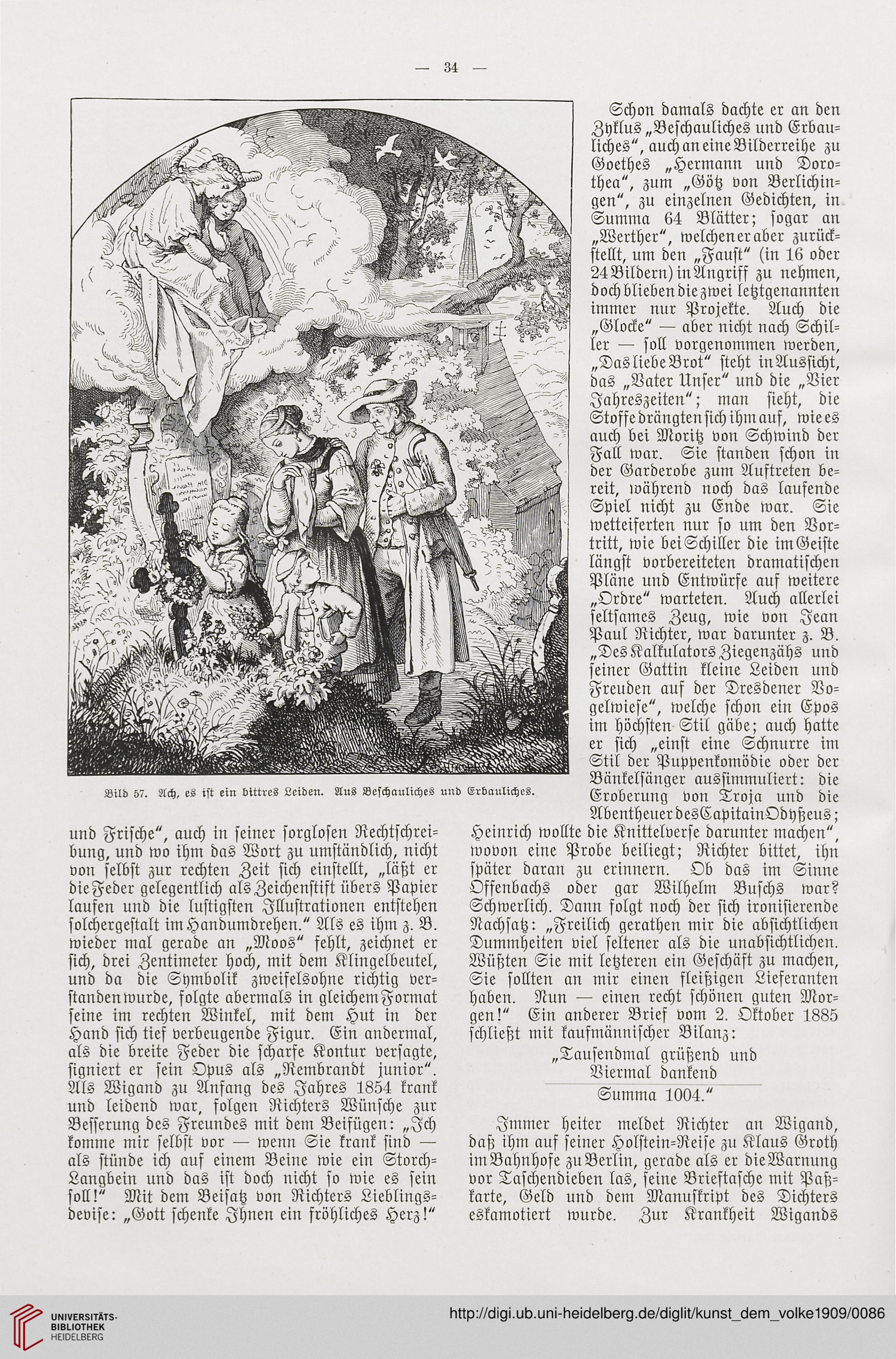34
Bild 57. Ach, es ist ein bittrcs Leiden. Aus Beschauliches und Erbauliches.
und Frische", auch in seiner sorglosen Rechtschrei-
bung, und wo ihm das Wort zu umständlich, nicht
von selbst zur rechten Zeit sich einstellt, „läßt er
dieFeder gelegentlich alsZeichenstist übers Papier
laufen und die lustigsten Jllustrationen entstehen
solchergestalt im Handumdrehen." Als es ihm z. B.
wieder mal gerade an „Moos" fehlt, zeichnet er
sich, drei Zentimeter hoch, mit dem Klingelbeutel,
und da die Symbolik zweifelsohne richtig ver-
standenwurde, folgte abermals in gleichemFormat
seine im rechten Winkel, mit dem Hut in der
Hand sich tief verbeugende Figur. Ein andermal,
als die breite Feder die scharfe Kontur versagte,
signiert er sein Opus als „Rembrandt junior".
Als Wigand zu Anfang des Jahres 1854 krank
und leidend war, folgen Richters Wünsche zur
Besserung des Freundes mit dem Beifügen: „Jch
komme mir selbst vor — wenn Sie krank sind —
als stünde ich auf einem Beine wie ein Storch-
Langbein und das ist doch nicht so wie es sein
soll!" Mit dem Beisatz von Richters Lieblings-
devise: „Gott schenke Jhnen ein sröhliches Herz!"
Schon damals dachte er an den
Zyklus „Beschauliches und Erbau-
liches", auch aneineBilderreihe zu
Goethes „Hermann und Doro-
thea", zum „Götz von Berlichin-
gen", zu einzelnen Gedichten, in
Summa 64 Blätter; sogar an
„Werther", welcheneraber zurück-
stellt, um den „Faust" (in 16 oder
24Bildern)inAngriff zu nehmen,
dochbliebendiezwei letztgenannten
immer nur Projekte. Auch die
„Glocke" — aber nicht nach Schil-
ler — soll vorgenommen werden,
„DasliebeBrot" steht inAussicht,
das „Vater Unser" und die „Vier
Jahreszeiten"; man sieht, die
Stoffe drängtensich ihm auf, wie es
auch bei Moritz von Schwind der
Fall war. Sie standen schon in
der Garderobe zum Auftreten be-
reit, während noch das laufende
Spiel nicht zu Ende war. Sie
wetteiferten nur so um den Vor-
tritt, wie beiSchiller die imGeiste
längst vorbereiteten dramatischen
Pläne und Entwürfe aus weitere
„Ordre" warteten. Auch allerlei
seltsames Zeug, wie von Jean
Paul Richter, war darunter z. B.
„DesKalkulatorsZiegenzähs und
seiner Gattin kleine Leiden und
Freuden auf der Dresdener Vo-
gelwiese", welche schon ein Epos
im höchsten Stil gäbe; auch hatte
er sich „einst eine Schnurre im
Stil der Puppenkomödie oder der
Bänkelsänger aussimmuliert: die
Eroberung von Troja und die
AbentheuerdesCapitainOdyßeus;
Heinrich wollte die Knittelverse darunter machen",
wovon eine Probe beiliegt; Richter bittet, ihn
später daran zu erinnern. Ob das im Sinne
Osfenbachs oder gar Wilhelm Buschs war?
Schwerlich. Dann folgt noch der sich ironisierende
Nachsatz: „Freilich gerathen mir die absichtlichen
Dummheiten viel seltener als die unabsichtlichen.
Wüßten Sie mit letzteren ein Geschäft zu machen,
Sie sollten an mir einen fleißigen Lieferanten
haben. Nun — einen recht schönen guten Mor-
gen!" Ein anderer Brief vom 2. Oktober 1885
schließt mit kaufmännischer Bilanz:
„Tausendmal grüßend und
_Viermal dankend
Summa 1004."
Jmmer heiter meldet Richter an Wigand,
daß ihm auf seiner Holstein-Reise zu Klaus Groth
imBahnhofe zuBerlin, gerade als er dieWarnung
vor Taschendieben las, seine Brieftasche mit Paß-
karte, Geld und dem Manuskript des Dichters
eskamotiert wurde. Zur Krankheit Wigands
Bild 57. Ach, es ist ein bittrcs Leiden. Aus Beschauliches und Erbauliches.
und Frische", auch in seiner sorglosen Rechtschrei-
bung, und wo ihm das Wort zu umständlich, nicht
von selbst zur rechten Zeit sich einstellt, „läßt er
dieFeder gelegentlich alsZeichenstist übers Papier
laufen und die lustigsten Jllustrationen entstehen
solchergestalt im Handumdrehen." Als es ihm z. B.
wieder mal gerade an „Moos" fehlt, zeichnet er
sich, drei Zentimeter hoch, mit dem Klingelbeutel,
und da die Symbolik zweifelsohne richtig ver-
standenwurde, folgte abermals in gleichemFormat
seine im rechten Winkel, mit dem Hut in der
Hand sich tief verbeugende Figur. Ein andermal,
als die breite Feder die scharfe Kontur versagte,
signiert er sein Opus als „Rembrandt junior".
Als Wigand zu Anfang des Jahres 1854 krank
und leidend war, folgen Richters Wünsche zur
Besserung des Freundes mit dem Beifügen: „Jch
komme mir selbst vor — wenn Sie krank sind —
als stünde ich auf einem Beine wie ein Storch-
Langbein und das ist doch nicht so wie es sein
soll!" Mit dem Beisatz von Richters Lieblings-
devise: „Gott schenke Jhnen ein sröhliches Herz!"
Schon damals dachte er an den
Zyklus „Beschauliches und Erbau-
liches", auch aneineBilderreihe zu
Goethes „Hermann und Doro-
thea", zum „Götz von Berlichin-
gen", zu einzelnen Gedichten, in
Summa 64 Blätter; sogar an
„Werther", welcheneraber zurück-
stellt, um den „Faust" (in 16 oder
24Bildern)inAngriff zu nehmen,
dochbliebendiezwei letztgenannten
immer nur Projekte. Auch die
„Glocke" — aber nicht nach Schil-
ler — soll vorgenommen werden,
„DasliebeBrot" steht inAussicht,
das „Vater Unser" und die „Vier
Jahreszeiten"; man sieht, die
Stoffe drängtensich ihm auf, wie es
auch bei Moritz von Schwind der
Fall war. Sie standen schon in
der Garderobe zum Auftreten be-
reit, während noch das laufende
Spiel nicht zu Ende war. Sie
wetteiferten nur so um den Vor-
tritt, wie beiSchiller die imGeiste
längst vorbereiteten dramatischen
Pläne und Entwürfe aus weitere
„Ordre" warteten. Auch allerlei
seltsames Zeug, wie von Jean
Paul Richter, war darunter z. B.
„DesKalkulatorsZiegenzähs und
seiner Gattin kleine Leiden und
Freuden auf der Dresdener Vo-
gelwiese", welche schon ein Epos
im höchsten Stil gäbe; auch hatte
er sich „einst eine Schnurre im
Stil der Puppenkomödie oder der
Bänkelsänger aussimmuliert: die
Eroberung von Troja und die
AbentheuerdesCapitainOdyßeus;
Heinrich wollte die Knittelverse darunter machen",
wovon eine Probe beiliegt; Richter bittet, ihn
später daran zu erinnern. Ob das im Sinne
Osfenbachs oder gar Wilhelm Buschs war?
Schwerlich. Dann folgt noch der sich ironisierende
Nachsatz: „Freilich gerathen mir die absichtlichen
Dummheiten viel seltener als die unabsichtlichen.
Wüßten Sie mit letzteren ein Geschäft zu machen,
Sie sollten an mir einen fleißigen Lieferanten
haben. Nun — einen recht schönen guten Mor-
gen!" Ein anderer Brief vom 2. Oktober 1885
schließt mit kaufmännischer Bilanz:
„Tausendmal grüßend und
_Viermal dankend
Summa 1004."
Jmmer heiter meldet Richter an Wigand,
daß ihm auf seiner Holstein-Reise zu Klaus Groth
imBahnhofe zuBerlin, gerade als er dieWarnung
vor Taschendieben las, seine Brieftasche mit Paß-
karte, Geld und dem Manuskript des Dichters
eskamotiert wurde. Zur Krankheit Wigands