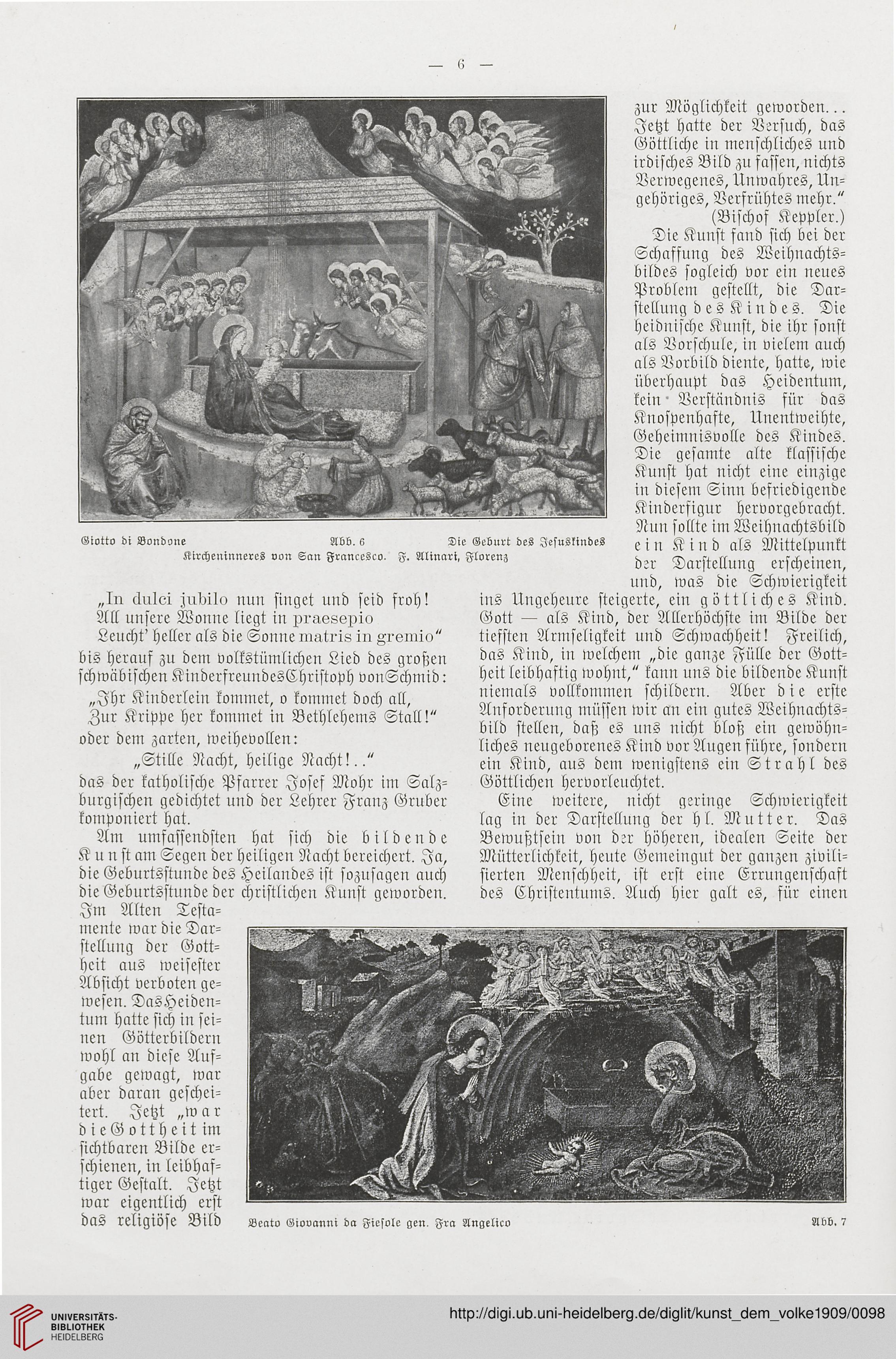6
Giotto di Bondone
Abb. 6
Kircheninneres von San Francesco. F. Alinari, Florenz
„In cldllel zubilo nun singet und seid froh!
All unsere Wonne liegt in pi'Nksoxöo
Leucht' heller als die Sonne innti'is in Aroiiiio"
bis herauf zu dem volkstümlichen Lied des großen
schwäbischen KinderfreundesChristoph vonSchmid:
„Jhr Kinderlein kommet, o kommet doch all,
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall!"
oder dem zarten, weihevollen:
„Stille Nacht, heilige Nacht!.."
das der katholische Pfarrer Josef Mohr im Salz-
burgischen gedichtet und der Lehrer Franz Gruber
komponiert hat.
Am umfassendsten hat sich die bildende
Kunst am Segen der heiligen Nacht bereichert. Ja,
die Geburtsstunde des Heilandes ist sozusagen auch
die Geburtsstunde der christlichen Kunst geworden.
Jm Alten Testa-
mente war die Dar-
stellung der Gott-
heit aus weisester
Absicht verboten ge-
wesen. DasHeiden-
tum hatte sich in sei-
nen Götterbildern
wohl an diese Aus-
gabe gewagt, war
aber daran geschei-
tert. Jetzt „war
dieGottheitim
sichtbaren Bilde er-
schienen, in leibhaf-
tiger Gestalt. Jetzt
war eigentlich erst
das religiöse Bild Beato Giovanni da Ficsole gcn. Fra Angelico
zur Möglichkeit geworden...
Jetzt hatte der Versuch, das
Göttliche in menschliches und
irdisches Bild zu fassen, nichts
Verwegenes, Unwahres, Un-
gehöriges, Verfrühtes mehr."
(Bischof Keppler.)
Die Kunst fand sich bei der
Schafsung des Weihnachts-
bildes sogleich vor ein neues
Problem gestellt, die Dar-
stelluug desKindes. Die
heidnische Kunst, die ihr sonst
als Vorschule, in vielem auch
als Vorbild diente, hatte, wie
überhaupt das Heidentum,
kein Verständnis für das
Knospenhafte, Unentweihte,
Geheimnisvolle des Kindes.
Die gesamte alte klassische
Kunst hat nicht eine einzige
in diesem Sinu befriedigende
Kinderfigur hervorgebracht.
Nun sollte im Weihnachtsbild
eiu Kind als Mittelpunkt
der Darstellung erscheinen,
und, was die Schwierigkeit
ins Ungeheure steigerte, ein göttliches Kind.
Gott — als Kind, der Allerhöchste im Bilde der
tiefsten Armseligkeit uud Schwachheit! Freilich,
das Kind, iu welchem „die ganze Fülle der Gott-
heit leibhastig wohnt," kanu uns die bildende Kunst
niemals vollkommen schildern. Aber die erste
Anforderung müssen wir an ein gutes Weihnachts-
bild stellen, daß es uns nicht bloß ein gewöhn-
liches neugeborenes Kind vor Augen führe, sondern
ein Kind, aus dem wenigstens ein Strahl des
Göttlichen Hervorleuchtet.
Eine weitere, nicht geringe Schwierigkeit
lag in der Darstellung der h l. Mutter. Das
Bewußtsein von der höheren, idealen Seite der
Mütterlichkeit, heute Gemeingut der ganzen zivili-
sierten Menschheit, ist erst eine Errungenschaft
des Christentunls. Auch hier galt es, für einen
Die Geburt des Jesuskindes
Abb. 7
Giotto di Bondone
Abb. 6
Kircheninneres von San Francesco. F. Alinari, Florenz
„In cldllel zubilo nun singet und seid froh!
All unsere Wonne liegt in pi'Nksoxöo
Leucht' heller als die Sonne innti'is in Aroiiiio"
bis herauf zu dem volkstümlichen Lied des großen
schwäbischen KinderfreundesChristoph vonSchmid:
„Jhr Kinderlein kommet, o kommet doch all,
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall!"
oder dem zarten, weihevollen:
„Stille Nacht, heilige Nacht!.."
das der katholische Pfarrer Josef Mohr im Salz-
burgischen gedichtet und der Lehrer Franz Gruber
komponiert hat.
Am umfassendsten hat sich die bildende
Kunst am Segen der heiligen Nacht bereichert. Ja,
die Geburtsstunde des Heilandes ist sozusagen auch
die Geburtsstunde der christlichen Kunst geworden.
Jm Alten Testa-
mente war die Dar-
stellung der Gott-
heit aus weisester
Absicht verboten ge-
wesen. DasHeiden-
tum hatte sich in sei-
nen Götterbildern
wohl an diese Aus-
gabe gewagt, war
aber daran geschei-
tert. Jetzt „war
dieGottheitim
sichtbaren Bilde er-
schienen, in leibhaf-
tiger Gestalt. Jetzt
war eigentlich erst
das religiöse Bild Beato Giovanni da Ficsole gcn. Fra Angelico
zur Möglichkeit geworden...
Jetzt hatte der Versuch, das
Göttliche in menschliches und
irdisches Bild zu fassen, nichts
Verwegenes, Unwahres, Un-
gehöriges, Verfrühtes mehr."
(Bischof Keppler.)
Die Kunst fand sich bei der
Schafsung des Weihnachts-
bildes sogleich vor ein neues
Problem gestellt, die Dar-
stelluug desKindes. Die
heidnische Kunst, die ihr sonst
als Vorschule, in vielem auch
als Vorbild diente, hatte, wie
überhaupt das Heidentum,
kein Verständnis für das
Knospenhafte, Unentweihte,
Geheimnisvolle des Kindes.
Die gesamte alte klassische
Kunst hat nicht eine einzige
in diesem Sinu befriedigende
Kinderfigur hervorgebracht.
Nun sollte im Weihnachtsbild
eiu Kind als Mittelpunkt
der Darstellung erscheinen,
und, was die Schwierigkeit
ins Ungeheure steigerte, ein göttliches Kind.
Gott — als Kind, der Allerhöchste im Bilde der
tiefsten Armseligkeit uud Schwachheit! Freilich,
das Kind, iu welchem „die ganze Fülle der Gott-
heit leibhastig wohnt," kanu uns die bildende Kunst
niemals vollkommen schildern. Aber die erste
Anforderung müssen wir an ein gutes Weihnachts-
bild stellen, daß es uns nicht bloß ein gewöhn-
liches neugeborenes Kind vor Augen führe, sondern
ein Kind, aus dem wenigstens ein Strahl des
Göttlichen Hervorleuchtet.
Eine weitere, nicht geringe Schwierigkeit
lag in der Darstellung der h l. Mutter. Das
Bewußtsein von der höheren, idealen Seite der
Mütterlichkeit, heute Gemeingut der ganzen zivili-
sierten Menschheit, ist erst eine Errungenschaft
des Christentunls. Auch hier galt es, für einen
Die Geburt des Jesuskindes
Abb. 7