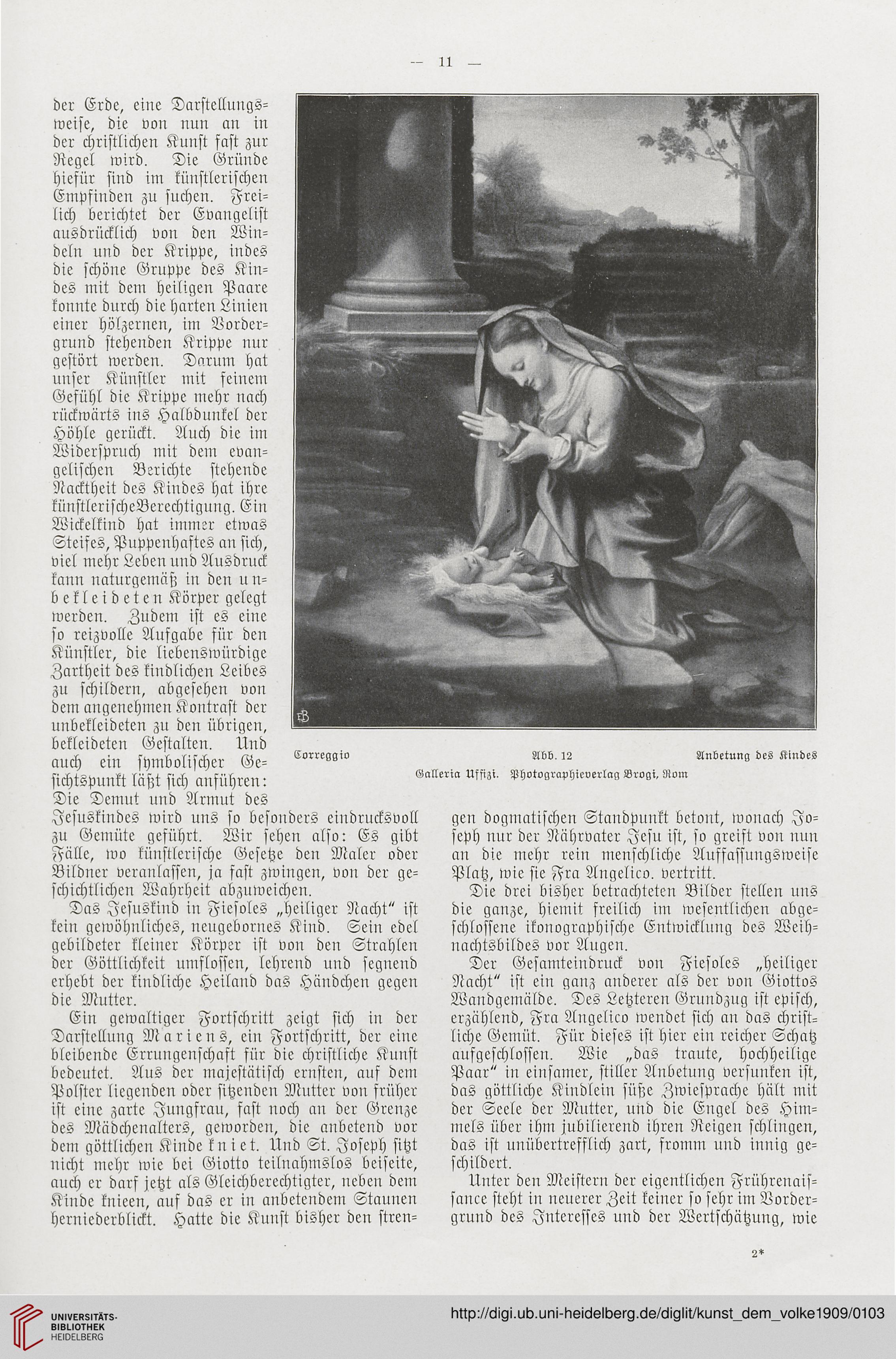11
Correggio Abb. 12 Anbetung des Kindes
Galleria Uffizi. Photographieverlag Brogt, Rom
der Erde, eine Darstellungs-
weise, die von nun an in
der christlichen Kunst fast zur
Regel wird. Die Gründe
hiefür stnd im künstlerischen
Empfinden zu suchen. Frei-
lich berichtet der Evangelist
ausdrücklich von den Win-
deln und der Krippe, indes
die schöne Gruppe des Kin-
des mit dem heiligen Paare
konnte durch die harten Linien
einer hölzernen, im Vorder-
grund stehenden Krippe nur
gestört werden. Darum hat
unser Künstler mit. feinem
Gefühl die Krippe mehr nach
rückwärts ins Halbdunkel der
Höhle gerückt. Auch die im
Widerspruch mit dem evan-
gelischen Berichte stehende
Nacktheit des Kindes hat ihre
künstlerischeBerechtigung. Ein
Wickelkind hat immer etwas
Steifes, Puppenhaftes an sich,
viel mehr Leben und Ausdruck
kann naturgemcis; in den u n-
bekleideten Körper gelegt
werden. Zudem ist es eine
so reizvolle Aufgabe für den
Künstler, die liebenswürdige
Zartheit des kindlichen Leibes
zu schildern, abgesehen von
dem angenehmen Kontrast der
unbekleideten zu den übrigen,
bekleideten Gestalten. Ünd
auch ein symbolischer Ge-
sichtspunkt läßt sich anführen:
Die Demut und Armut des
Jesuskindes wird uns so besonders eindrucksvoll
zu Gemüte geführt. Wir sehen also: Es gibt
Fälle, wo künstlerische Gesetze den Maler oder
Bildner veranlassen, ja fast zwingcn, von der ge-
schichtlichen Wahrheit abzuweichen.
Das Jesuskind in Fiesoles „heiliger Nacht" ist
kein gewöhnliches, neugebornes Kind. Sein edel
gebildeter kleiner Körper ift von den Strahlen
der Göttlichkeit umflossen, lehrend und segnend
erhebt der kindliche Heiland das Händchen gegen
die Mutter.
Ein gewaltiger Fortschritt zeigt sich in der
Darstellung Mariens, ein Fortschritt, der eine
bleibende Errungenschaft für die christliche Kunft
bedeutet. Aus der majestätisch ernsten, auf dem
Polster liegenden oder sitzenden Mutter von früher
ist eine zarte Jungfrau, fast noch an der Grenze
des Mädchenalters, geworden, die anbetend vor
dem göttlichen Kinde kniet. Und St. Joseph sitzt
nicht mehr wie bei Giotto teilnahmslos beiseite,
auch er darf jetzt als Gleichberechtigter, neben dem
Kinde knieen, auf das er in anbetendem Staunen
herniederblickt. Hatte die Kunst bisher den ftren-
gen dogmatischen Standpunkt betont, wonach Jo-
seph nur der Nährvater Jesu ist, so greift von nun
an die mehr rein menschliche Auffassungsweise
Platz, wie sie Fra Angelico. vertritt.
Die drei bisher betrachteten Bilder stellen uns
die ganze, hiemit freilich im wesentlichen abge-
schlossene ikonographische Entwicklnng des Weih-
nachtsbildes vor Augen.
Der Gesamteindruck von Fiesoles „heiliger
Nacht" ist ein ganz anderer als der von Giottos
Wandgemälde. Des Letzteren Grundzug ist episch,
erzählend, Fra Angelico wendet sich an das christ-
liche Gemüt. Für dieses ist hier ein reicher Schatz
aufgeschlossen. Wie „das traute, hochheilige
Paar" in einsamer, stiller Anbetung versunken ist,
das götttiche Kindlein süste Zwiesprache hält mit
der Seele der Mutter, und die Engel des Him-
mels über ihm jubilierend ihren Reigen schlingen,
das ist unübcrtrefflich zart, fromm und innig ge-
schildert.
Unter den Meistern der eigentlichen Frührenais-
sance steht in neuerer Zeit keiner so sehr im Vorder-
grund des Jnteresses und der Wertschätzung, wie
2*
Correggio Abb. 12 Anbetung des Kindes
Galleria Uffizi. Photographieverlag Brogt, Rom
der Erde, eine Darstellungs-
weise, die von nun an in
der christlichen Kunst fast zur
Regel wird. Die Gründe
hiefür stnd im künstlerischen
Empfinden zu suchen. Frei-
lich berichtet der Evangelist
ausdrücklich von den Win-
deln und der Krippe, indes
die schöne Gruppe des Kin-
des mit dem heiligen Paare
konnte durch die harten Linien
einer hölzernen, im Vorder-
grund stehenden Krippe nur
gestört werden. Darum hat
unser Künstler mit. feinem
Gefühl die Krippe mehr nach
rückwärts ins Halbdunkel der
Höhle gerückt. Auch die im
Widerspruch mit dem evan-
gelischen Berichte stehende
Nacktheit des Kindes hat ihre
künstlerischeBerechtigung. Ein
Wickelkind hat immer etwas
Steifes, Puppenhaftes an sich,
viel mehr Leben und Ausdruck
kann naturgemcis; in den u n-
bekleideten Körper gelegt
werden. Zudem ist es eine
so reizvolle Aufgabe für den
Künstler, die liebenswürdige
Zartheit des kindlichen Leibes
zu schildern, abgesehen von
dem angenehmen Kontrast der
unbekleideten zu den übrigen,
bekleideten Gestalten. Ünd
auch ein symbolischer Ge-
sichtspunkt läßt sich anführen:
Die Demut und Armut des
Jesuskindes wird uns so besonders eindrucksvoll
zu Gemüte geführt. Wir sehen also: Es gibt
Fälle, wo künstlerische Gesetze den Maler oder
Bildner veranlassen, ja fast zwingcn, von der ge-
schichtlichen Wahrheit abzuweichen.
Das Jesuskind in Fiesoles „heiliger Nacht" ist
kein gewöhnliches, neugebornes Kind. Sein edel
gebildeter kleiner Körper ift von den Strahlen
der Göttlichkeit umflossen, lehrend und segnend
erhebt der kindliche Heiland das Händchen gegen
die Mutter.
Ein gewaltiger Fortschritt zeigt sich in der
Darstellung Mariens, ein Fortschritt, der eine
bleibende Errungenschaft für die christliche Kunft
bedeutet. Aus der majestätisch ernsten, auf dem
Polster liegenden oder sitzenden Mutter von früher
ist eine zarte Jungfrau, fast noch an der Grenze
des Mädchenalters, geworden, die anbetend vor
dem göttlichen Kinde kniet. Und St. Joseph sitzt
nicht mehr wie bei Giotto teilnahmslos beiseite,
auch er darf jetzt als Gleichberechtigter, neben dem
Kinde knieen, auf das er in anbetendem Staunen
herniederblickt. Hatte die Kunst bisher den ftren-
gen dogmatischen Standpunkt betont, wonach Jo-
seph nur der Nährvater Jesu ist, so greift von nun
an die mehr rein menschliche Auffassungsweise
Platz, wie sie Fra Angelico. vertritt.
Die drei bisher betrachteten Bilder stellen uns
die ganze, hiemit freilich im wesentlichen abge-
schlossene ikonographische Entwicklnng des Weih-
nachtsbildes vor Augen.
Der Gesamteindruck von Fiesoles „heiliger
Nacht" ist ein ganz anderer als der von Giottos
Wandgemälde. Des Letzteren Grundzug ist episch,
erzählend, Fra Angelico wendet sich an das christ-
liche Gemüt. Für dieses ist hier ein reicher Schatz
aufgeschlossen. Wie „das traute, hochheilige
Paar" in einsamer, stiller Anbetung versunken ist,
das götttiche Kindlein süste Zwiesprache hält mit
der Seele der Mutter, und die Engel des Him-
mels über ihm jubilierend ihren Reigen schlingen,
das ist unübcrtrefflich zart, fromm und innig ge-
schildert.
Unter den Meistern der eigentlichen Frührenais-
sance steht in neuerer Zeit keiner so sehr im Vorder-
grund des Jnteresses und der Wertschätzung, wie
2*