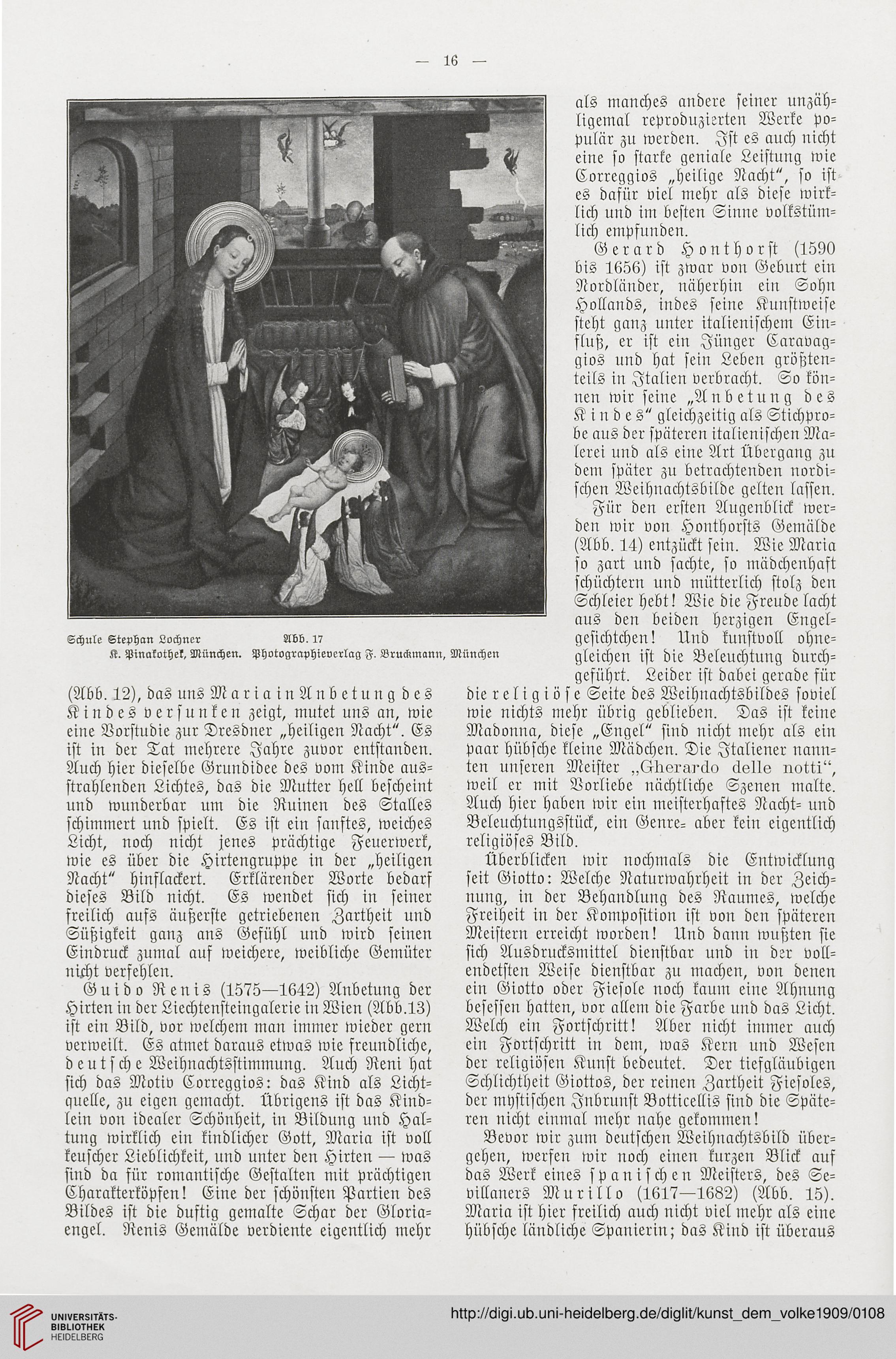16
Schule Stephan Lochner Abb. 17
K. Pinakothek, Miinchon. Photographieverlag F. Bruckmann, München
(Abb. 12), das uns MariainAnbetuug des
Kindes versunken zeigt, mutet uns an, wie
eine Vorstudie zur Dresdner „heiligen Nacht". Es
ist in der Tat mehrere Jahre zuvor entstanden.
Auch hier dieselbe Grundidee des vom Kinde aus-
strahlenden Lichtes, das die Mutter hell bescheint
und wunderbar um die Ruinen des Stalles
schimmert und spielt. Es ist ein sanftes, weiches
Licht, noch nicht jenes prächtige Feuerwerk,
wie es über die Hirtengruppe in der „heiligen
Nacht" hinflackert. Erklärender Worte bedarf
dieses Bild nicht. Es wendet sich in seiner
freilich aufs äußerste getriebenen Zartheit und
Süßigkeit ganz ans Gefühl und wird seinen
Eindruck zumal auf weichere, weibliche Gemüter
nicht verfehlen.
Guido Renis (1575—1642) Anbetung der
Hirten in der Liechtensteingalerie in Wien (Abb.13)
ist ein Bild, vor welchem man immer wieder gern
verweilt. Es atmet daraus etwas wie freundliche,
deutsche Weihnachtsstimmung. Auch Reni hat
sich das Motiv Correggios: das Kind als Licht-
quelle, zu eigen gemacht. Übrigens ist das Kind-
lein von idealer Schönheit, iu Bildung und Hal-
tung wirklich ein kindlicher Gott, Maria ist voll
keuscher Lieblichkeit, und unter den Hirten — was
sind da für romantische Geftalten mit prächtigen
Charakterköpfen! Eine der schönften Partien des
Bildes ist die duftig gemalte Schar der Gloria-
engel. Renis Gemälde verdiente eigentlich mehr
als manches andere seiner unzäh-
ligemal reproduzierten Werke po-
pulär zu werden. Jft es auch nicht
eine so starke geniale Leistung wie
Correggios „heilige Nacht", so ist
es dafür viel mehr als diese wirk-
lich und im besten Sinne volkstüm-
lich empfunden.
Gerard Honthorst (1590
bis 1656) ist zwar von Geburt ein
Nordländer, näherhin ein Sohn
Hollands, indes seine Kunstweise
steht ganz uuter italienischem Ein-
fluß, er ist ein Jünger Caravag-
gios und hat sein Leben größten-
teils in Jtalien verbracht. So kön-
nen wir seine „Anbetung des
Kindes" gleichzeitig als Stichpro-
be aus der späteren italienischen Ma-
lerei und als eine Art Übergang zu
dem später zu betrachtenden nordi-
schen Weihnachtsbilde gelten lassen.
Für den ersten Augenblick wer-
den wir von Honthorsts Gemälde
(Abb. 14) entzückt sein. Wie Maria
so zart und sachte, so mädchenhaft
schüchtern und mütterlich stolz den
Schleier hebt! Wie die Freude lacht
aus den beiden herzigen Engel-
gesichtchen! Und kunstvoll ohne-
gleichen ist die Beleuchtung durch-
geführt. Leider ist dabei gerade für
diereligiöse Seite des Weihnachtsbildes soviel
wie nichts mehr übrig geblieben. Das ist keine
Madonua, diese „Eugel" sind nicht mehr als ein
paar hübsche kleine Mädchen. Die Jtaliener nann-
ten unseren Meister „Olasrku-cko ckolls iiottl",
weil er mit Vorliebe nächtliche Szenen malte.
Auch hier haben wir ein meisterhaftes Nacht- und
Beleuchtungsstück, ein Genre- aber kein eigentlich
religiöses Bild.
Überblicken wir nochmals die Entwicklung
seit Giotto: Welche Naturwahrheit in der Zeich-
nung, in der Behandlung des Raumes, welche
Freiheit in der Komposition ist von den späteren
Meistern erreicht worden! Und dann wußten sie
sich Ausdrucksmittel dienstbar und in drr voll-
endetsten Weise dienstbar zu machen, von denen
ein Giotto oder Fiesole noch kaum eine Ahnung
besessen hatten, vor allem die Farbe und das Licht.
Welch ein Fortschritt! Aber nicht immer auch
ein Fortschritt in dem, was Kern und Wesen
der religiösen Kunst bedeutet. Der tiefgläubigen
Schlichtheit Giottos, der reinen Zartheit Fiesoles,
der mystischen Jnbrunst Botticellis sind die Späte-
ren nicht einmal mehr nahe gekommen!
Bevor wir zum deutschen Weihnachtsbild über-
gehen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf
das Werk eines spanischen Meisters, des Se-
villaners Murillo (1617—1682) (Abb. 15).
Maria ist hier freilich auch nicht viel mehr als eine
hübsche ländliche Spauierin; das Kind ist überaus
Schule Stephan Lochner Abb. 17
K. Pinakothek, Miinchon. Photographieverlag F. Bruckmann, München
(Abb. 12), das uns MariainAnbetuug des
Kindes versunken zeigt, mutet uns an, wie
eine Vorstudie zur Dresdner „heiligen Nacht". Es
ist in der Tat mehrere Jahre zuvor entstanden.
Auch hier dieselbe Grundidee des vom Kinde aus-
strahlenden Lichtes, das die Mutter hell bescheint
und wunderbar um die Ruinen des Stalles
schimmert und spielt. Es ist ein sanftes, weiches
Licht, noch nicht jenes prächtige Feuerwerk,
wie es über die Hirtengruppe in der „heiligen
Nacht" hinflackert. Erklärender Worte bedarf
dieses Bild nicht. Es wendet sich in seiner
freilich aufs äußerste getriebenen Zartheit und
Süßigkeit ganz ans Gefühl und wird seinen
Eindruck zumal auf weichere, weibliche Gemüter
nicht verfehlen.
Guido Renis (1575—1642) Anbetung der
Hirten in der Liechtensteingalerie in Wien (Abb.13)
ist ein Bild, vor welchem man immer wieder gern
verweilt. Es atmet daraus etwas wie freundliche,
deutsche Weihnachtsstimmung. Auch Reni hat
sich das Motiv Correggios: das Kind als Licht-
quelle, zu eigen gemacht. Übrigens ist das Kind-
lein von idealer Schönheit, iu Bildung und Hal-
tung wirklich ein kindlicher Gott, Maria ist voll
keuscher Lieblichkeit, und unter den Hirten — was
sind da für romantische Geftalten mit prächtigen
Charakterköpfen! Eine der schönften Partien des
Bildes ist die duftig gemalte Schar der Gloria-
engel. Renis Gemälde verdiente eigentlich mehr
als manches andere seiner unzäh-
ligemal reproduzierten Werke po-
pulär zu werden. Jft es auch nicht
eine so starke geniale Leistung wie
Correggios „heilige Nacht", so ist
es dafür viel mehr als diese wirk-
lich und im besten Sinne volkstüm-
lich empfunden.
Gerard Honthorst (1590
bis 1656) ist zwar von Geburt ein
Nordländer, näherhin ein Sohn
Hollands, indes seine Kunstweise
steht ganz uuter italienischem Ein-
fluß, er ist ein Jünger Caravag-
gios und hat sein Leben größten-
teils in Jtalien verbracht. So kön-
nen wir seine „Anbetung des
Kindes" gleichzeitig als Stichpro-
be aus der späteren italienischen Ma-
lerei und als eine Art Übergang zu
dem später zu betrachtenden nordi-
schen Weihnachtsbilde gelten lassen.
Für den ersten Augenblick wer-
den wir von Honthorsts Gemälde
(Abb. 14) entzückt sein. Wie Maria
so zart und sachte, so mädchenhaft
schüchtern und mütterlich stolz den
Schleier hebt! Wie die Freude lacht
aus den beiden herzigen Engel-
gesichtchen! Und kunstvoll ohne-
gleichen ist die Beleuchtung durch-
geführt. Leider ist dabei gerade für
diereligiöse Seite des Weihnachtsbildes soviel
wie nichts mehr übrig geblieben. Das ist keine
Madonua, diese „Eugel" sind nicht mehr als ein
paar hübsche kleine Mädchen. Die Jtaliener nann-
ten unseren Meister „Olasrku-cko ckolls iiottl",
weil er mit Vorliebe nächtliche Szenen malte.
Auch hier haben wir ein meisterhaftes Nacht- und
Beleuchtungsstück, ein Genre- aber kein eigentlich
religiöses Bild.
Überblicken wir nochmals die Entwicklung
seit Giotto: Welche Naturwahrheit in der Zeich-
nung, in der Behandlung des Raumes, welche
Freiheit in der Komposition ist von den späteren
Meistern erreicht worden! Und dann wußten sie
sich Ausdrucksmittel dienstbar und in drr voll-
endetsten Weise dienstbar zu machen, von denen
ein Giotto oder Fiesole noch kaum eine Ahnung
besessen hatten, vor allem die Farbe und das Licht.
Welch ein Fortschritt! Aber nicht immer auch
ein Fortschritt in dem, was Kern und Wesen
der religiösen Kunst bedeutet. Der tiefgläubigen
Schlichtheit Giottos, der reinen Zartheit Fiesoles,
der mystischen Jnbrunst Botticellis sind die Späte-
ren nicht einmal mehr nahe gekommen!
Bevor wir zum deutschen Weihnachtsbild über-
gehen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf
das Werk eines spanischen Meisters, des Se-
villaners Murillo (1617—1682) (Abb. 15).
Maria ist hier freilich auch nicht viel mehr als eine
hübsche ländliche Spauierin; das Kind ist überaus