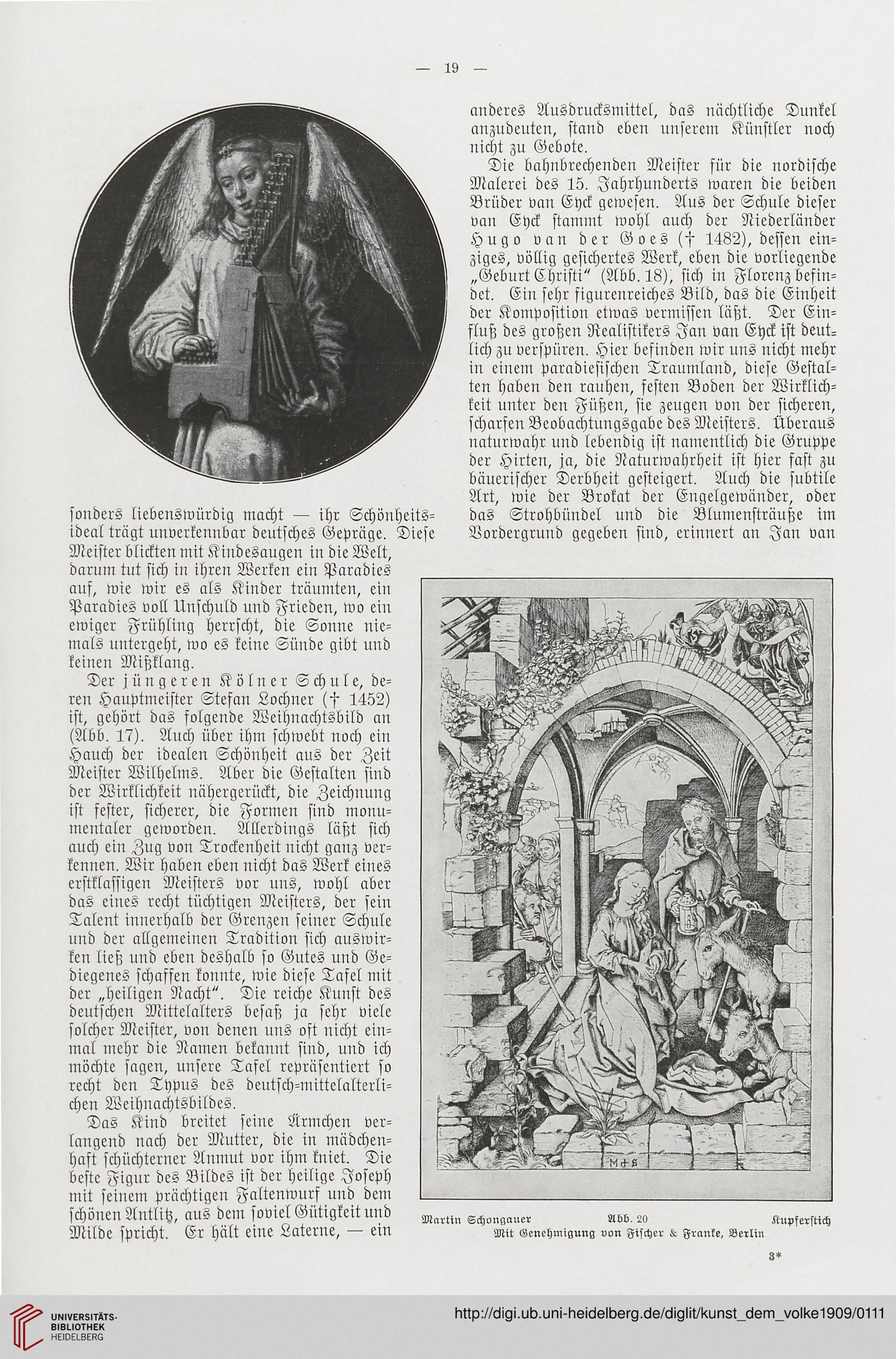19
sonders liebenswürdig macht — ihr Schönheits-
ideal trägt unverkennbar deutsches Gepräge. Diese
Meister blickten mit Kindesaugen in die Welt,
darum tut sich in ihren Werken ein Paradies
auf, wie wir es als Kinder träumten, ein
Paradies voll Unschuld und Frieden, wo ein
ewiger Frühling herrscht, die Sonne nie-
mals untergeht, wo es keine Sünde gibt und
keinen Mißklang.
Der jüngeren Kölner Schule, de-
ren Hauptmeister Stefan Lochner (ch 1452)
ist, gehört das folgende Weihnachtsbild an
(Abb. 17). Auch über ihm schwebt noch eiu
Hauch der idealen Schönheit aus der Zeit
Meister Wilhelms. Aber die Gestalten sind
der Wirklichkeit nähergerückt, die Zeichnung
ist fester, sicherer, die Formen sind monu-
mentaler geworden. Allerdings läßt sich
auch ein Zug von Trockenheit nicht ganz ver-
kennen. Wir haben eben nicht das Werk eines
erstklassigen Meisters vor uns, wohl aber
das eines recht tüchtigen Meisters, der sein
Talent innerhalb der Grenzen seiner Schule
und der allgemeinen Tradition sich auswir-
ken ließ und eben deshalb so Gutes und Ge-
diegenes schaffen konnte, wie diese Tafel mit
der „heiligen Nacht". Die reiche Kunst des
deutschen Mittelalters besaß ja sehr viele
solcher Meister, von denen uns oft nicht ein-
mal mehr die Namen bekannt sind, und ich
möchte sagen, unsere Tafel repräsentiert so
recht den Typus des deutsch-mittelalterli-
chen Weihnachtsbildes.
Das Kind breitet seine Ärmchen ver-
langend nach der Mutter, die in mädchen-
haft schüchterner Anmut vor ihm kniet. Die
beste Figur des Bildes ist der heilige Joseph
mit seiuem prächtigen Faltenwurf und dem
schönen Antlitz, aus dem soviel Gütigkeitund
Milde spricht. Er hält eine Laterne, — ein
anderes Ausdrucksmittel, das nächtliche Dunkel
anzudeuten, stand eben unserem Künstler noch
nicht zu Gebote.
Die bahnbrechendeu Meister für die nordische
Malerei des 15. Jahrhunderts waren die beiden
Brüder van Eyck gewesen. Aus der Schule dieser
van Eyck stammt wohl auch der Niederländer
Hugo van der Goes (ch 1482), dessen ein-
ziges, völlig gesichertes Werk, eben die vorliegende
„Geburt Christi" (Abb. 18), sich in Florenz befin-
det. Ein sehr figurenreiches Bild, das die Einheit
der Komposition etwas vermissen läßt. Der Ein-
fluß des großen Realistikers Jan van Eyck ist deut-
lich zu verspüren. Hier befinden wir uns nicht mehr
in einem paradiesischen Traumland, diese Gestal-
ten haben den rauhen, festen Boden der Wirklich-
keit unter den Füßen, sie zeugen von der sicheren,
scharfen Beobachtungsgabe des Meisters. Überaus
naturwahr und lebendig ist namentlich die Gruppe
der Hirten, ja, die Naturwahrheit ist hier fast zu
bäuerischer Derbheit gesteigert. Auch die subtile
Art, wie der Brokat der Engelgewänder, oder
das Strohbündel und die Blumensträuße im
Vordergrund gegeben sind, erinnert an Jau van
Martin Schonganer Abb. 20 Kupferstich
Mit Genehmigung von Fischer L Frante, Berlin
S*
sonders liebenswürdig macht — ihr Schönheits-
ideal trägt unverkennbar deutsches Gepräge. Diese
Meister blickten mit Kindesaugen in die Welt,
darum tut sich in ihren Werken ein Paradies
auf, wie wir es als Kinder träumten, ein
Paradies voll Unschuld und Frieden, wo ein
ewiger Frühling herrscht, die Sonne nie-
mals untergeht, wo es keine Sünde gibt und
keinen Mißklang.
Der jüngeren Kölner Schule, de-
ren Hauptmeister Stefan Lochner (ch 1452)
ist, gehört das folgende Weihnachtsbild an
(Abb. 17). Auch über ihm schwebt noch eiu
Hauch der idealen Schönheit aus der Zeit
Meister Wilhelms. Aber die Gestalten sind
der Wirklichkeit nähergerückt, die Zeichnung
ist fester, sicherer, die Formen sind monu-
mentaler geworden. Allerdings läßt sich
auch ein Zug von Trockenheit nicht ganz ver-
kennen. Wir haben eben nicht das Werk eines
erstklassigen Meisters vor uns, wohl aber
das eines recht tüchtigen Meisters, der sein
Talent innerhalb der Grenzen seiner Schule
und der allgemeinen Tradition sich auswir-
ken ließ und eben deshalb so Gutes und Ge-
diegenes schaffen konnte, wie diese Tafel mit
der „heiligen Nacht". Die reiche Kunst des
deutschen Mittelalters besaß ja sehr viele
solcher Meister, von denen uns oft nicht ein-
mal mehr die Namen bekannt sind, und ich
möchte sagen, unsere Tafel repräsentiert so
recht den Typus des deutsch-mittelalterli-
chen Weihnachtsbildes.
Das Kind breitet seine Ärmchen ver-
langend nach der Mutter, die in mädchen-
haft schüchterner Anmut vor ihm kniet. Die
beste Figur des Bildes ist der heilige Joseph
mit seiuem prächtigen Faltenwurf und dem
schönen Antlitz, aus dem soviel Gütigkeitund
Milde spricht. Er hält eine Laterne, — ein
anderes Ausdrucksmittel, das nächtliche Dunkel
anzudeuten, stand eben unserem Künstler noch
nicht zu Gebote.
Die bahnbrechendeu Meister für die nordische
Malerei des 15. Jahrhunderts waren die beiden
Brüder van Eyck gewesen. Aus der Schule dieser
van Eyck stammt wohl auch der Niederländer
Hugo van der Goes (ch 1482), dessen ein-
ziges, völlig gesichertes Werk, eben die vorliegende
„Geburt Christi" (Abb. 18), sich in Florenz befin-
det. Ein sehr figurenreiches Bild, das die Einheit
der Komposition etwas vermissen läßt. Der Ein-
fluß des großen Realistikers Jan van Eyck ist deut-
lich zu verspüren. Hier befinden wir uns nicht mehr
in einem paradiesischen Traumland, diese Gestal-
ten haben den rauhen, festen Boden der Wirklich-
keit unter den Füßen, sie zeugen von der sicheren,
scharfen Beobachtungsgabe des Meisters. Überaus
naturwahr und lebendig ist namentlich die Gruppe
der Hirten, ja, die Naturwahrheit ist hier fast zu
bäuerischer Derbheit gesteigert. Auch die subtile
Art, wie der Brokat der Engelgewänder, oder
das Strohbündel und die Blumensträuße im
Vordergrund gegeben sind, erinnert an Jau van
Martin Schonganer Abb. 20 Kupferstich
Mit Genehmigung von Fischer L Frante, Berlin
S*