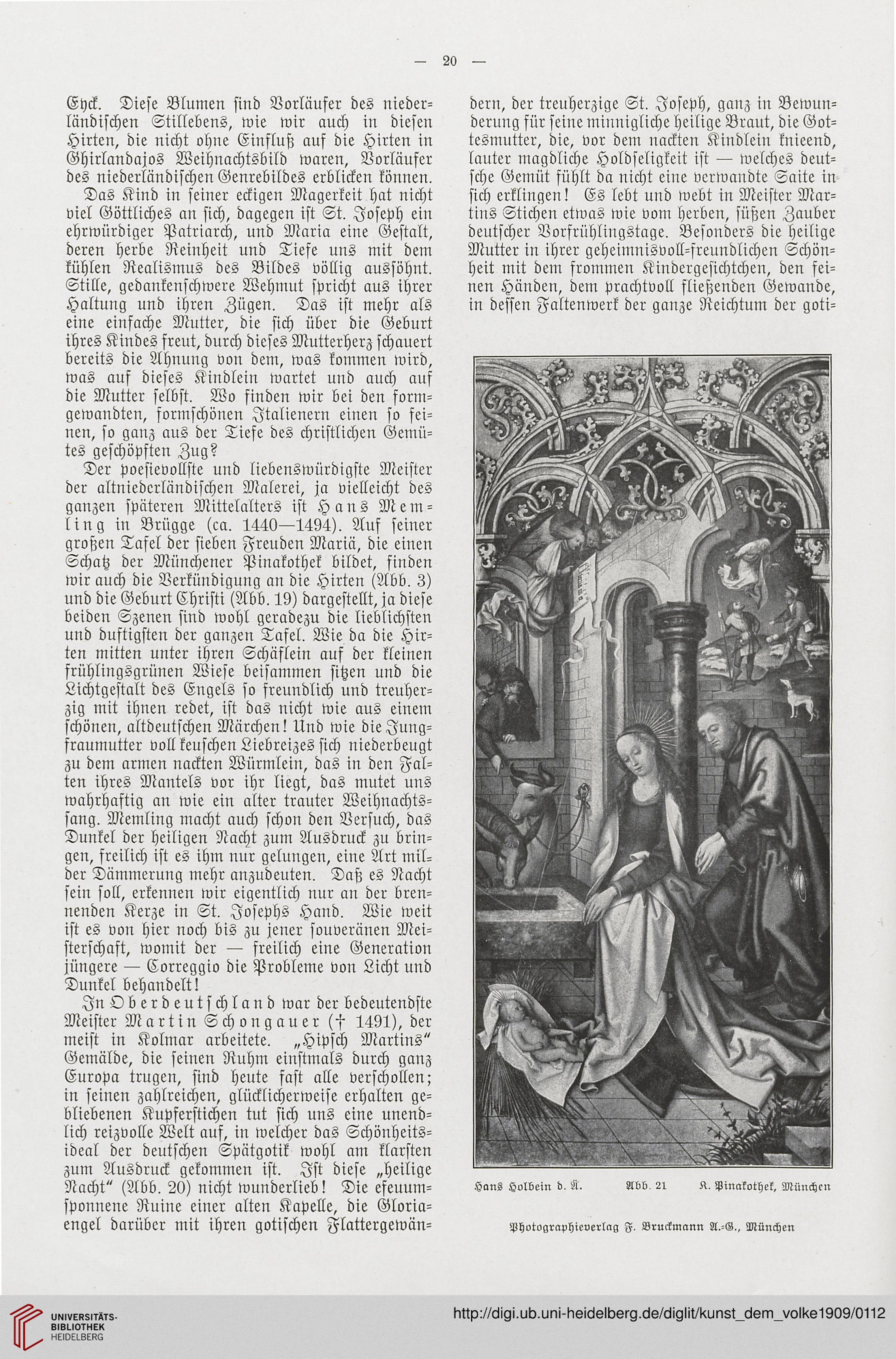20
Eyck. Diese Blumen sind Vorläufer des nieder-
ländischen Stillebens, wie wir auch in diesen
Hirten, die nicht ohne Einfluß auf die Hirten in
Ghirlandajos Weihnachtsbild waren, Vorläufer
des niederländischen Genrebildes erblicken können.
Das Kind in seiner eckigen Magerkeit hat nicht
viel Göttliches an sich, dagegen ist St. Joseph ein
ehrwürdiger Patriarch, und Maria eine Gestalt,
deren herbe Reinheit und Tiefe uns mit dem
kühlen Realismus des Bildes völlig aussöhnt.
Stille, gedankenschwere Wehmut spricht aus ihrer
Haltung und ihren Zügen. Das ist mehr als
eine einfache Mutter, die sich über die Geburt
ihres Kindes freut, durch dieses Mutterherz schauert
bereits die Ahnung von dem, was kommen wird,
was auf dieses Kindlein wartet und auch aus
die Mutter selbst. Wo finden wir bei den form-
gewandten, formschönen Jtalienern einen so fei-
nen, so ganz aus der Tiefe des christlichen Gemü-
tes geschöpften Zug?
Der poesievollste und liebenswürdigste Meister
der altniederländischen Malerei, ja vielleicht des
ganzen späteren Mittelalters ist Hans Mem-
ling in Brügge (ca. 1440—1494). Auf seiner
großen Tafel der sieben Freuden Mariä, die einen
Schatz der Münchener Pinakothek bildet, finden
wir auch die Verkündigung an die Hirten (Abb. 3)
und die Geburt Christi (Abb. 19) dargestellt, ja diese
beiden Szenen sind wohl geradezu die lieblichsten
und duftigsten der ganzen Tafel. Wie da die Hir-
ten mitten unter ihren Schäflein auf der kleinen
frühlingsgrünen Wiese beisammen sitzen und die
Lichtgestalt des Engels so freundlich und treuher-
zig mit ihnen redet, ist das nicht wie aus einem
schönen, altdeutschen Märchen! Und wie die Jung-
sraumutter vollkeuschen Liebreizes sich niederbeugt
zu dem armen nackten Würmlein, das in den Fal-
ten ihres Mantels vor ihr liegt, das mutet uns
wahrhastig an wie ein alter trauter Weihnachts-
sang. Memling macht auch schon den Versuch, das
Dunkel der heiligen Nacht zum Ausdruck zu brin-
gen, freilich ist es ihm nur gelungen, eine Art mil-
der Dämmerung mehr anzudeuten. Daß es Nacht
sein soll, erkennen wir eigentlich nur an der bren-
nenden Kerze in St. Josephs Hand. Wie weit
ist es von hier noch bis zu jener souveränen Mei-
sterschaft, womit der — freilich eine Generation
jüngere — Correggio die Probleme von Licht und
Dunkel behandelt!
JnOberdeutschland war der bedeutendste
Meister Martin Schongauer (ch 1491), der
meist in Kolmar arbeitete. „Hipsch Martins"
Gemälde, die seinen Ruhm einstmals durch ganz
Europa trugen, sind heute sast alle verschollen;
in seinen zahlreichen, glücklicherweise erhalten ge-
bliebenen Kupferstichen tut sich uns eine unend-
lich reizvolle Welt aus, in welcher das Schönheits-
ideal der deutschen Spätgotik wohl am klarsten
zum Ausdruck gekommen ist. Jst diese „heilige
Nacht" (Abb. 20) nicht wunderlieb! Die efeuum-
sponnene Ruine einer alten Kapelle, die Gloria-
engel darüber mit ihren gotischen Flmttergewän-
dern, der treuherzige St. Joseph, ganz in Bewun-
derung für seine minnigliche heilige Braut, die Got-
tesmutter, die, vor dem nackten Kindlein knieend,
lauter magdliche Holdseligkeit ist — welches deut-
sche Gemüt fühlt da nicht eine verwandte Saite in
sich erklingen! Es lebt und webt in Meister Mar-
tins Stichen etwas wie vom herben, süßen Zauber
deutscher Vorfrühlingstage. Besonders die heilige
Mutter in ihrer geheimnisvoll-freundlichen Schön-
heit mit dem frommen Kindergesichtchen, den fei-
nen Händen, dem prachtvoll fließenden Gewande,
in dessen Faltenwerk der ganze Reichtum der goti-
Photographteverlag F. Bruckmann A.-G., München
Eyck. Diese Blumen sind Vorläufer des nieder-
ländischen Stillebens, wie wir auch in diesen
Hirten, die nicht ohne Einfluß auf die Hirten in
Ghirlandajos Weihnachtsbild waren, Vorläufer
des niederländischen Genrebildes erblicken können.
Das Kind in seiner eckigen Magerkeit hat nicht
viel Göttliches an sich, dagegen ist St. Joseph ein
ehrwürdiger Patriarch, und Maria eine Gestalt,
deren herbe Reinheit und Tiefe uns mit dem
kühlen Realismus des Bildes völlig aussöhnt.
Stille, gedankenschwere Wehmut spricht aus ihrer
Haltung und ihren Zügen. Das ist mehr als
eine einfache Mutter, die sich über die Geburt
ihres Kindes freut, durch dieses Mutterherz schauert
bereits die Ahnung von dem, was kommen wird,
was auf dieses Kindlein wartet und auch aus
die Mutter selbst. Wo finden wir bei den form-
gewandten, formschönen Jtalienern einen so fei-
nen, so ganz aus der Tiefe des christlichen Gemü-
tes geschöpften Zug?
Der poesievollste und liebenswürdigste Meister
der altniederländischen Malerei, ja vielleicht des
ganzen späteren Mittelalters ist Hans Mem-
ling in Brügge (ca. 1440—1494). Auf seiner
großen Tafel der sieben Freuden Mariä, die einen
Schatz der Münchener Pinakothek bildet, finden
wir auch die Verkündigung an die Hirten (Abb. 3)
und die Geburt Christi (Abb. 19) dargestellt, ja diese
beiden Szenen sind wohl geradezu die lieblichsten
und duftigsten der ganzen Tafel. Wie da die Hir-
ten mitten unter ihren Schäflein auf der kleinen
frühlingsgrünen Wiese beisammen sitzen und die
Lichtgestalt des Engels so freundlich und treuher-
zig mit ihnen redet, ist das nicht wie aus einem
schönen, altdeutschen Märchen! Und wie die Jung-
sraumutter vollkeuschen Liebreizes sich niederbeugt
zu dem armen nackten Würmlein, das in den Fal-
ten ihres Mantels vor ihr liegt, das mutet uns
wahrhastig an wie ein alter trauter Weihnachts-
sang. Memling macht auch schon den Versuch, das
Dunkel der heiligen Nacht zum Ausdruck zu brin-
gen, freilich ist es ihm nur gelungen, eine Art mil-
der Dämmerung mehr anzudeuten. Daß es Nacht
sein soll, erkennen wir eigentlich nur an der bren-
nenden Kerze in St. Josephs Hand. Wie weit
ist es von hier noch bis zu jener souveränen Mei-
sterschaft, womit der — freilich eine Generation
jüngere — Correggio die Probleme von Licht und
Dunkel behandelt!
JnOberdeutschland war der bedeutendste
Meister Martin Schongauer (ch 1491), der
meist in Kolmar arbeitete. „Hipsch Martins"
Gemälde, die seinen Ruhm einstmals durch ganz
Europa trugen, sind heute sast alle verschollen;
in seinen zahlreichen, glücklicherweise erhalten ge-
bliebenen Kupferstichen tut sich uns eine unend-
lich reizvolle Welt aus, in welcher das Schönheits-
ideal der deutschen Spätgotik wohl am klarsten
zum Ausdruck gekommen ist. Jst diese „heilige
Nacht" (Abb. 20) nicht wunderlieb! Die efeuum-
sponnene Ruine einer alten Kapelle, die Gloria-
engel darüber mit ihren gotischen Flmttergewän-
dern, der treuherzige St. Joseph, ganz in Bewun-
derung für seine minnigliche heilige Braut, die Got-
tesmutter, die, vor dem nackten Kindlein knieend,
lauter magdliche Holdseligkeit ist — welches deut-
sche Gemüt fühlt da nicht eine verwandte Saite in
sich erklingen! Es lebt und webt in Meister Mar-
tins Stichen etwas wie vom herben, süßen Zauber
deutscher Vorfrühlingstage. Besonders die heilige
Mutter in ihrer geheimnisvoll-freundlichen Schön-
heit mit dem frommen Kindergesichtchen, den fei-
nen Händen, dem prachtvoll fließenden Gewande,
in dessen Faltenwerk der ganze Reichtum der goti-
Photographteverlag F. Bruckmann A.-G., München