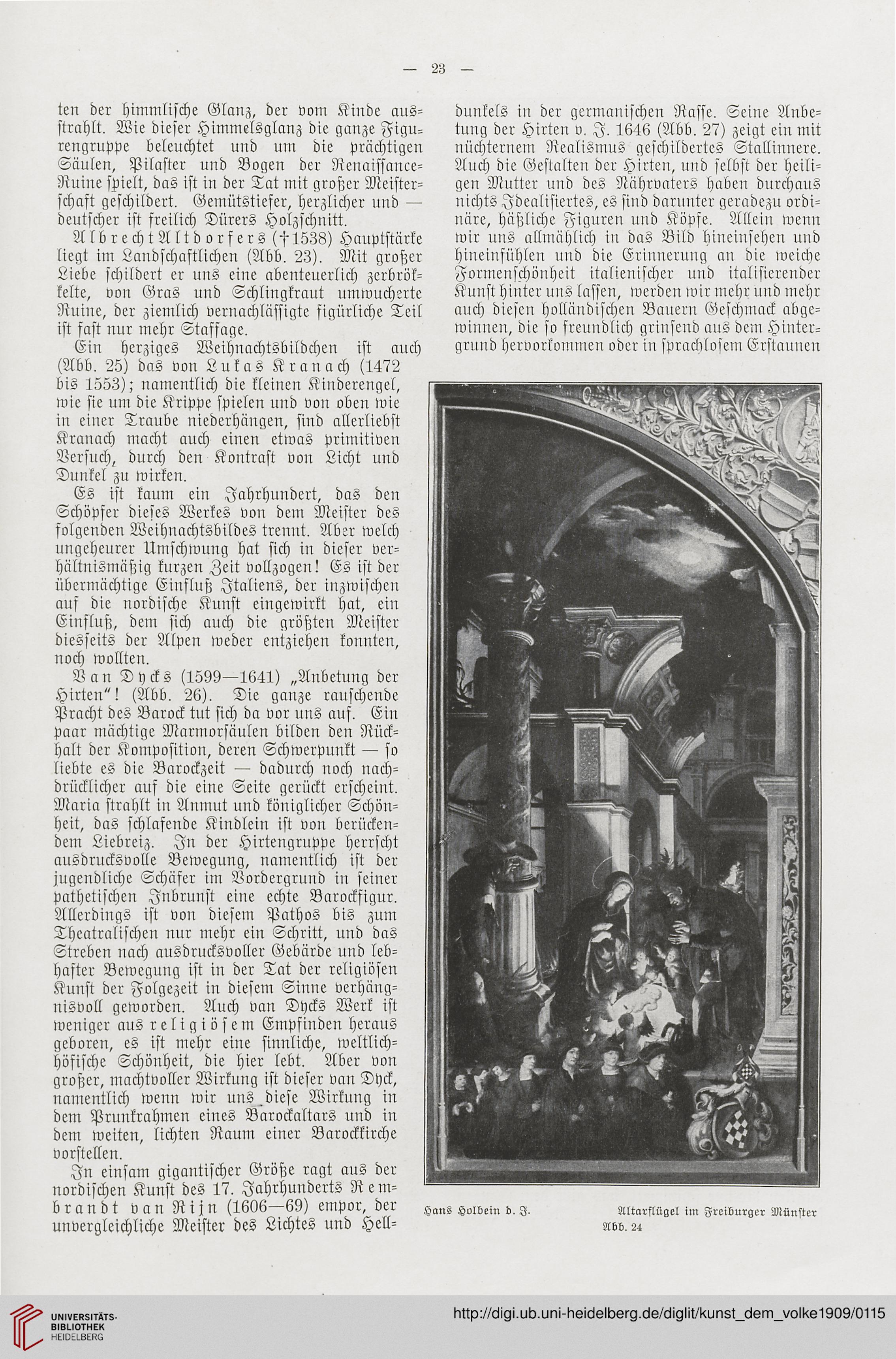23
ten der himmlische Glanz, der vom Kinde aus-
strahlt. Wie dieser Himmelsglanz die ganze Figu-
rengruppe beleuchtet und um die prächtigen
Säulen, Pilaster und Bogen der Renaissance-
Ruine spielt, das ist in der Tat mit großer Meister-
schaft geschildert. Gemütstiefer, herzlicher und —
deutscher ist freilich Dürers Holzschnitt.
AlbrechtAltdorfers (ch1538) Hauptstärke
liegt im Landschaftlichen (Abb. 23). Mit großer
Liebe schildert er uns eine abenteuerlich zerbrök-
kelte, von Gras und Schlingkraut umwucherte
Ruine, der ziemlich vernachlässigte figürliche Teil
ist fast nur mehr Staffage.
Ein herziges Weihnachtsbildchen ist auch
(Abb. 25) das von Lukas Kranach (1472
bis 1553); namentlich die kleinen Kinderengel,
wie sie um die Krippe spielen und von oben wie
in einer Traube niederhängen, sind allerliebst
Kranach macht auch einen etwas primitiven
Versuch, durch den Kontrast von Licht und
Dunkel zu wirken.
Es ist kaum ein Jahrhundert, das den
Schöpfer dieses Werkes von dem Meister des
folgenden Weihnachtsbildes trennt. Abrr welch
ungeheurer Umschwung hat sich in dieser ver-
hältnismäßig kurzen Zeit vollzogen! Es ist der
übermächtige Einfluß Jtaliens, der inzwischen
auf die nordische Kunst eingewirkt hat, ein
Einfluß, dem sich auch die größten Meister
diesseits der Alpen weder entziehen konnten,
noch wollten.
Van Dycks (1599—1641) „Anbetung der
Hirten"! (Abb. 26). Die ganze rauschende
Pracht des Barock tut sich da vor uns auf. Ein
paar mächtige Marmorsäulen bilden den Rück-
halt der Komposition, deren Schwerpunkt — so
liebte es die Barockzeit — dadurch noch nach-
drücklicher aus die eine Seite gerückt erscheint.
Maria strahlt in Anmut und königlicher Schön-
heit, das schlafende Kindlein ist von berücken-
dem Liebreiz. Jn der Hirtengruppe herrscht
ausdrucksvolle Bewegung, namentlich ist der
jugendliche Schäfer im Vordergrund in seiner
pathetischen Jnbrunst eine echte Barockfigur.
Allerdings ist von diesem Pathos bis zum
Thcatralischen nur mehr ein Schritt, und das
Streben nach ausdrucksvoller Gebärde und leb-
hafter Bewegung ist in der Tat der religiösen
Kunst der Folgezeit in diesem Sinne verhäng-
nisvoll geworden. Auch van Dycks Werk ist
weniger aus religiösem Empfinden heraus
geboren, es ist mehr eine sinnliche, weltlich-
höfische Schönheit, die hier lebt. Aber von
großer, machtvoller Wirkung ist dieser van Dyck,
namentlich wenn wir uns,diese Wirkung in
dem Prunkrahmen eines Barockaltars und in
dem weiten, lichten Raum einer Barockkirche
vorstellen.
Jn einsam gigantischer Größe ragt aus der
nordischen Kunst des 17. Jahrhunderts R e m-
brandt vanRijn (1606—69) empor, der
unvergleichliche Meister des Lichtes und Hell-
dunkels in der germanischen Rasse. Seine Anbe-
tung der Hirten v. I. 1646 (Abb. 27) zeigt ein mit
nüchternem Realismus geschildertes Stallinnere.
Auch die Gestalten der Hirten, und selbst der heili-
gen Mutter und des Nährvaters haben durchaus
nichts Jdealisiertes, es sind darunter geradezu ordi-
näre, häßliche Figuren und Köpfe. Allein wenn
wir uns allmählich in das Bild hineinsehen und
hineinfühlen und die Erinnerung an die weiche
Formenschönheit italienischer und italisierender
Kunst hinter uns lassen, werden wir mehr und mehr
auch diescn holländischen Bauern Geschmack abge-
winnen, die so freundlich grinsend aus dem Hinter-
grund hervorkommen oder in sprachlosem Erstaunen
Hans Holbein d. I. Altarslügel im Freiburger Münster
Abb. 24
ten der himmlische Glanz, der vom Kinde aus-
strahlt. Wie dieser Himmelsglanz die ganze Figu-
rengruppe beleuchtet und um die prächtigen
Säulen, Pilaster und Bogen der Renaissance-
Ruine spielt, das ist in der Tat mit großer Meister-
schaft geschildert. Gemütstiefer, herzlicher und —
deutscher ist freilich Dürers Holzschnitt.
AlbrechtAltdorfers (ch1538) Hauptstärke
liegt im Landschaftlichen (Abb. 23). Mit großer
Liebe schildert er uns eine abenteuerlich zerbrök-
kelte, von Gras und Schlingkraut umwucherte
Ruine, der ziemlich vernachlässigte figürliche Teil
ist fast nur mehr Staffage.
Ein herziges Weihnachtsbildchen ist auch
(Abb. 25) das von Lukas Kranach (1472
bis 1553); namentlich die kleinen Kinderengel,
wie sie um die Krippe spielen und von oben wie
in einer Traube niederhängen, sind allerliebst
Kranach macht auch einen etwas primitiven
Versuch, durch den Kontrast von Licht und
Dunkel zu wirken.
Es ist kaum ein Jahrhundert, das den
Schöpfer dieses Werkes von dem Meister des
folgenden Weihnachtsbildes trennt. Abrr welch
ungeheurer Umschwung hat sich in dieser ver-
hältnismäßig kurzen Zeit vollzogen! Es ist der
übermächtige Einfluß Jtaliens, der inzwischen
auf die nordische Kunst eingewirkt hat, ein
Einfluß, dem sich auch die größten Meister
diesseits der Alpen weder entziehen konnten,
noch wollten.
Van Dycks (1599—1641) „Anbetung der
Hirten"! (Abb. 26). Die ganze rauschende
Pracht des Barock tut sich da vor uns auf. Ein
paar mächtige Marmorsäulen bilden den Rück-
halt der Komposition, deren Schwerpunkt — so
liebte es die Barockzeit — dadurch noch nach-
drücklicher aus die eine Seite gerückt erscheint.
Maria strahlt in Anmut und königlicher Schön-
heit, das schlafende Kindlein ist von berücken-
dem Liebreiz. Jn der Hirtengruppe herrscht
ausdrucksvolle Bewegung, namentlich ist der
jugendliche Schäfer im Vordergrund in seiner
pathetischen Jnbrunst eine echte Barockfigur.
Allerdings ist von diesem Pathos bis zum
Thcatralischen nur mehr ein Schritt, und das
Streben nach ausdrucksvoller Gebärde und leb-
hafter Bewegung ist in der Tat der religiösen
Kunst der Folgezeit in diesem Sinne verhäng-
nisvoll geworden. Auch van Dycks Werk ist
weniger aus religiösem Empfinden heraus
geboren, es ist mehr eine sinnliche, weltlich-
höfische Schönheit, die hier lebt. Aber von
großer, machtvoller Wirkung ist dieser van Dyck,
namentlich wenn wir uns,diese Wirkung in
dem Prunkrahmen eines Barockaltars und in
dem weiten, lichten Raum einer Barockkirche
vorstellen.
Jn einsam gigantischer Größe ragt aus der
nordischen Kunst des 17. Jahrhunderts R e m-
brandt vanRijn (1606—69) empor, der
unvergleichliche Meister des Lichtes und Hell-
dunkels in der germanischen Rasse. Seine Anbe-
tung der Hirten v. I. 1646 (Abb. 27) zeigt ein mit
nüchternem Realismus geschildertes Stallinnere.
Auch die Gestalten der Hirten, und selbst der heili-
gen Mutter und des Nährvaters haben durchaus
nichts Jdealisiertes, es sind darunter geradezu ordi-
näre, häßliche Figuren und Köpfe. Allein wenn
wir uns allmählich in das Bild hineinsehen und
hineinfühlen und die Erinnerung an die weiche
Formenschönheit italienischer und italisierender
Kunst hinter uns lassen, werden wir mehr und mehr
auch diescn holländischen Bauern Geschmack abge-
winnen, die so freundlich grinsend aus dem Hinter-
grund hervorkommen oder in sprachlosem Erstaunen
Hans Holbein d. I. Altarslügel im Freiburger Münster
Abb. 24