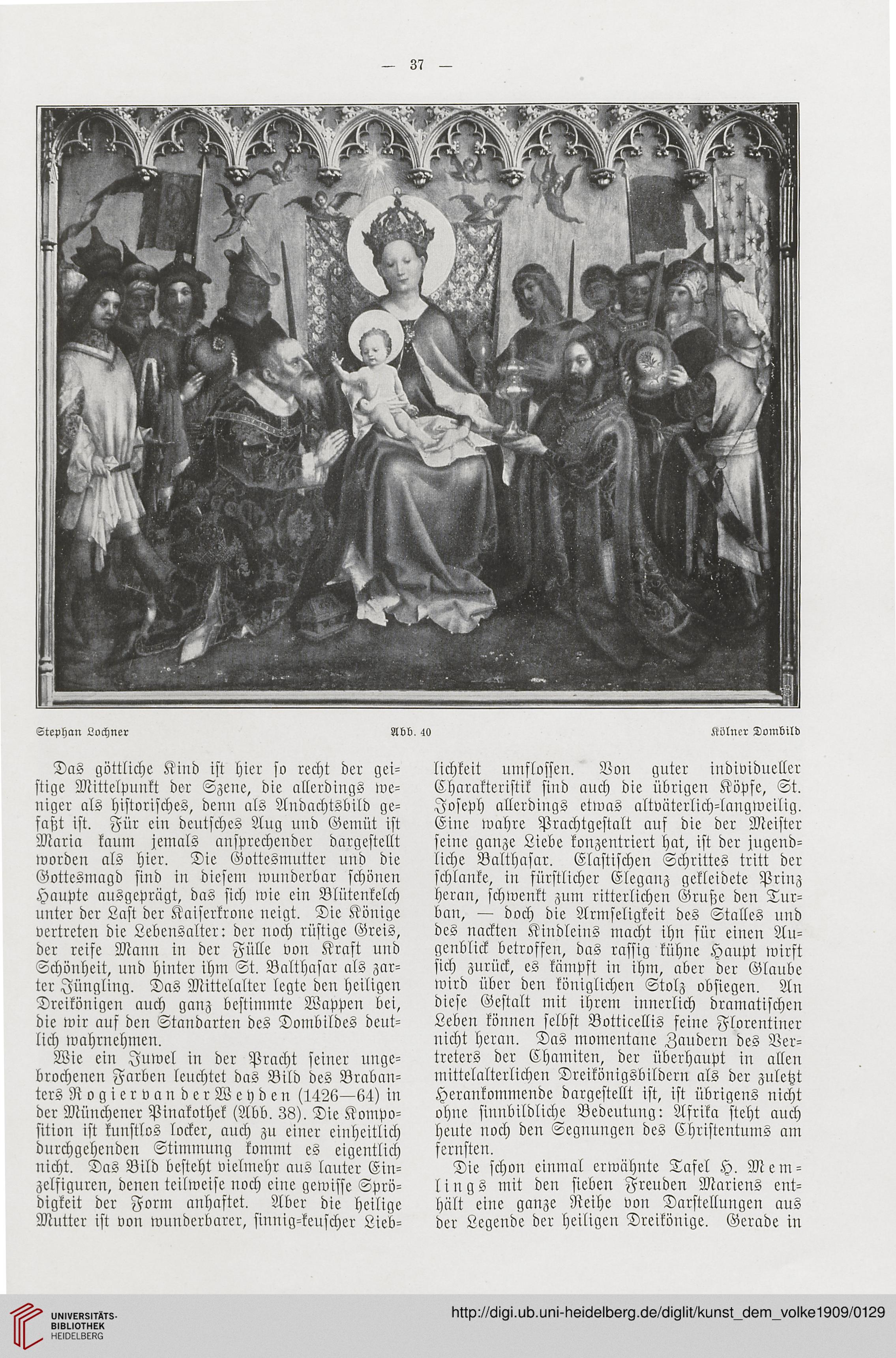37
Stephan Lochner Abb. 40
Das göttliche Kind ist hier so recht der gei-
stige Mittelpunkt der Szene, die allerdings we-
niger als historisches, denn als Andachtsbild ge-
faßt ist. Für ein deutsches Aug und Gemüt ist
Maria kaum jemals ansprechender dargestellt
worden als hier. Die Gottesmutter und die
Gottesmagd sind in diesem wunderbar schönen
Haupte ausgeprägt, das sich wie ein Blütenkelch
unter der Last der Kaiserkrone neigt. Die Könige
vertreten die Lebensalter: der noch rüstige Greis,
der reife Mann in der Fülle von Kraft und
Schönheit, und hinter ihm St. Balthasar als zar-
ter Jüngling. Das Mittelalter legte den heiligen
Dreikönigen auch ganz bestimmte Wappen bei,
die wir auf den Standarten des Dombildes deut-
lich wahrnehmen.
Wie ein Juwel in der Pracht seiner unge-
brochenen Farben leuchtet das Bild des Braban-
ters RogiervanderWeyden (1426—64) in
der Münchener Pinakothek (Abb. 38). Die Kompo-
sition ist kunstlos locker, auch zu einer einheitlich
durchgehenden Stimmung kommt es eigentlich
nicht. Das Bild besteht vielmehr aus lauter Ein-
zelfiguren, denen teilweise noch eine gewisse Sprö-
digkeit der Form anhaftet. Aber die heilige
Mutter ist von wunderbarer, sinnig-keuscher Lieb-
Kölner Dombild
lichkeit umflossen. Von guter individueller
Charakteristik sind auch die übrigen Köpfe, St.
Joseph allerdings etwas altväterlich-langweilig.
Eine wahre Prachtgestalt auf die der Meister
seine ganze Liebe konzentriert hat, ist der jugend-
liche Balthasar. Elastischen Schrittes tritt der
schlanke, in fürstlicher Eleganz gekleidete Prinz
heran, schwenkt zum ritterlichen Gruße den Tur-
ban, — doch die Armseligkeit des Stalles und
des nackten Kindleins macht ihn für einen Au-
genblick betroffen, das rassig kühne Haupt wirft
fich zurück, es kämpft in ihm, aber der Glaube
wird über den königlichen Stolz obsiegen. An
diese Gestalt mit ihrem innerlich dramatischen
Leben können selbst Botticellis feine Florentiner
nicht heran. Das momentane Zaudern des Ver-
treters der Chamiten, der überhaupt in allen
mittelalterlichen Dreikönigsbildern als der zuletzt
Herankommende dargestellt ist, ist übrigens nicht
ohne sinnbildliche Bedeutung: Afrika fteht auch
heute noch den Segnungen des Christentums am
fernsten.
Die schon einmal erwähnte Tafel H. Mem-
lings mit den sieben Freuden Mariens ent-
hält eine ganze Reihe von Darstellungen aus
der Legende der heiligen Dreikönige. Gerade in
Stephan Lochner Abb. 40
Das göttliche Kind ist hier so recht der gei-
stige Mittelpunkt der Szene, die allerdings we-
niger als historisches, denn als Andachtsbild ge-
faßt ist. Für ein deutsches Aug und Gemüt ist
Maria kaum jemals ansprechender dargestellt
worden als hier. Die Gottesmutter und die
Gottesmagd sind in diesem wunderbar schönen
Haupte ausgeprägt, das sich wie ein Blütenkelch
unter der Last der Kaiserkrone neigt. Die Könige
vertreten die Lebensalter: der noch rüstige Greis,
der reife Mann in der Fülle von Kraft und
Schönheit, und hinter ihm St. Balthasar als zar-
ter Jüngling. Das Mittelalter legte den heiligen
Dreikönigen auch ganz bestimmte Wappen bei,
die wir auf den Standarten des Dombildes deut-
lich wahrnehmen.
Wie ein Juwel in der Pracht seiner unge-
brochenen Farben leuchtet das Bild des Braban-
ters RogiervanderWeyden (1426—64) in
der Münchener Pinakothek (Abb. 38). Die Kompo-
sition ist kunstlos locker, auch zu einer einheitlich
durchgehenden Stimmung kommt es eigentlich
nicht. Das Bild besteht vielmehr aus lauter Ein-
zelfiguren, denen teilweise noch eine gewisse Sprö-
digkeit der Form anhaftet. Aber die heilige
Mutter ist von wunderbarer, sinnig-keuscher Lieb-
Kölner Dombild
lichkeit umflossen. Von guter individueller
Charakteristik sind auch die übrigen Köpfe, St.
Joseph allerdings etwas altväterlich-langweilig.
Eine wahre Prachtgestalt auf die der Meister
seine ganze Liebe konzentriert hat, ist der jugend-
liche Balthasar. Elastischen Schrittes tritt der
schlanke, in fürstlicher Eleganz gekleidete Prinz
heran, schwenkt zum ritterlichen Gruße den Tur-
ban, — doch die Armseligkeit des Stalles und
des nackten Kindleins macht ihn für einen Au-
genblick betroffen, das rassig kühne Haupt wirft
fich zurück, es kämpft in ihm, aber der Glaube
wird über den königlichen Stolz obsiegen. An
diese Gestalt mit ihrem innerlich dramatischen
Leben können selbst Botticellis feine Florentiner
nicht heran. Das momentane Zaudern des Ver-
treters der Chamiten, der überhaupt in allen
mittelalterlichen Dreikönigsbildern als der zuletzt
Herankommende dargestellt ist, ist übrigens nicht
ohne sinnbildliche Bedeutung: Afrika fteht auch
heute noch den Segnungen des Christentums am
fernsten.
Die schon einmal erwähnte Tafel H. Mem-
lings mit den sieben Freuden Mariens ent-
hält eine ganze Reihe von Darstellungen aus
der Legende der heiligen Dreikönige. Gerade in