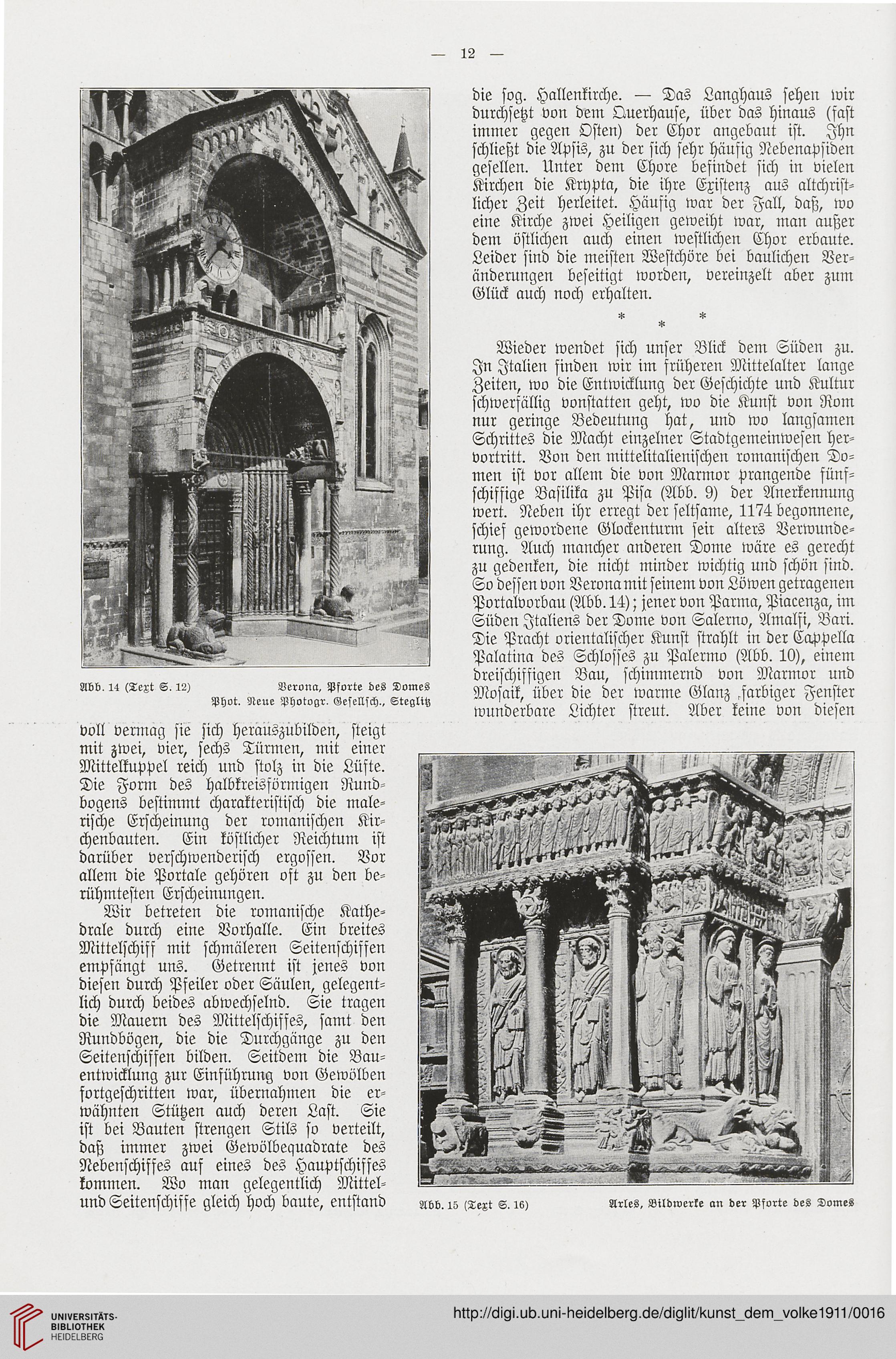12
die sog. Hallenkirche. — Das Langhaus sehen wir
durchsetzt von dem Querhause, über das hinaus (fast
immer gegen Osten) der Chor angebaut ist. Jhn
schließt die Apsis, zu der sich sehr häufig Nebenapsiden
gesellen. Unter dem Chore befindet sich in vielen
Kirchen die Krypta, die ihre Existenz aus altchrist-
licher Zeit herleitet. Häufig war der Fall, daß, wo
eine Kirche zwei Heiligen geweiht war, man außer
dem östlichen auch einen westlichen Chor erbaute.
Leider sind die meisten Westchöre bei baulichen Ver-
ändemngen beseitigt wordeu, vereinzelt aber zum
Glück auch noch erhalten.
Abb. 14 lText S. 12)
Verona, Pforte des Domes
Phot. Neue Photogr. Gesellsch., Steglitz
voll vermag sie sich herauszubilden, steigt
mit zwei, vier, sechs Türmen, mit einer
Mittelkuppel reich und stolz in die Lüfte.
Die Form des halbkreisförmigen Rund-
bogens bestimmt charakteristisch die male-
rische Erscheinung der romanischen Kir-
chenbauten. Ein köstlicher Reichtum ist
darüber verschwenderisch ergossen. Vor
allem die Portale gehören oft zu den be-
rühmtesten Erscheinungen.
Wir betreten die romanische Kathe-
drale durch eine Vorhalle. Ein breites
Mittelschiff mit schmäleren Seitenschiffen
empfängt uns. Getrennt ist jenes von
diesen durch Pfeiler oder Säulen, gelegent-
lich durch beides abwechselnd. Sie tragen
die Mauern des Mittelschiffes, samt den
Rundbögen, die die Durchgänge zu den
Seitenschiffeu bilden. Seitdem die Bau-
entwicklung zur Einführung von Gewölben
fortgeschritten war, übernahmen die er-
wähnten Stützen auch deren Last. Sie
ist bei Bauten strengen Stils so verteilt,
daß immer zwei Gewölbequadrate des
Nebenschiffes auf eines des Hauptschiffes
kommen. Wo man gelegentlich Mittel-
und Seitenschiffe gleich hoch baute, entstand
Wieder wendet sich unser Blick dem Süden zu.
Jn Jtalien finden wir im früheren Mittelalter lange
Zeiten, wo die Entwicklung der Geschichte und Kultur
schwerfällig vonstatten geht, wo die Kunst von Rom
nur geringe Bedeutung hat, und wo langsamen
Schrittes die Macht einzelner Stadtgemeinwesen her-
vortritt. Von den mittelitalienischen romanischen Do-
men ist vor allem die von Marmor prangende fünf-
schiffige Basilika zu Pisa (Abb. 9) der Anerkennung
wert. Neben ihr erregt der seltsame, 1174 begonnene,
schief gewordeue Glockenturm seir alters Verwunde-
mng. Auch mancher anderen Dome wäre es gerecht
zu gedenken, die nicht minder wichtig und schön sind.
So dessenvon Veronamitseinemvon Löwen getragenen
Portalvorbau (Abb. 14); jener von Parma, Piacenza, im
Süden Jtaliens der Dome von Salerno, Amalfi, Bari.
Die Pracht orientalischer Kunst strahlt in der Cappella
Palatina des Schlosses zu Palermo (Abb. 10), einem
dreischiffigen Bau, schimmernd von Marmor und
Mosaik, über die der warme Glanz starbiger Fenster
wunderbare Lichter streut. Aber keine von diesen
Abb. is iText S. 16)
Arles, Bildwerle an der Pforte des Domes
die sog. Hallenkirche. — Das Langhaus sehen wir
durchsetzt von dem Querhause, über das hinaus (fast
immer gegen Osten) der Chor angebaut ist. Jhn
schließt die Apsis, zu der sich sehr häufig Nebenapsiden
gesellen. Unter dem Chore befindet sich in vielen
Kirchen die Krypta, die ihre Existenz aus altchrist-
licher Zeit herleitet. Häufig war der Fall, daß, wo
eine Kirche zwei Heiligen geweiht war, man außer
dem östlichen auch einen westlichen Chor erbaute.
Leider sind die meisten Westchöre bei baulichen Ver-
ändemngen beseitigt wordeu, vereinzelt aber zum
Glück auch noch erhalten.
Abb. 14 lText S. 12)
Verona, Pforte des Domes
Phot. Neue Photogr. Gesellsch., Steglitz
voll vermag sie sich herauszubilden, steigt
mit zwei, vier, sechs Türmen, mit einer
Mittelkuppel reich und stolz in die Lüfte.
Die Form des halbkreisförmigen Rund-
bogens bestimmt charakteristisch die male-
rische Erscheinung der romanischen Kir-
chenbauten. Ein köstlicher Reichtum ist
darüber verschwenderisch ergossen. Vor
allem die Portale gehören oft zu den be-
rühmtesten Erscheinungen.
Wir betreten die romanische Kathe-
drale durch eine Vorhalle. Ein breites
Mittelschiff mit schmäleren Seitenschiffen
empfängt uns. Getrennt ist jenes von
diesen durch Pfeiler oder Säulen, gelegent-
lich durch beides abwechselnd. Sie tragen
die Mauern des Mittelschiffes, samt den
Rundbögen, die die Durchgänge zu den
Seitenschiffeu bilden. Seitdem die Bau-
entwicklung zur Einführung von Gewölben
fortgeschritten war, übernahmen die er-
wähnten Stützen auch deren Last. Sie
ist bei Bauten strengen Stils so verteilt,
daß immer zwei Gewölbequadrate des
Nebenschiffes auf eines des Hauptschiffes
kommen. Wo man gelegentlich Mittel-
und Seitenschiffe gleich hoch baute, entstand
Wieder wendet sich unser Blick dem Süden zu.
Jn Jtalien finden wir im früheren Mittelalter lange
Zeiten, wo die Entwicklung der Geschichte und Kultur
schwerfällig vonstatten geht, wo die Kunst von Rom
nur geringe Bedeutung hat, und wo langsamen
Schrittes die Macht einzelner Stadtgemeinwesen her-
vortritt. Von den mittelitalienischen romanischen Do-
men ist vor allem die von Marmor prangende fünf-
schiffige Basilika zu Pisa (Abb. 9) der Anerkennung
wert. Neben ihr erregt der seltsame, 1174 begonnene,
schief gewordeue Glockenturm seir alters Verwunde-
mng. Auch mancher anderen Dome wäre es gerecht
zu gedenken, die nicht minder wichtig und schön sind.
So dessenvon Veronamitseinemvon Löwen getragenen
Portalvorbau (Abb. 14); jener von Parma, Piacenza, im
Süden Jtaliens der Dome von Salerno, Amalfi, Bari.
Die Pracht orientalischer Kunst strahlt in der Cappella
Palatina des Schlosses zu Palermo (Abb. 10), einem
dreischiffigen Bau, schimmernd von Marmor und
Mosaik, über die der warme Glanz starbiger Fenster
wunderbare Lichter streut. Aber keine von diesen
Abb. is iText S. 16)
Arles, Bildwerle an der Pforte des Domes