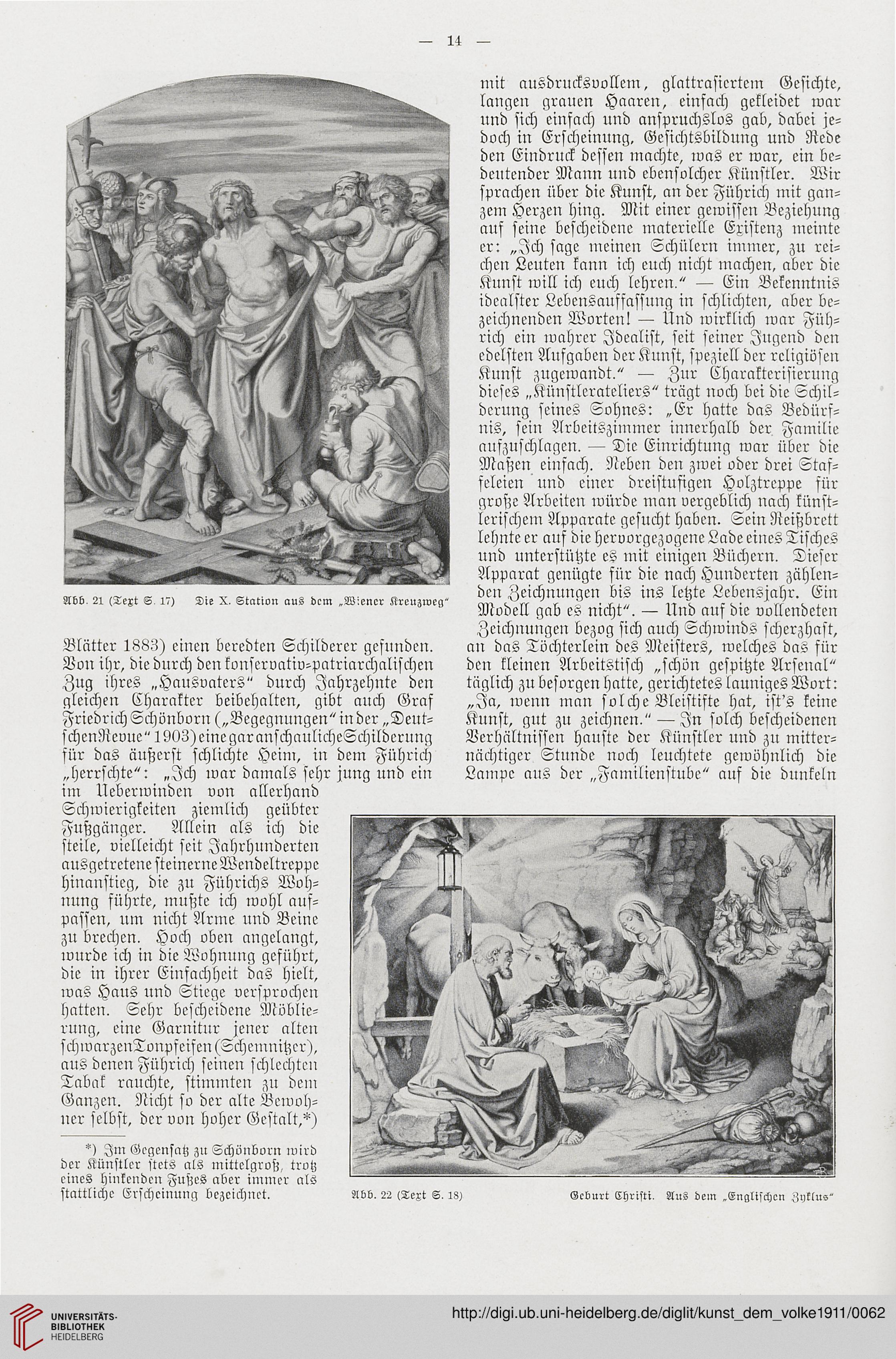14
Abb. 21 (Text S. 17) Dle X. Statwn aus dcm „Wiener Kreuzrveg"
Blätter 1883) einen beredten Schilderer gefunden.
Von ihr, die durch den konseroativ-patriarchalischen
Zug ihres „Hausvaters" durch Jahrzehnte den
gleichen Charakter beibehalten, gibt auch Graf
Friedrich Schönborn („Begegnungen" in der „Deut-
schenRevue" 1903)einegaranschaulicheSchilderung
für das äußerst schlichte Heim, in dem Führich
„herrschte": „Jch ivar damals sehr jung und ein
im Ueberwinden von allerhand
Schwierigkeiten ziemlich geübter
Fußgänger. Allein als ich die
steile, vielleicht seit Jahrhunderten
ausgetretenesteiuerneWendeltreppc
hinanstieg, die zu Führichs Woh-
nung führte, mußte ich wohl auf-
passen, um nicht Arme und Beine
zu brechen. Hoch oben angelangt,
wurde ich in die Wohnung geführt,
die in ihrer Einfachheit das hielt,
was Haus und Stiege versprochen
hatten. Sehr bescheidene Möbtie-
rung, eine Garnitur fener alten
schwarzenTonpfeifen(Schemnitzcr),
aus denen Führich seinen schlechten
Tabak rauchte, stimmten zu dem
Ganzen. Nicht fo der alte Bewoh-
ner selbst, dcr von hoher Gestalt,*)
*) Jm Gegensntz zu Schönborn wird
der Künstler stets als mittelgrost, trotz
eines hinkenden Fuszes aber immer als
stattliche Erschcinung bezeichnet. Abb. 22 (Text S. 18)
mit ausdrucksvollem, glattrasiertem Gesichte,
langen grauen Haaren, einfach gekleidet war
und sich einfach und anspruchslos gab, dabei je-
doch in Erscheinung, Gesichtsbildung und Rede
den Eindruck dessen machte, was er war, ein be-
deutender Mann und ebensolcher Künstler. Wir
fprachen über die Kunst, an der Führich mit gan-
zem Herzen hing. Mit einer gewissen Beziehung
auf feine bescheidenc materielle Existenz meinte
er: „Jch sage meinen Schülern immer, zu rei-
chen Leuten kann ich euch nicht machen, aber die
Kunst ivill ich euch lehren." — Ein Bekenntnis
idealster Lebensauffassung in schlichten, aber be-
zeichnenden Worten! — Ilnd wirklich war Füh-
rich ein ivahrer Jdealist, seit seiner Jugend den
edelsten Aufgaben der Kunst, speziell der rcligiösen
Kunst zugewandt." — Zur Charakterisierung
dieses „Künstlerateliers" trägt noch bei die Schil-
derung seines Sohnes: „Er hatte das Bedürf-
nis, sein Arbeitszimmer innerhalb der Familie
aufzuschlagen. — Die Einrichtung war über die
Maßen einsach. Neben den zwei oder drei Staf-
feleien und einer dreistufigen Holztreppe sür
große Arbeiten würde man vergeblich nach künst-
lerischem Apparate gesucht haben. Sein Reißbrett
lehnte er auf die hervorgezogene Lade eines Tisches
und unterstützte es mit einigen Büchern. Dieser
Apparat genügte für die nach Hunderten zählen-
den Zeichnungen bis ins letzte Lebensjahr. Ein
Modell gab es nicht". — llnd auf die vollendeten
Zeichnungen bezog sich auch Schwinds scherzhast,
an das Töchterlein des Meisters, welches das für
den kleinen Arbeitstisch „schön gespitzte Arsenal"
täglich zu besorgen hatte, gerichtetes launiges Wort:
„Ja, wenn man solche Bleistifte hat, ist's keine
Kunst, gut zu zeichnen." — Jn solch bescheidenen
Verhältnissen hauste der Künstler und zn mitter-
nächtiger Stnnde noch leuchtete geivöhnlich die
Lampe aus der „Familienstube" auf die dunkeln
Gcburt Christi. Aus dem „Engltschcn Zyklus"
Abb. 21 (Text S. 17) Dle X. Statwn aus dcm „Wiener Kreuzrveg"
Blätter 1883) einen beredten Schilderer gefunden.
Von ihr, die durch den konseroativ-patriarchalischen
Zug ihres „Hausvaters" durch Jahrzehnte den
gleichen Charakter beibehalten, gibt auch Graf
Friedrich Schönborn („Begegnungen" in der „Deut-
schenRevue" 1903)einegaranschaulicheSchilderung
für das äußerst schlichte Heim, in dem Führich
„herrschte": „Jch ivar damals sehr jung und ein
im Ueberwinden von allerhand
Schwierigkeiten ziemlich geübter
Fußgänger. Allein als ich die
steile, vielleicht seit Jahrhunderten
ausgetretenesteiuerneWendeltreppc
hinanstieg, die zu Führichs Woh-
nung führte, mußte ich wohl auf-
passen, um nicht Arme und Beine
zu brechen. Hoch oben angelangt,
wurde ich in die Wohnung geführt,
die in ihrer Einfachheit das hielt,
was Haus und Stiege versprochen
hatten. Sehr bescheidene Möbtie-
rung, eine Garnitur fener alten
schwarzenTonpfeifen(Schemnitzcr),
aus denen Führich seinen schlechten
Tabak rauchte, stimmten zu dem
Ganzen. Nicht fo der alte Bewoh-
ner selbst, dcr von hoher Gestalt,*)
*) Jm Gegensntz zu Schönborn wird
der Künstler stets als mittelgrost, trotz
eines hinkenden Fuszes aber immer als
stattliche Erschcinung bezeichnet. Abb. 22 (Text S. 18)
mit ausdrucksvollem, glattrasiertem Gesichte,
langen grauen Haaren, einfach gekleidet war
und sich einfach und anspruchslos gab, dabei je-
doch in Erscheinung, Gesichtsbildung und Rede
den Eindruck dessen machte, was er war, ein be-
deutender Mann und ebensolcher Künstler. Wir
fprachen über die Kunst, an der Führich mit gan-
zem Herzen hing. Mit einer gewissen Beziehung
auf feine bescheidenc materielle Existenz meinte
er: „Jch sage meinen Schülern immer, zu rei-
chen Leuten kann ich euch nicht machen, aber die
Kunst ivill ich euch lehren." — Ein Bekenntnis
idealster Lebensauffassung in schlichten, aber be-
zeichnenden Worten! — Ilnd wirklich war Füh-
rich ein ivahrer Jdealist, seit seiner Jugend den
edelsten Aufgaben der Kunst, speziell der rcligiösen
Kunst zugewandt." — Zur Charakterisierung
dieses „Künstlerateliers" trägt noch bei die Schil-
derung seines Sohnes: „Er hatte das Bedürf-
nis, sein Arbeitszimmer innerhalb der Familie
aufzuschlagen. — Die Einrichtung war über die
Maßen einsach. Neben den zwei oder drei Staf-
feleien und einer dreistufigen Holztreppe sür
große Arbeiten würde man vergeblich nach künst-
lerischem Apparate gesucht haben. Sein Reißbrett
lehnte er auf die hervorgezogene Lade eines Tisches
und unterstützte es mit einigen Büchern. Dieser
Apparat genügte für die nach Hunderten zählen-
den Zeichnungen bis ins letzte Lebensjahr. Ein
Modell gab es nicht". — llnd auf die vollendeten
Zeichnungen bezog sich auch Schwinds scherzhast,
an das Töchterlein des Meisters, welches das für
den kleinen Arbeitstisch „schön gespitzte Arsenal"
täglich zu besorgen hatte, gerichtetes launiges Wort:
„Ja, wenn man solche Bleistifte hat, ist's keine
Kunst, gut zu zeichnen." — Jn solch bescheidenen
Verhältnissen hauste der Künstler und zn mitter-
nächtiger Stnnde noch leuchtete geivöhnlich die
Lampe aus der „Familienstube" auf die dunkeln
Gcburt Christi. Aus dem „Engltschcn Zyklus"