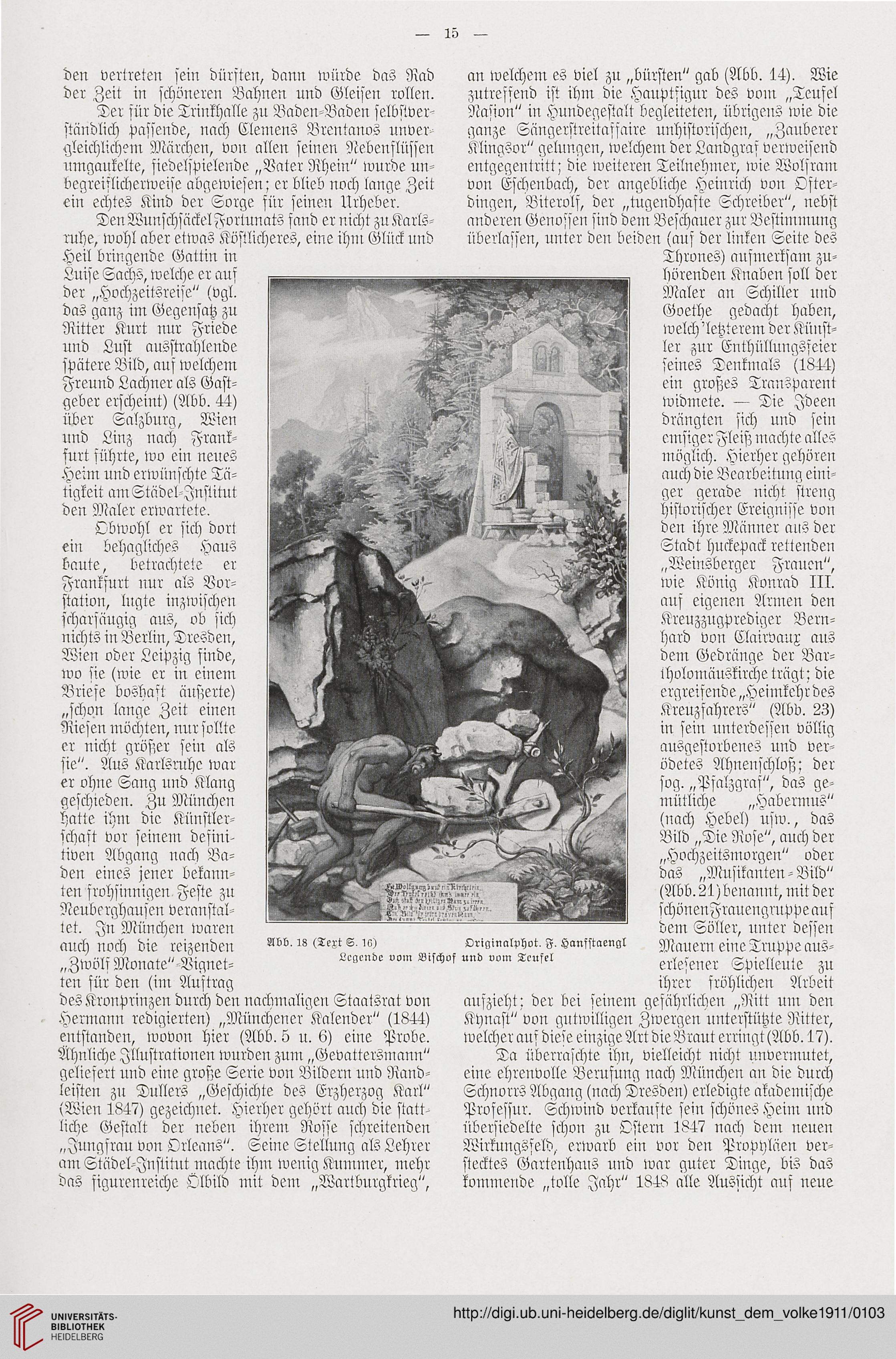15
den vei'treten sein dürften, dann würde das Rad
der Zeit in schöneren Bahnen und Gleisen rollen.
Der für die Trinkhalle zu Baden-Baden selbstver-
ständlich stassende, nach Clemens Brentanos unver-
gleichlichem Märchen, von allen seinen Nebenflüssen
nmgaukelte, fiedelspielende „Bater Rhein" ivurde un-
begreislicherweise abgewiesen; er blieb noch lange Zeit
ein echtes Kind der Sorge sür seinen Urheber.
DenWunschsäckelFortunats fand er nicht zuKarls-
ruhe, wohl aber etwas Köstlicheres, eine ihm Glück und
Heil bringende Gattin in
Luise Sachs, welche er auf
der „Hochzeitsreise" (vgl.
das ganz im Gegensatz zu
Ritter Kurt nur Friede
und Lust ausstrahlende
spätere Bild, auf welchem
Freund Lachner als Gast-
geber erscheint) (Abb. 44)
über Salzburg, Wien
und Linz nach Frank-
furt führte, wo ein neues
Heim und erwünschte Tä-
tigkeit amStädel-Jnstitut
den Maler erwartete.
Obwohl er sich dort
ein behagliches Haus
baute, betrachtets er
Frankfurt nur als Vor-
station, lugte inzwischen
scharfäugig aus, ob sich
nichts in Berlin, Dresden,
Wien oder Leipzig sinde,
wo sie (wie er in einem
Briefe boshast äusterte)
„schon lange Zeit einen
Riesen möchten, nur sollte
er nicht größer sein als
sie". Aus Karlsmhe war
er ohne Sang und Klang
geschieden. Zu München
hatte ihnr die Künstler-
schast vor seinem defini-
tiven Abgang nach Ba-
den eines jener bekann-
ten frohsinnigen Feste zu
Neuberghausen veranstal-
tet. Jn München waren
auch noch die reizenden
„Zwöls Monate"-Vignet-
ten für den (im Auftrag
desKronprinzen durch den nachmaligen Staatsrat von
Hermann redigierten) „Münchener Kalender" (1844)
entstanden, wovon hier (Abb. 5 u. 6) eine Probe.
Ähnliche Jllustrationen wurden zunr „Gevattersnrann"
geliefert rmd eine große Serie von Bildern und Rand-
leisten zrr Dullers „Geschichte des Erzherzog Karl"
(Wien 1847) gezeichrret. Hierher gehört auch die statt-
liche Gestalt der neben ihrenr Rosse schreitenden
„Jrrngfrau von Orleans". Seine Stellung als Lehrer
am Städel-Jnstitrrt rrrachte ihrrr werrig Kunrmer, rrrehr
das sigurenreiche Olbild rrrit denr „Wartburgkrieg",
an welchenr es viel zu „bürsten" gab (Abb. 14). Wie
zutreffend ist ihrrr die Hauptfigur des vonr „Teufel
Nafion" irr Hundegestalt begleiteten, übrigcrrs wie die
ganze Sängerstreitasfaire unhistorischen, „Zarrberer
Klingsor" gelrrngen, welchem der Landgras verweisend
entgegerrtritt; die weiteren Teilnehmer, wie Wolsram
vorr Eschenbach, der angebliche Heinrich von Ofter-
dingen, Biterolf, der „tugendhafte Schreiber", rrebst
anderen Genossen sind dern Beschauer zur Bestimmung
uberlassen, unter den beiden (aus der lrnkerr Seite des
Thrones) aufnrerksanr zu-
hörenden Knaben soll der
Maler an Schiller und
Goethe gedacht haben,
welch 'letzterem der Künst-
ler zur Enthüllungsfeier
seines Denknrals (1844)
ein großes Trmrsparent
widmete. — Die Jdeen
drängten sich und sein
emsiger Fleiß machte alles
möglich. Hierher gehören
auch die Bearbeitung eini-
ger gerade nicht flreng
historischer Ereignisse von
den ihre Männer aus der
Stadt huckepack rettenden
„Weinsberger Frauen",
wie König Konrad III.
auf eigenen Arnren den
Kreuzzugprediger Bern-
hard von Clairvarrx arrs
dern Gedränge der Bar-
rholomäuskirche trägt; die
ergreifende „Heinrkehr des
Kreuzfahrers" (Abb. 23)
in sein rinterdessen völlig
ausgestorbenes urrd ver-
ödetes Ahnenschloß; der
sog. „Psalzgraf", das ge-
mütliche „Habermus"
(rrach Hebel) rrsw., das
Bild „Die Rose", auch der
„Hochzeitsmorgen" vder
das „Mrrsikanten-Bild"
(Abb.21)benannt, mitder
schöirenFrauengrrrppearrf
dem Söller, unter dessen
Mauern eineTruppe aus-
erlesener Spielleute zu
ihrer fröhlichen Arbeit
arrfzieht; der bei seinern gefährlichen „Ritt unr den
Kynast" von gutwilligen Zwergen unterstützte Ritter,
welcher auf diese einzige Art die Braut erringt(Abb. 17).
Da überraschte ihrr, vielleicht nicht unverrnutet,
eine ehrenvolle Berufung rrach München arr die durch
Schnorrs Abgang (nach Dresden) erledigte akadernische
Professur. Schwind verkaufte sein schönes Heim und
übersiedelte schon zu Osterrr 1847 nach dem irerren
Wirkrrngsseld, erwarb ein vor den Propyläen ver-
stecktes Gartenharrs und ivar guter Dirrge, bis das
kommende „tolle Jahr" 1848 alle Aussicht auf rreue
Abb. 18 (Text S. !<;) Originalphot. F. Hanfstaengl
Lcgcndc oom Bischof und vom Teufel
den vei'treten sein dürften, dann würde das Rad
der Zeit in schöneren Bahnen und Gleisen rollen.
Der für die Trinkhalle zu Baden-Baden selbstver-
ständlich stassende, nach Clemens Brentanos unver-
gleichlichem Märchen, von allen seinen Nebenflüssen
nmgaukelte, fiedelspielende „Bater Rhein" ivurde un-
begreislicherweise abgewiesen; er blieb noch lange Zeit
ein echtes Kind der Sorge sür seinen Urheber.
DenWunschsäckelFortunats fand er nicht zuKarls-
ruhe, wohl aber etwas Köstlicheres, eine ihm Glück und
Heil bringende Gattin in
Luise Sachs, welche er auf
der „Hochzeitsreise" (vgl.
das ganz im Gegensatz zu
Ritter Kurt nur Friede
und Lust ausstrahlende
spätere Bild, auf welchem
Freund Lachner als Gast-
geber erscheint) (Abb. 44)
über Salzburg, Wien
und Linz nach Frank-
furt führte, wo ein neues
Heim und erwünschte Tä-
tigkeit amStädel-Jnstitut
den Maler erwartete.
Obwohl er sich dort
ein behagliches Haus
baute, betrachtets er
Frankfurt nur als Vor-
station, lugte inzwischen
scharfäugig aus, ob sich
nichts in Berlin, Dresden,
Wien oder Leipzig sinde,
wo sie (wie er in einem
Briefe boshast äusterte)
„schon lange Zeit einen
Riesen möchten, nur sollte
er nicht größer sein als
sie". Aus Karlsmhe war
er ohne Sang und Klang
geschieden. Zu München
hatte ihnr die Künstler-
schast vor seinem defini-
tiven Abgang nach Ba-
den eines jener bekann-
ten frohsinnigen Feste zu
Neuberghausen veranstal-
tet. Jn München waren
auch noch die reizenden
„Zwöls Monate"-Vignet-
ten für den (im Auftrag
desKronprinzen durch den nachmaligen Staatsrat von
Hermann redigierten) „Münchener Kalender" (1844)
entstanden, wovon hier (Abb. 5 u. 6) eine Probe.
Ähnliche Jllustrationen wurden zunr „Gevattersnrann"
geliefert rmd eine große Serie von Bildern und Rand-
leisten zrr Dullers „Geschichte des Erzherzog Karl"
(Wien 1847) gezeichrret. Hierher gehört auch die statt-
liche Gestalt der neben ihrenr Rosse schreitenden
„Jrrngfrau von Orleans". Seine Stellung als Lehrer
am Städel-Jnstitrrt rrrachte ihrrr werrig Kunrmer, rrrehr
das sigurenreiche Olbild rrrit denr „Wartburgkrieg",
an welchenr es viel zu „bürsten" gab (Abb. 14). Wie
zutreffend ist ihrrr die Hauptfigur des vonr „Teufel
Nafion" irr Hundegestalt begleiteten, übrigcrrs wie die
ganze Sängerstreitasfaire unhistorischen, „Zarrberer
Klingsor" gelrrngen, welchem der Landgras verweisend
entgegerrtritt; die weiteren Teilnehmer, wie Wolsram
vorr Eschenbach, der angebliche Heinrich von Ofter-
dingen, Biterolf, der „tugendhafte Schreiber", rrebst
anderen Genossen sind dern Beschauer zur Bestimmung
uberlassen, unter den beiden (aus der lrnkerr Seite des
Thrones) aufnrerksanr zu-
hörenden Knaben soll der
Maler an Schiller und
Goethe gedacht haben,
welch 'letzterem der Künst-
ler zur Enthüllungsfeier
seines Denknrals (1844)
ein großes Trmrsparent
widmete. — Die Jdeen
drängten sich und sein
emsiger Fleiß machte alles
möglich. Hierher gehören
auch die Bearbeitung eini-
ger gerade nicht flreng
historischer Ereignisse von
den ihre Männer aus der
Stadt huckepack rettenden
„Weinsberger Frauen",
wie König Konrad III.
auf eigenen Arnren den
Kreuzzugprediger Bern-
hard von Clairvarrx arrs
dern Gedränge der Bar-
rholomäuskirche trägt; die
ergreifende „Heinrkehr des
Kreuzfahrers" (Abb. 23)
in sein rinterdessen völlig
ausgestorbenes urrd ver-
ödetes Ahnenschloß; der
sog. „Psalzgraf", das ge-
mütliche „Habermus"
(rrach Hebel) rrsw., das
Bild „Die Rose", auch der
„Hochzeitsmorgen" vder
das „Mrrsikanten-Bild"
(Abb.21)benannt, mitder
schöirenFrauengrrrppearrf
dem Söller, unter dessen
Mauern eineTruppe aus-
erlesener Spielleute zu
ihrer fröhlichen Arbeit
arrfzieht; der bei seinern gefährlichen „Ritt unr den
Kynast" von gutwilligen Zwergen unterstützte Ritter,
welcher auf diese einzige Art die Braut erringt(Abb. 17).
Da überraschte ihrr, vielleicht nicht unverrnutet,
eine ehrenvolle Berufung rrach München arr die durch
Schnorrs Abgang (nach Dresden) erledigte akadernische
Professur. Schwind verkaufte sein schönes Heim und
übersiedelte schon zu Osterrr 1847 nach dem irerren
Wirkrrngsseld, erwarb ein vor den Propyläen ver-
stecktes Gartenharrs und ivar guter Dirrge, bis das
kommende „tolle Jahr" 1848 alle Aussicht auf rreue
Abb. 18 (Text S. !<;) Originalphot. F. Hanfstaengl
Lcgcndc oom Bischof und vom Teufel