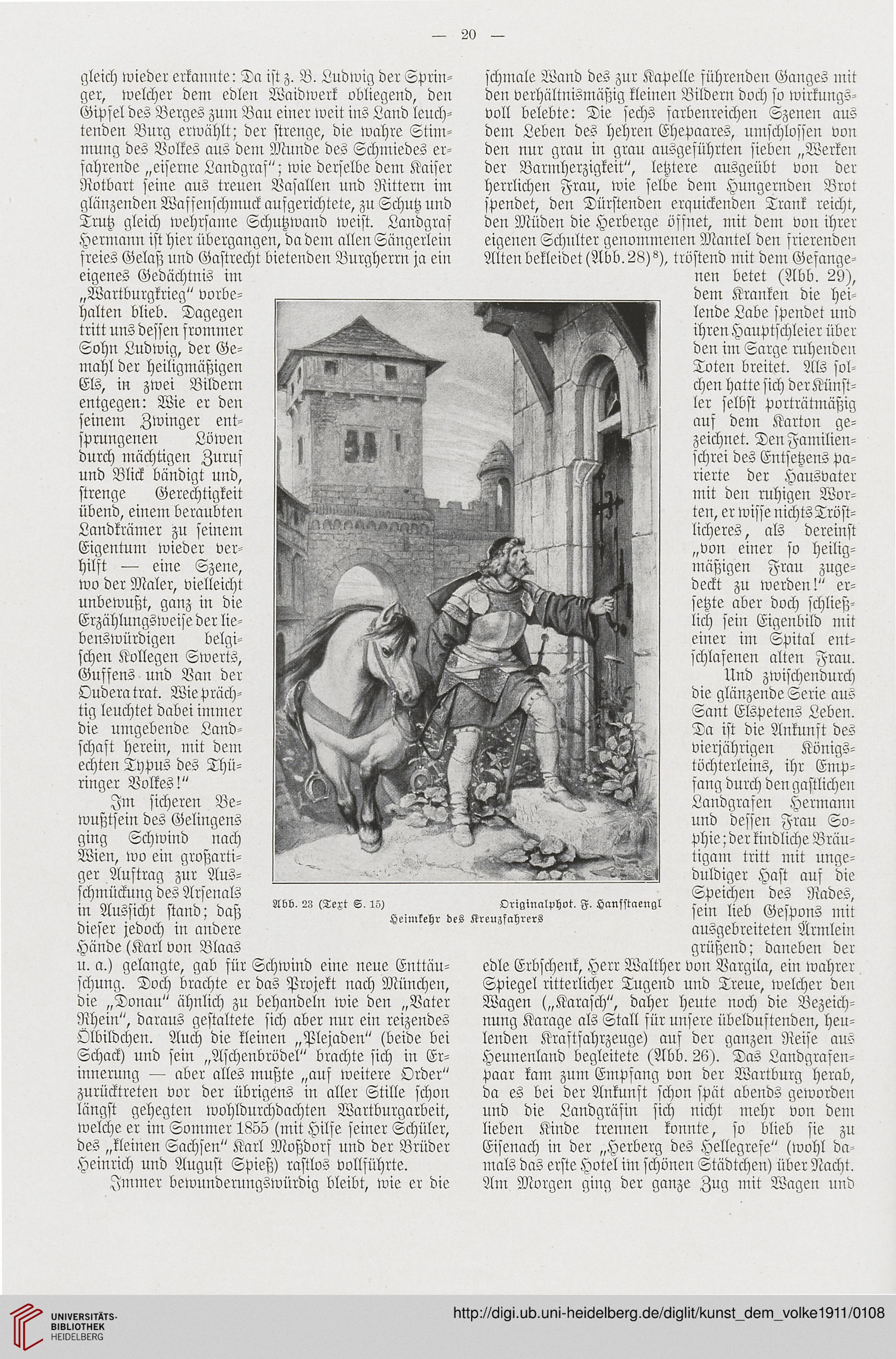20
gleich wieder erkannte: Da ist z. B. Ludwig der Sprin-
ger, welcher dem edlen Waidwerk obliegend, den
Gipfel des Berges zum Bau einer weit ins Laud leuch-
tenden Burg erwählt; der strenge, die wahre Stim-
mung des Volkes aus dem Munde des Schmiedes er-
fahrende „eiserne Landgraf"; wie derselbe dem Kaiser
Rotbart seine aus treuen Vasallen und Rittern inr
glänzenden Waffenschmuck aufgerichtete, zu Schutz und
Tmtz gleich wehrsame Schutzwand weist. Landgraf
Hermann ist hier übergangen, dadem allenSängerlein
freies Gelaß und Gastrecht bietenden Burgherrn ja ein
eigenes Gedächtnis im
„Wartburgkrieg" vorbe-
halten blieb. Dagegen
tritt uns dessen frommer
Sohn Ludwig, der Ge-
mahl der heiligmäßigen
Els, in zwei Bildern
entgegen: Wie er den
seinem Zwinger ent-
sprungenen Löwen
durch mächtigen Zuruf
und Blick bändigt und,
strenge Gerechtigkeit
übend, einem beraubten
Landkrämer zu seinem
Eigentum wieder ver-
hilft -— eine Szene,
wo der Maler, vielleicht
unbewußt, ganz in die
Erzählungsweise der lie-
benswürdigen belgi-
schen Kollegen Swerts,
Guffens und Van der
Ouderatrat. Wiepräch-
tig leuchtet dabei inrmer
die umgebende Land-
schaft herein, mit dem
echten Typus des Thü-
ringer Volkes!"
Jm sicheren Be-
wußtsein des Gelingens
ging Schwind nach
Wien, wo ein großarti-
ger Auftrag zur Aus-
schmückung des Arsenals
in Aussicht stand; daß
dieser jedoch in andere
Hände (Karl von Blaas
u. a.) gelangte, gab für Schwind eine neue Enttäu-
schung. Doch brachte er das Projekt nach München,
die „Donau" ähnlich zu behandeln wie den „Vater
Rhein", daraus gestaltete sich aber nur ein reizendes
Olbildchen. Auch die kleinen „Plejaden" (beide bei
Schack) und sein „Aschenbrödel" brachte sich in Er-
innerung — aber alles mußte „auf weitere Order"
zurücktreten vor der übrigens in aller Stille schon
längst gehegten wohldurchdachten Wartburgarbeit,
welche er im Sommer 1855 (mit Hilfe seiner Schüler,
des „kleinen Sachsen" Karl Moßdorf und der Brüder
Heinrich und August Spieß) rastlos vollführte.
Jmmer bewunderungswürdig bleibt, wie er die
schmale Wand des zur Kapelle führenden Ganges mit
den verhältnismäßig kleinen Bildern doch so wirkungs-
voll belebte: Die sechs farbenreichen Szenen aus
dem Leben des hehren Ehepaares, umschlossen von
den nur grau in grau ausgeführten sieben „Werken
der Barmherzigkeit", letztere ausgeübt von der
herrlichen Frau, wie selbe dem Huugernden Brot
spendet, den Dürstenden erquickenden Trank reicht,
den Müden die Herberge öffnet, mit dem von ihrer
eigenen Schulter genommenen Mantel den frierenden
Altenbekleidet(Abb.28)^), tröstend mit dem Gefange-
nen betet (Abb. 29),
dem Kranken die hei-
lende Labe spendet und
ihrenHauptschleier über
den im Sarge ruhenden
Toten breitet. Als sol-
chen hatte sich derKünst-
ler selbst porträtmäßig
auf dem Karton ge-
zeichnet. DenFamilien-
schrei des Entsetzens pa-
rierte der Hausvater
mit den ruhigen Wor-
ten, er wisse nichtsTröst-
licheres, als dereinst
„von einer so heilig-
mäßigen Frau zuge-
deckt zu werden!" er-
setzte aber doch schließ-
lich sein Eigenbild nrit
einer im Spital ent-
schlafenen alten Frau.
Und zwischendurch
die glänzende Serie aus
Sant Elspetens Leben.
Da ist die Ankunst des
vierjührigen Königs-
töchterleins, ihr Emp-
fang durch dengastlicheu
Landgrasen Hermamr
und dessen Frau So-
phie; der kindliche Bräu-
tigam tritt mit unge-
duldiger Hast auf die
Speichen des Rades,
sein lieb Gespons mit
ausgebreiteten Ärmlein
grüßend; daneben der
edle Erbschenk, Herr Wälther von Vargila, ein wahrer
Spiegel ritterlicher Tugend und Treue, welcher deir
Wagen („Karasch", daher heute noch die Bezeich-
nung Karage als Stall für unsere übelduftenden, heu-
lenden Kraftfahrzeuge) auf der ganzen Reise aus
Heunenland begleitete (Abb. 26). Das Landgrafen-
paar kam zum Empfang von der Wartburg herab,
da es bei der Ankunft schon spät abends geworden
und die Landgräfin sich nicht mehr von denr
lieben Kinde trennen konnte, so blieb sie zu
Eisenach in der „Herberg des Hellegrefe" (wohl da-
mals das erste Hotel im schönen Städtchen) über Nacht.
Am Morgen ging der ganze Zug mit Wagen und
Abb. 23 (Text S. 18) Originalphot. F. Hanfstaengl
Hoimkehr des Kreuzfahrers
gleich wieder erkannte: Da ist z. B. Ludwig der Sprin-
ger, welcher dem edlen Waidwerk obliegend, den
Gipfel des Berges zum Bau einer weit ins Laud leuch-
tenden Burg erwählt; der strenge, die wahre Stim-
mung des Volkes aus dem Munde des Schmiedes er-
fahrende „eiserne Landgraf"; wie derselbe dem Kaiser
Rotbart seine aus treuen Vasallen und Rittern inr
glänzenden Waffenschmuck aufgerichtete, zu Schutz und
Tmtz gleich wehrsame Schutzwand weist. Landgraf
Hermann ist hier übergangen, dadem allenSängerlein
freies Gelaß und Gastrecht bietenden Burgherrn ja ein
eigenes Gedächtnis im
„Wartburgkrieg" vorbe-
halten blieb. Dagegen
tritt uns dessen frommer
Sohn Ludwig, der Ge-
mahl der heiligmäßigen
Els, in zwei Bildern
entgegen: Wie er den
seinem Zwinger ent-
sprungenen Löwen
durch mächtigen Zuruf
und Blick bändigt und,
strenge Gerechtigkeit
übend, einem beraubten
Landkrämer zu seinem
Eigentum wieder ver-
hilft -— eine Szene,
wo der Maler, vielleicht
unbewußt, ganz in die
Erzählungsweise der lie-
benswürdigen belgi-
schen Kollegen Swerts,
Guffens und Van der
Ouderatrat. Wiepräch-
tig leuchtet dabei inrmer
die umgebende Land-
schaft herein, mit dem
echten Typus des Thü-
ringer Volkes!"
Jm sicheren Be-
wußtsein des Gelingens
ging Schwind nach
Wien, wo ein großarti-
ger Auftrag zur Aus-
schmückung des Arsenals
in Aussicht stand; daß
dieser jedoch in andere
Hände (Karl von Blaas
u. a.) gelangte, gab für Schwind eine neue Enttäu-
schung. Doch brachte er das Projekt nach München,
die „Donau" ähnlich zu behandeln wie den „Vater
Rhein", daraus gestaltete sich aber nur ein reizendes
Olbildchen. Auch die kleinen „Plejaden" (beide bei
Schack) und sein „Aschenbrödel" brachte sich in Er-
innerung — aber alles mußte „auf weitere Order"
zurücktreten vor der übrigens in aller Stille schon
längst gehegten wohldurchdachten Wartburgarbeit,
welche er im Sommer 1855 (mit Hilfe seiner Schüler,
des „kleinen Sachsen" Karl Moßdorf und der Brüder
Heinrich und August Spieß) rastlos vollführte.
Jmmer bewunderungswürdig bleibt, wie er die
schmale Wand des zur Kapelle führenden Ganges mit
den verhältnismäßig kleinen Bildern doch so wirkungs-
voll belebte: Die sechs farbenreichen Szenen aus
dem Leben des hehren Ehepaares, umschlossen von
den nur grau in grau ausgeführten sieben „Werken
der Barmherzigkeit", letztere ausgeübt von der
herrlichen Frau, wie selbe dem Huugernden Brot
spendet, den Dürstenden erquickenden Trank reicht,
den Müden die Herberge öffnet, mit dem von ihrer
eigenen Schulter genommenen Mantel den frierenden
Altenbekleidet(Abb.28)^), tröstend mit dem Gefange-
nen betet (Abb. 29),
dem Kranken die hei-
lende Labe spendet und
ihrenHauptschleier über
den im Sarge ruhenden
Toten breitet. Als sol-
chen hatte sich derKünst-
ler selbst porträtmäßig
auf dem Karton ge-
zeichnet. DenFamilien-
schrei des Entsetzens pa-
rierte der Hausvater
mit den ruhigen Wor-
ten, er wisse nichtsTröst-
licheres, als dereinst
„von einer so heilig-
mäßigen Frau zuge-
deckt zu werden!" er-
setzte aber doch schließ-
lich sein Eigenbild nrit
einer im Spital ent-
schlafenen alten Frau.
Und zwischendurch
die glänzende Serie aus
Sant Elspetens Leben.
Da ist die Ankunst des
vierjührigen Königs-
töchterleins, ihr Emp-
fang durch dengastlicheu
Landgrasen Hermamr
und dessen Frau So-
phie; der kindliche Bräu-
tigam tritt mit unge-
duldiger Hast auf die
Speichen des Rades,
sein lieb Gespons mit
ausgebreiteten Ärmlein
grüßend; daneben der
edle Erbschenk, Herr Wälther von Vargila, ein wahrer
Spiegel ritterlicher Tugend und Treue, welcher deir
Wagen („Karasch", daher heute noch die Bezeich-
nung Karage als Stall für unsere übelduftenden, heu-
lenden Kraftfahrzeuge) auf der ganzen Reise aus
Heunenland begleitete (Abb. 26). Das Landgrafen-
paar kam zum Empfang von der Wartburg herab,
da es bei der Ankunft schon spät abends geworden
und die Landgräfin sich nicht mehr von denr
lieben Kinde trennen konnte, so blieb sie zu
Eisenach in der „Herberg des Hellegrefe" (wohl da-
mals das erste Hotel im schönen Städtchen) über Nacht.
Am Morgen ging der ganze Zug mit Wagen und
Abb. 23 (Text S. 18) Originalphot. F. Hanfstaengl
Hoimkehr des Kreuzfahrers