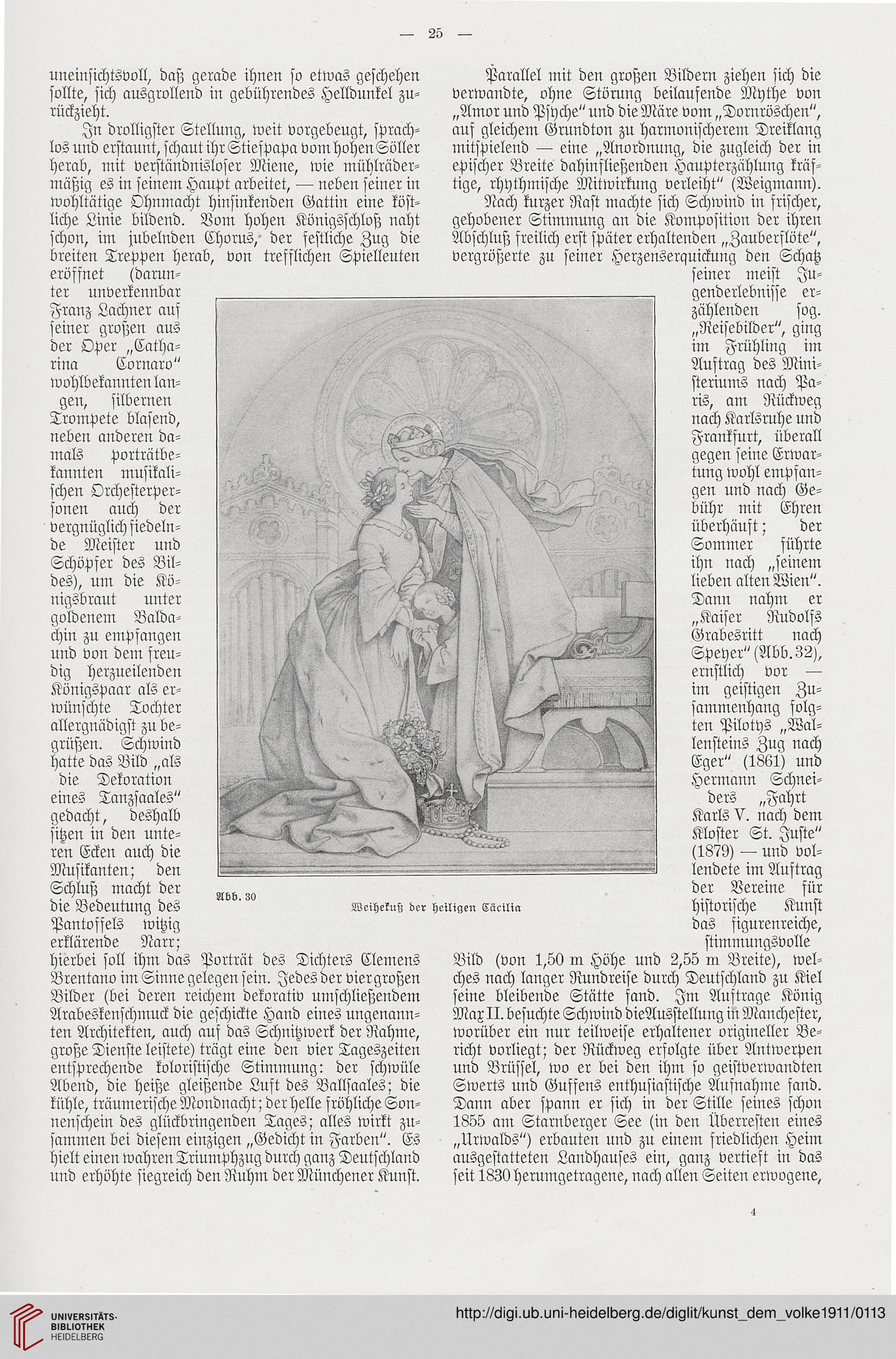25
uneinsichtsvoll, dasz gerade ihnen so etwas geschehen
sollte, sich ausgrollend in gebührendes Helldunkel zu-
rückzieht.
Jn drolligster Stellung, weit vorgebeugt, sprach-
los und erstaunt, schautihrStiefpapa vomhohenSöller
herab, mit verständnisloser Miene, wie mühlräder-
mäßig es in seinem Haupt arbeitet, — neben seiner in
wohltätige Ohnmacht hinsinkenden Gattin eine köst-
liche Linie bildend. Vom hohen Königsschloß naht
schon, im jubelnden Chorus, der festliche Zug die
breiten Treppen herab, von trefflichen Spielleuten
eröffnet (darun-
ter uuverkennbar
Franz Lachner auf
seiner großen aus
der Oper „Catha-
rina Cornaro"
wohlbekanntenlan-
gen, silbernen
Trompete blaseud,
neben anderen da-
mals porträtbe-
kannten musikali-
schen Orchesterper-
sonen auch der
vergnüglichfiedeln-
de Meister und
Schöpfer des Bil-
des), um die Kö-
nigsbraut unter
goldenem Balda-
ck)in zu einpfangen
und von dem freu-
dig herzueilenden
Königspaar als er-
wünschte Tochter
allergnädigst zu be-
grüßen. Schwind
hatte das Bild „als
die Dekoration
eines Tanzsaales"
gedacht, deshalb
sitzen in den unte-
ren Ecken auch die
Musikanten; den
Schluß macht der
die Bedeutung des
Pantoffels witzig
erklärende Narr;
hierbei soll ihm das Porträt des Dichters Clemens
Brentauo imSinne gelegen sein. Jedesder viergroßen
Bilder (bei deren reichem dekorativ umschließeudem
Arabeskenschmuck die geschickte Hand eines ungenann-
ten Architekten, auch auf das Schnitzwerk der Rahme,
große Dienste leistete) trägt eine den vier Tageszeiten
entsprechende koloristische Stimmung: der schwüle
Abend, die heiße gleißende Luft des Ballsaales; die
kühle, träumerische Mondnacht; derhelle fröhliche Son-
nenschein des glückbringenden Tages; alles wirkt zu-
sammen bei diesem einzigen „Gedicht in Farben". Es
hielt einen wahren Triumphzug durch ganz Deutschland
und erhöhte siegreich den Ruhm der Münchener Kunst.
Parallel mit den großen Bildern ziehen sich die
verwandte, ohne Störung beilaufende Mythe von
„Amor und Psyche" und die Märe vom „Dornröschen",
auf gleichem Grundton zu harmonischerem Dreiklang
mitspieleud — eine „Anordnung, die zugleich der in
epischer Breite dahinfließenden Haupterzählung kräf-
tige, rhythmische Mitwirkung verleiht" (Weigmann).
Nach kurzer Rast machte sich Schwind in frischer,
gehobener Stimmung an die Komposition der ihren
Abschluß freilich erst später erhaltenden „Zauberflöte",
vergrößerte zu seiner Herzenserquickung den Schatz
seiner meist Ju-
genderlebnisse er-
zählenden sog.
„Reiselülder", ging
im Frühling im
Auftrag des Mini-
steriums nach Pa-
ris, am Rückweg
nach Karlsruhe und
Frankfurt, überall
gegen seine Erwar-
tung wohl empfan-
gen und nach Ge-
bühr mit Ehren
überhäuft; der
Sommer führte
ihn nach „seinem
lieben altenWien".
Dann nahm er
„Kaiser Rudolfs
Grabesritt nach
Speyer" (Abb.32),
ernstlich vor —
im geistigen Zu-
sammenhang folg-
ten Pilotys „Wal-
lensteins Zug nach
Eger" (1861) und
Hermann Schnei-
ders „Fahrt
Karls V. nach dem
Kloster St. Juste"
(1879) — und vol-
lendete im Auftrag
der Vereine für
historische Kunst
das figurenreiche,
stimmungsvolle
Bild (von 1,50 m Höhe und 2,55 in Breite), wel-
ches nach langer Rundreise durch Deutschland zu Kiel
seine bleibende Stätte faud. Jm Auftrage König
Maxll. besuchte Schwind dieAusstellung in Manchester,
worüber ein uur teilweise erhaltener origiueller Be-
richt vorliegt; der Rückweg erfolgte über Autwerpen
und Brüssel, wo er bei den ihm so geistverwandten
Swerts und Guffens enthusiastische Aufnahme fand.
Dann aber spann er sich in der Stille seines schon
1855 am Starnberger See (in den Überresten eines
„Urwalds") erbauten und zu einem friedlichen Heim
ausgestatteten Landhauses eiu, ganz vertieft in das
seit 1830herumgetragene, nach allen Seiten erwogene,
4
uneinsichtsvoll, dasz gerade ihnen so etwas geschehen
sollte, sich ausgrollend in gebührendes Helldunkel zu-
rückzieht.
Jn drolligster Stellung, weit vorgebeugt, sprach-
los und erstaunt, schautihrStiefpapa vomhohenSöller
herab, mit verständnisloser Miene, wie mühlräder-
mäßig es in seinem Haupt arbeitet, — neben seiner in
wohltätige Ohnmacht hinsinkenden Gattin eine köst-
liche Linie bildend. Vom hohen Königsschloß naht
schon, im jubelnden Chorus, der festliche Zug die
breiten Treppen herab, von trefflichen Spielleuten
eröffnet (darun-
ter uuverkennbar
Franz Lachner auf
seiner großen aus
der Oper „Catha-
rina Cornaro"
wohlbekanntenlan-
gen, silbernen
Trompete blaseud,
neben anderen da-
mals porträtbe-
kannten musikali-
schen Orchesterper-
sonen auch der
vergnüglichfiedeln-
de Meister und
Schöpfer des Bil-
des), um die Kö-
nigsbraut unter
goldenem Balda-
ck)in zu einpfangen
und von dem freu-
dig herzueilenden
Königspaar als er-
wünschte Tochter
allergnädigst zu be-
grüßen. Schwind
hatte das Bild „als
die Dekoration
eines Tanzsaales"
gedacht, deshalb
sitzen in den unte-
ren Ecken auch die
Musikanten; den
Schluß macht der
die Bedeutung des
Pantoffels witzig
erklärende Narr;
hierbei soll ihm das Porträt des Dichters Clemens
Brentauo imSinne gelegen sein. Jedesder viergroßen
Bilder (bei deren reichem dekorativ umschließeudem
Arabeskenschmuck die geschickte Hand eines ungenann-
ten Architekten, auch auf das Schnitzwerk der Rahme,
große Dienste leistete) trägt eine den vier Tageszeiten
entsprechende koloristische Stimmung: der schwüle
Abend, die heiße gleißende Luft des Ballsaales; die
kühle, träumerische Mondnacht; derhelle fröhliche Son-
nenschein des glückbringenden Tages; alles wirkt zu-
sammen bei diesem einzigen „Gedicht in Farben". Es
hielt einen wahren Triumphzug durch ganz Deutschland
und erhöhte siegreich den Ruhm der Münchener Kunst.
Parallel mit den großen Bildern ziehen sich die
verwandte, ohne Störung beilaufende Mythe von
„Amor und Psyche" und die Märe vom „Dornröschen",
auf gleichem Grundton zu harmonischerem Dreiklang
mitspieleud — eine „Anordnung, die zugleich der in
epischer Breite dahinfließenden Haupterzählung kräf-
tige, rhythmische Mitwirkung verleiht" (Weigmann).
Nach kurzer Rast machte sich Schwind in frischer,
gehobener Stimmung an die Komposition der ihren
Abschluß freilich erst später erhaltenden „Zauberflöte",
vergrößerte zu seiner Herzenserquickung den Schatz
seiner meist Ju-
genderlebnisse er-
zählenden sog.
„Reiselülder", ging
im Frühling im
Auftrag des Mini-
steriums nach Pa-
ris, am Rückweg
nach Karlsruhe und
Frankfurt, überall
gegen seine Erwar-
tung wohl empfan-
gen und nach Ge-
bühr mit Ehren
überhäuft; der
Sommer führte
ihn nach „seinem
lieben altenWien".
Dann nahm er
„Kaiser Rudolfs
Grabesritt nach
Speyer" (Abb.32),
ernstlich vor —
im geistigen Zu-
sammenhang folg-
ten Pilotys „Wal-
lensteins Zug nach
Eger" (1861) und
Hermann Schnei-
ders „Fahrt
Karls V. nach dem
Kloster St. Juste"
(1879) — und vol-
lendete im Auftrag
der Vereine für
historische Kunst
das figurenreiche,
stimmungsvolle
Bild (von 1,50 m Höhe und 2,55 in Breite), wel-
ches nach langer Rundreise durch Deutschland zu Kiel
seine bleibende Stätte faud. Jm Auftrage König
Maxll. besuchte Schwind dieAusstellung in Manchester,
worüber ein uur teilweise erhaltener origiueller Be-
richt vorliegt; der Rückweg erfolgte über Autwerpen
und Brüssel, wo er bei den ihm so geistverwandten
Swerts und Guffens enthusiastische Aufnahme fand.
Dann aber spann er sich in der Stille seines schon
1855 am Starnberger See (in den Überresten eines
„Urwalds") erbauten und zu einem friedlichen Heim
ausgestatteten Landhauses eiu, ganz vertieft in das
seit 1830herumgetragene, nach allen Seiten erwogene,
4