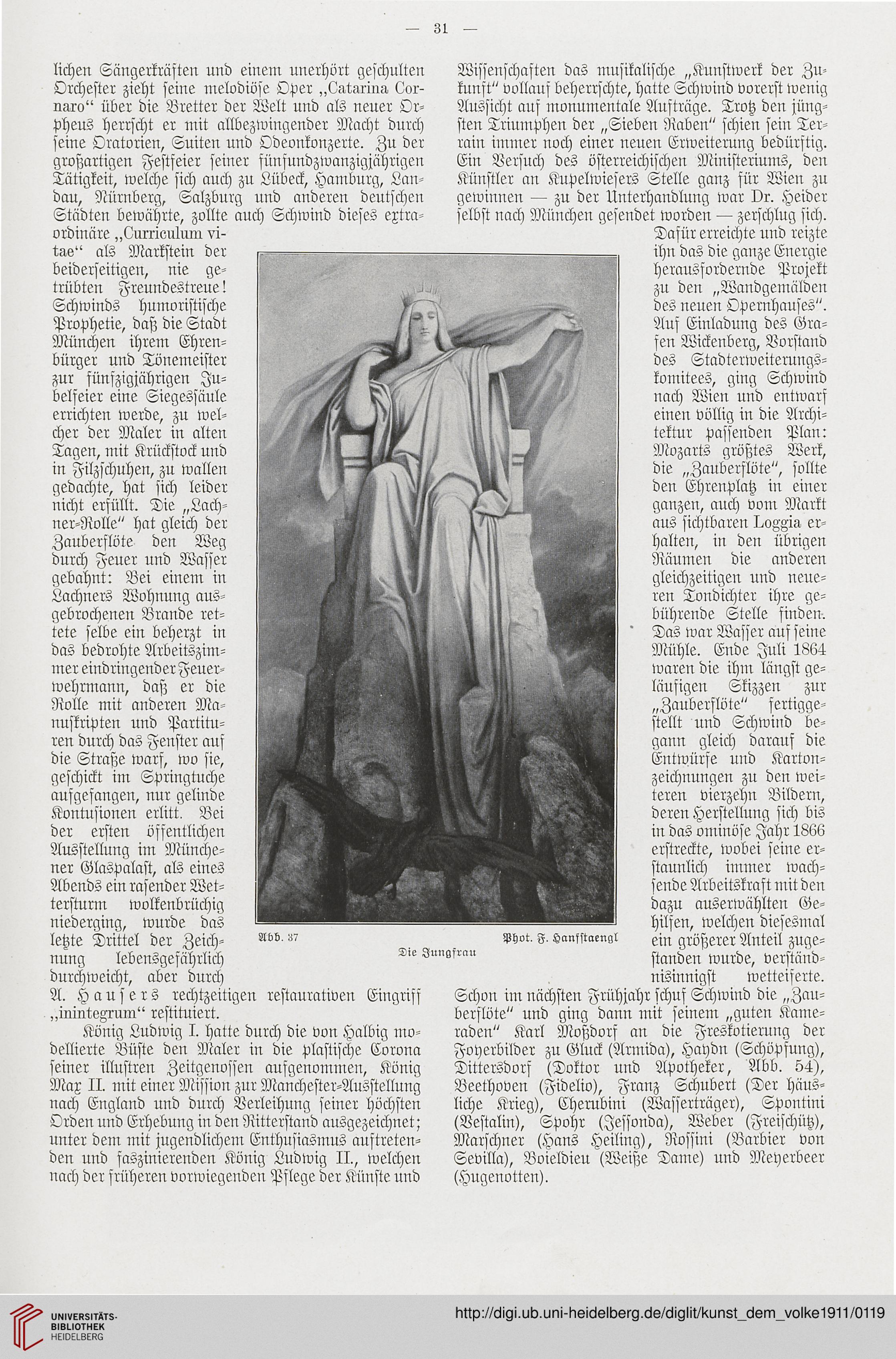lichen Sängerkräften und einem unerhört geschulten
Orchester zieht seine melodiöse Oper „Ontariim Oor-
nnro" über die Bretter der Welt und als neuer Or-
pheus herrscht er mit allbezwingender Macht durch
seine Oratorien, Suiten und Odeonkonzerte. Zu der
großartigen Festfeier seiner sünfundzwanzigjährigen
Tätigkeih welche sich auch zu Lübeck, Hamburg, Lan-
dau, Nürnberg, Salzburg und anderen deutschen
Städten bewährte, zollte auch Schwind dieses extra-
ordinäre „Ourrieniuin vi-
tuo" als Markstein der
beiderseitigen, nie ge-
trübten Freundestreue!
Schwinds humoristische
Prophetie, daß die Stadt
München ihrem Ehren-
bürger und Tönemeister
zur fünfzigjährigen Ju-
belfeier eine Siegessäule
errichten werde, zu wel-
cher der Maler in alten
Tagen, mit Krückstock und
in Filzschuhen, zu wallen
gedachte, hat sich leider
nicht erfüllt. Die „Lach-
ner-Rolle" hat gleich der
Zauberflöte den Weg
durch Feuer und Wasser
gebahnt: Bei einem in
Lachners Wohnung aus-
gebrochenen Brande ret-
tete selbe ein beherzt in
das bedrohte Arbeitszim-
mer eindringenderFeuer-
wehrmann, daß er die
Rolle mit anderen Ma-
nuskripten und Partitu-
ren durch das Fenster auf
die Straße warf, wo sie,
geschickt im Springtuche
aufgefangen, nur gelinde
Kontusionen erlitt. Bei
der ersten öffentlichen
Ausstellung im Münche-
ner Glaspalast, als eines
Abends einrasender Wet-
tersturm wolkenbrüchig
niederging, wurde das
letzte Drittel der Zeich-
nung lebensgefährlich
durchweicht, aber durch
A. Hausers rechtzeitigen restaurativen Eingriff
„inintoAruin" restituiert.
König Ludwig I. hatte durch die von Halbig mo-
dellierte Büste den Maler in die plastische Corona
seiner illustren Zeitgenossen aufgenommen, König
Max II. mit einer Mission zur Manchester-Ausstellung
nach England und durch Verleihung seiner höchsten
Orden und Erhebung in den Ritterstand ausgezeichnet;
unter dem mit jugendlichem Enthusiasmus auftreten-
den und faszinierenden König Ludwig II., welchen
nach der früheren vorwiegenden Pflege der Künste und
Wissenschaften das musikalische „Kunstwerk der Zu-
kunft" vollauf beherrschte, hatte Schwind vorerst wenig
Aussicht auf monumentale Aufträge. Trotz den jüng-
sten Triumphen der „Sieben Raben" schien sein Ter-
rain immer noch einer neuen Erweiterung bedürftig.
Ein Versuch des österreichischen Ministeriums, den
Künstler an Kupelwiesers Stelle ganz sür Wien zu
gewinnen — zu der Unterhandlung war Or. Heider
selbst nach München gesendet worden — zerschlug sich.
Dafür erreichte und reizte
ihn das die ganze Energie
herausfordernde Projekt
zu den „Wandgemälden
des neuen Opernhauses".
Auf Einladung des Gra-
fen Wickenberg, Vorstand
des Stadterweiterungs-
komitees, ging Schwind
nach Wien und entwarf
einen völlig in die Archi-
tektur passenden Plan:
Mozarts größtes Werk,
die „Zauberflöte", sollte
den Ehrenplatz in einer
ganzen, auch vom Markt
aus sichtbaren I-oMa er-
halten, in den übrigen
Räumen die anderen
gleichzeitigen und neue-
ren Tondichter ihre ge-
bührende Stelle finden.
Das war Wasser auf seine
Mühle. Ende Juli 1864
waren die ihm längst ge-
läufigen Skizzen zur
„Zauberflöte" fertigge-
stellt und Schwind be-
gann gleich darauf die
Entwürfe und Karton-
zeichnungen zu den wei-
teren vierzehn Bildern,
deren Herstellung sich bis
in das ominöse Jahr 1866
erstreckte, wobei seine er-
staunlich immer wach-
sende Arbeitskraft mit den
dazu auserwählten Ge-
hilfen, welchen diesesmal
ein größerer Anteil zuge-
standen wurde, verständ-
nisinnigst wetteiferte.
Schon im nächsten Frühjahr schuf Schwind die „Zau-
berflöte" und ging dann mit seinem „guten Kame-
raden" Karl Moßdorf an die Freskotierung der
Foyerbilder zu Gluck (Armida), Haydn (Schöpfung),
Dittersdorf (Doktor und Apotheker, Abb. 54),
Beethoven (Fidelio), Franz Schubert (Der häus-
liche Krieg), Cherubini (Wasserträger), Spontini
(Vestalin), Spohr (Jessonda), Weber (Freischütz),
Marschner (Hans Heiling), Rossini (Barbier von
Sevilla), Boieldieu (Weiße Dame) und Meyerbeer
(Hugenotten).
Abb. 87 Phot. F. Hansstaengl
Die Jungsrau
Orchester zieht seine melodiöse Oper „Ontariim Oor-
nnro" über die Bretter der Welt und als neuer Or-
pheus herrscht er mit allbezwingender Macht durch
seine Oratorien, Suiten und Odeonkonzerte. Zu der
großartigen Festfeier seiner sünfundzwanzigjährigen
Tätigkeih welche sich auch zu Lübeck, Hamburg, Lan-
dau, Nürnberg, Salzburg und anderen deutschen
Städten bewährte, zollte auch Schwind dieses extra-
ordinäre „Ourrieniuin vi-
tuo" als Markstein der
beiderseitigen, nie ge-
trübten Freundestreue!
Schwinds humoristische
Prophetie, daß die Stadt
München ihrem Ehren-
bürger und Tönemeister
zur fünfzigjährigen Ju-
belfeier eine Siegessäule
errichten werde, zu wel-
cher der Maler in alten
Tagen, mit Krückstock und
in Filzschuhen, zu wallen
gedachte, hat sich leider
nicht erfüllt. Die „Lach-
ner-Rolle" hat gleich der
Zauberflöte den Weg
durch Feuer und Wasser
gebahnt: Bei einem in
Lachners Wohnung aus-
gebrochenen Brande ret-
tete selbe ein beherzt in
das bedrohte Arbeitszim-
mer eindringenderFeuer-
wehrmann, daß er die
Rolle mit anderen Ma-
nuskripten und Partitu-
ren durch das Fenster auf
die Straße warf, wo sie,
geschickt im Springtuche
aufgefangen, nur gelinde
Kontusionen erlitt. Bei
der ersten öffentlichen
Ausstellung im Münche-
ner Glaspalast, als eines
Abends einrasender Wet-
tersturm wolkenbrüchig
niederging, wurde das
letzte Drittel der Zeich-
nung lebensgefährlich
durchweicht, aber durch
A. Hausers rechtzeitigen restaurativen Eingriff
„inintoAruin" restituiert.
König Ludwig I. hatte durch die von Halbig mo-
dellierte Büste den Maler in die plastische Corona
seiner illustren Zeitgenossen aufgenommen, König
Max II. mit einer Mission zur Manchester-Ausstellung
nach England und durch Verleihung seiner höchsten
Orden und Erhebung in den Ritterstand ausgezeichnet;
unter dem mit jugendlichem Enthusiasmus auftreten-
den und faszinierenden König Ludwig II., welchen
nach der früheren vorwiegenden Pflege der Künste und
Wissenschaften das musikalische „Kunstwerk der Zu-
kunft" vollauf beherrschte, hatte Schwind vorerst wenig
Aussicht auf monumentale Aufträge. Trotz den jüng-
sten Triumphen der „Sieben Raben" schien sein Ter-
rain immer noch einer neuen Erweiterung bedürftig.
Ein Versuch des österreichischen Ministeriums, den
Künstler an Kupelwiesers Stelle ganz sür Wien zu
gewinnen — zu der Unterhandlung war Or. Heider
selbst nach München gesendet worden — zerschlug sich.
Dafür erreichte und reizte
ihn das die ganze Energie
herausfordernde Projekt
zu den „Wandgemälden
des neuen Opernhauses".
Auf Einladung des Gra-
fen Wickenberg, Vorstand
des Stadterweiterungs-
komitees, ging Schwind
nach Wien und entwarf
einen völlig in die Archi-
tektur passenden Plan:
Mozarts größtes Werk,
die „Zauberflöte", sollte
den Ehrenplatz in einer
ganzen, auch vom Markt
aus sichtbaren I-oMa er-
halten, in den übrigen
Räumen die anderen
gleichzeitigen und neue-
ren Tondichter ihre ge-
bührende Stelle finden.
Das war Wasser auf seine
Mühle. Ende Juli 1864
waren die ihm längst ge-
läufigen Skizzen zur
„Zauberflöte" fertigge-
stellt und Schwind be-
gann gleich darauf die
Entwürfe und Karton-
zeichnungen zu den wei-
teren vierzehn Bildern,
deren Herstellung sich bis
in das ominöse Jahr 1866
erstreckte, wobei seine er-
staunlich immer wach-
sende Arbeitskraft mit den
dazu auserwählten Ge-
hilfen, welchen diesesmal
ein größerer Anteil zuge-
standen wurde, verständ-
nisinnigst wetteiferte.
Schon im nächsten Frühjahr schuf Schwind die „Zau-
berflöte" und ging dann mit seinem „guten Kame-
raden" Karl Moßdorf an die Freskotierung der
Foyerbilder zu Gluck (Armida), Haydn (Schöpfung),
Dittersdorf (Doktor und Apotheker, Abb. 54),
Beethoven (Fidelio), Franz Schubert (Der häus-
liche Krieg), Cherubini (Wasserträger), Spontini
(Vestalin), Spohr (Jessonda), Weber (Freischütz),
Marschner (Hans Heiling), Rossini (Barbier von
Sevilla), Boieldieu (Weiße Dame) und Meyerbeer
(Hugenotten).
Abb. 87 Phot. F. Hansstaengl
Die Jungsrau