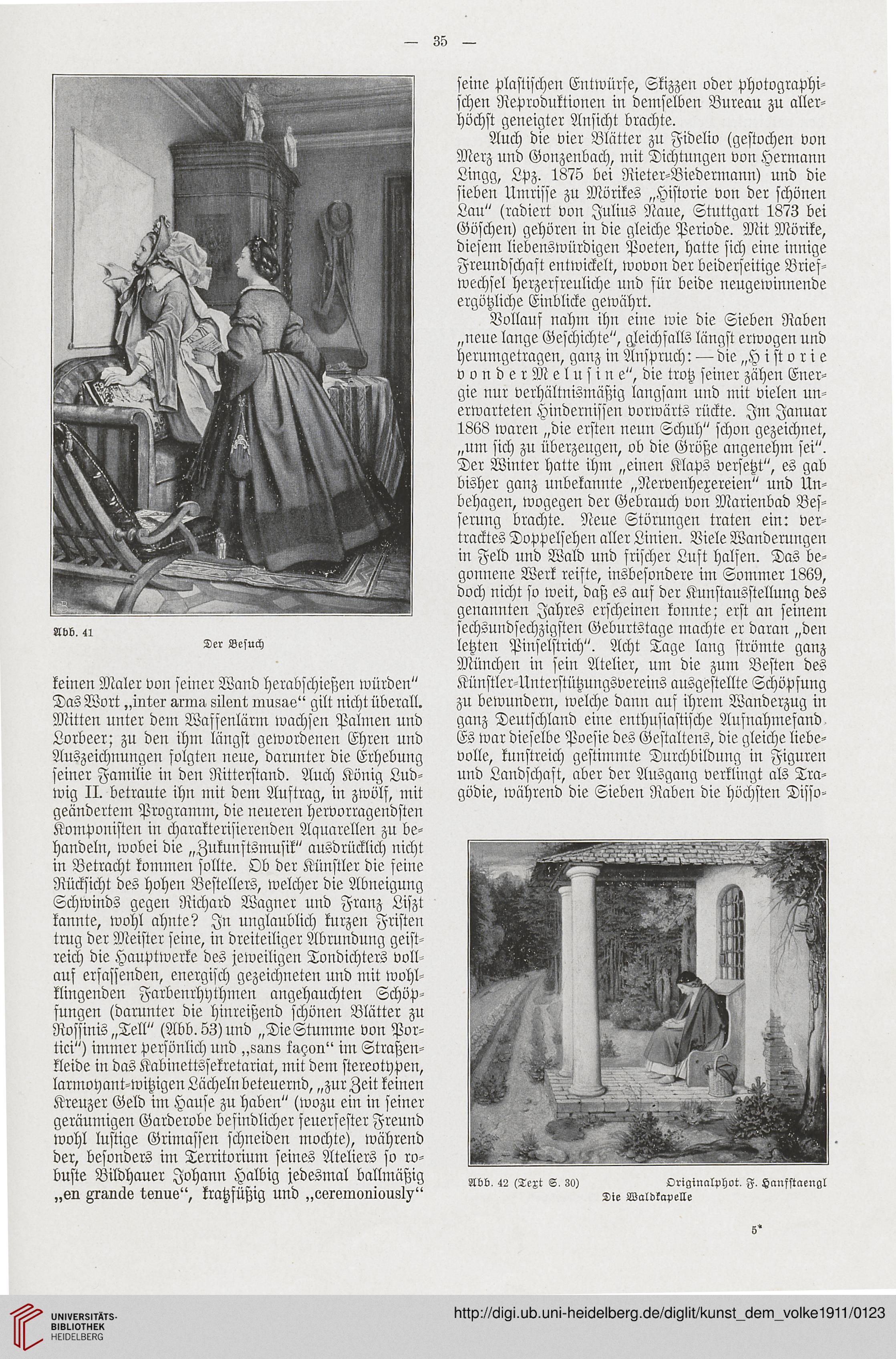35
keinen Maler von seiner Wand herabschießen würden"
DasWort „inter arina, silent inusae" gilt nichtüberall.
Mitten unter dem Waffenlärm wachsen Palmen und
Lorbeer; zu den ihm längst gewordenen Ehren und
Auszeichnungen folgten neue, darunter die Erhebung
seiner Familie in den Ritterstand. Auch König Lud-
wig II. betraute ihn mit dem Auftrag, in zwölf, mit
geändertem Programm, die neueren hervorragendsten
Komponisten in charakterisierenden Aquarellen zu be-
handeln, wobei die „Zukunftsmusik" ausdrücklich nicht
in Betracht kommen sollte. Ob der Künstler die feiue
Rücksicht des hohen Bestellers, welcher die Abneigung
Schwinds gegen Richard Waguer und Franz Liszt
kannte, wohl ahnte? Jn unglaublich kurzen Fristen
tmg der Meister seine, in dreiteiliger Abrundung geist-
reich die Hauptwerke des jeweiligen Toudichters voll-
auf erfassenden, energisch gezeichneten uud mit wohl-
klingenden Farbenrhythmen angehauchten Schöp-
fungen (darunter die hiureißend schönen Blätter zu
Rossinis „Tell" (Abb.5Z)und „DieStumme von Por-
tici") immer persönlich und „saus kayou" im Straßeu-
kleide in das Kabinettssekretariat, mit dem stereotypen,
larmoyant-witzigen Lächelnbeteuernd, „zurZeit keineu
Kreuzer Geld im Hause zu haben" (wozu ein iu seiner
geräumigen Garderobe besindlicher feuerfester Freund
wohl lustige Grimassen schneideu mochte), währeud
der, besonders im Territorium seines Ateliers so ro-
buste Bildhauer Johann Halbig jedesmal ballmäßig
„6u Zraucke teuue", kratzsüßig und „eervinouiou^iv"
seine plaflischen Entwürfe, Skizzen oder photographi-
schen Reproduktionen in demselben Bureau zu aller-
höchst geneigter Ansicht brachte.
Auch die vier Blätter zu Fidelio (gestochen vou
Merz und Gonzenbach, mit Dichtungen von Hermann
Lingg, Lpz. 1875 bei Rieter-Biedermann) und die
sieben Umrisse zu Mörikes „Historie von der schönen
Lau" (radiert von Julius Naue, Stuttgart 1873 bei
Göschen) gehören in die gleiche Periode. Mit Mörike,
diesem liebenswürdigen Poeten, hatte sich eine innige
Freundschaft entwickelt, wovon der beiderseitige Brief-
wechsel herzerfreuliche und für beide neugewinnende
ergötzliche Einblicke gewährt.
Vollauf nahm ihn eine wie die Sieben Raben
„neue lange Geschichte", gleichfalls längst erwogen und
herumgetragen, ganz in Anspruch: — die „Historie
vonderMelusin e", die trotz seiner zähen Ener-
gie nur verhältnismäßig langsam und mit vieleu un-
erwarteteu Hindernissen vorwärts rückte. Jm Januar
1868 waren „die ersten neun Schuh" schon gezeichnet,
„um sich zu überzeugen, ob die Größe angenehm sei".
Der Winter hatte ihm „einen Klaps versetzt", es gab
bisher ganz unbekannte „Nervenhexereieu" und Un-
behagen, wogegen der Gebrauch von Marienbad Bes-
serung brachte. Neue Störuugen traten eiu: ver-
tracktes Doppelsehen aller Linien. Viele Wanderungen
iu Feld und Wald und frischer Luft halfen. Das be-
gonnene Werk reifte, insbesondere im Sommer 1869,
doch nicht so weit, daß es auf der Kunstausstellung des
genannten Jahres erscheinen konnte; erst an seinem
sechsundsechzigsten Geburtstage machte er daran „den
letzten Pinselstrich". Acht Tage lang strömte gauz
München in sein Atelier, um die zum Besten des
Künstler-Unterstützungsvereins ausgestellte Schöpfung
zu bewundern, welche daun auf ihrem Wauderzug in
ganz Deutschland eine enthusiastische Aufnahmefand
Es war dieselbe Poesie des Gestaltens, die gleiche liebe-
volle, kunstreich gestimmte Durchbildung in Figuren
und Landschaft, aber der Ausgang verklingt als Tra-
gödie, während die Sieben Raben die höchsten Disso-
Abb. 42 lText S. 30) Originalphot. F. Hanfstaengl
Die Waldkapells
S'
keinen Maler von seiner Wand herabschießen würden"
DasWort „inter arina, silent inusae" gilt nichtüberall.
Mitten unter dem Waffenlärm wachsen Palmen und
Lorbeer; zu den ihm längst gewordenen Ehren und
Auszeichnungen folgten neue, darunter die Erhebung
seiner Familie in den Ritterstand. Auch König Lud-
wig II. betraute ihn mit dem Auftrag, in zwölf, mit
geändertem Programm, die neueren hervorragendsten
Komponisten in charakterisierenden Aquarellen zu be-
handeln, wobei die „Zukunftsmusik" ausdrücklich nicht
in Betracht kommen sollte. Ob der Künstler die feiue
Rücksicht des hohen Bestellers, welcher die Abneigung
Schwinds gegen Richard Waguer und Franz Liszt
kannte, wohl ahnte? Jn unglaublich kurzen Fristen
tmg der Meister seine, in dreiteiliger Abrundung geist-
reich die Hauptwerke des jeweiligen Toudichters voll-
auf erfassenden, energisch gezeichneten uud mit wohl-
klingenden Farbenrhythmen angehauchten Schöp-
fungen (darunter die hiureißend schönen Blätter zu
Rossinis „Tell" (Abb.5Z)und „DieStumme von Por-
tici") immer persönlich und „saus kayou" im Straßeu-
kleide in das Kabinettssekretariat, mit dem stereotypen,
larmoyant-witzigen Lächelnbeteuernd, „zurZeit keineu
Kreuzer Geld im Hause zu haben" (wozu ein iu seiner
geräumigen Garderobe besindlicher feuerfester Freund
wohl lustige Grimassen schneideu mochte), währeud
der, besonders im Territorium seines Ateliers so ro-
buste Bildhauer Johann Halbig jedesmal ballmäßig
„6u Zraucke teuue", kratzsüßig und „eervinouiou^iv"
seine plaflischen Entwürfe, Skizzen oder photographi-
schen Reproduktionen in demselben Bureau zu aller-
höchst geneigter Ansicht brachte.
Auch die vier Blätter zu Fidelio (gestochen vou
Merz und Gonzenbach, mit Dichtungen von Hermann
Lingg, Lpz. 1875 bei Rieter-Biedermann) und die
sieben Umrisse zu Mörikes „Historie von der schönen
Lau" (radiert von Julius Naue, Stuttgart 1873 bei
Göschen) gehören in die gleiche Periode. Mit Mörike,
diesem liebenswürdigen Poeten, hatte sich eine innige
Freundschaft entwickelt, wovon der beiderseitige Brief-
wechsel herzerfreuliche und für beide neugewinnende
ergötzliche Einblicke gewährt.
Vollauf nahm ihn eine wie die Sieben Raben
„neue lange Geschichte", gleichfalls längst erwogen und
herumgetragen, ganz in Anspruch: — die „Historie
vonderMelusin e", die trotz seiner zähen Ener-
gie nur verhältnismäßig langsam und mit vieleu un-
erwarteteu Hindernissen vorwärts rückte. Jm Januar
1868 waren „die ersten neun Schuh" schon gezeichnet,
„um sich zu überzeugen, ob die Größe angenehm sei".
Der Winter hatte ihm „einen Klaps versetzt", es gab
bisher ganz unbekannte „Nervenhexereieu" und Un-
behagen, wogegen der Gebrauch von Marienbad Bes-
serung brachte. Neue Störuugen traten eiu: ver-
tracktes Doppelsehen aller Linien. Viele Wanderungen
iu Feld und Wald und frischer Luft halfen. Das be-
gonnene Werk reifte, insbesondere im Sommer 1869,
doch nicht so weit, daß es auf der Kunstausstellung des
genannten Jahres erscheinen konnte; erst an seinem
sechsundsechzigsten Geburtstage machte er daran „den
letzten Pinselstrich". Acht Tage lang strömte gauz
München in sein Atelier, um die zum Besten des
Künstler-Unterstützungsvereins ausgestellte Schöpfung
zu bewundern, welche daun auf ihrem Wauderzug in
ganz Deutschland eine enthusiastische Aufnahmefand
Es war dieselbe Poesie des Gestaltens, die gleiche liebe-
volle, kunstreich gestimmte Durchbildung in Figuren
und Landschaft, aber der Ausgang verklingt als Tra-
gödie, während die Sieben Raben die höchsten Disso-
Abb. 42 lText S. 30) Originalphot. F. Hanfstaengl
Die Waldkapells
S'