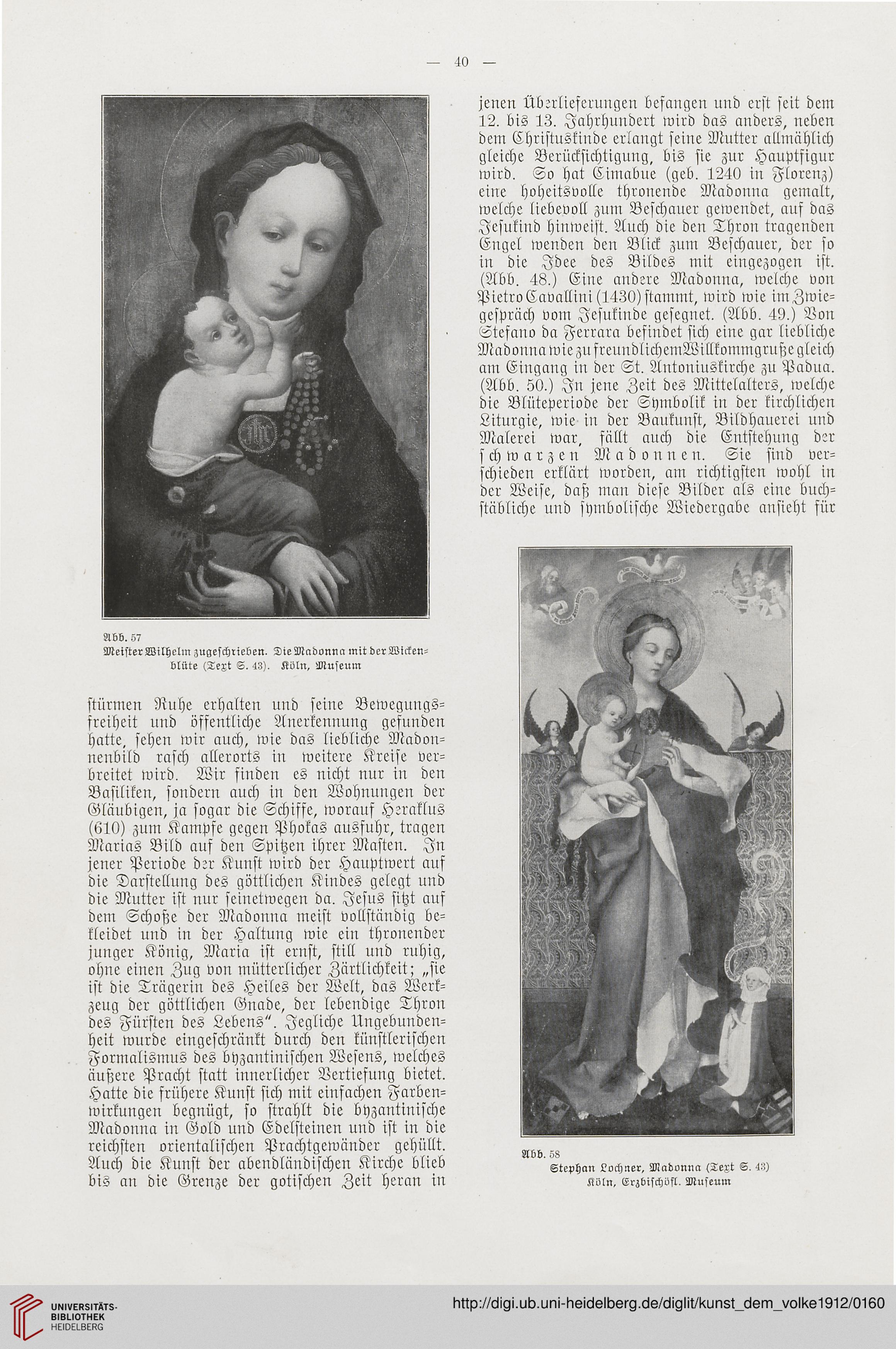40
Abb. 57
MeisterWilhelm zugeschrieben. DieMndonnn mitdcrWicken-
blüte (Text S. 4S>. Köln, Museum
stürmen Nuhe erhalten und seiile Bewegungs-
freiheit und öffentliche Anerkennung gefunden
hatte, sehen wir auch, wie das liebliche Madon-
nenbild rasch allerorts in weitere Kreise ver-
breitet wird. Wir finden es nicht nur in den
Basiliken, sondern auch in den Wohnungen der
Gläubigen, ja sogar die Schiffe, worauf Heraklus
(610) zum Kampfe gegen Phokas ausfuhr, tragen
Marias Bild auf den Spitzen ihrer Masten. Jn
jener Periode der Kunst wird der Hauptwert auf
die Darstellung des göttlichen Kindes gelegt und
die Mutter ist nur seinetwegen da. Jesus sitzt auf
dem Schoße der Madonna meist vollständig be-
kleidet und in der Haltung wie ein thronender
junger König, Maria ist ernst, still und ruhig,
ohne einen Zug von mütterlicher Zärtlichkeit; „sie
ist die Trägerin des Heiles der Welt, das Werk-
zeug der göttlichen Gnade, der lebendige Thron
des Fürsten des Lebens". Jegliche Ungebunden-
heit wurde eingeschränkt durch den künstlerischen
Formalismus des byzantinischen Wesens, welches
äußere Pracht statt innerlicher Vertiefung bietet.
Hatte die frühere Kunst sich mit einfachen Farben-
wirkungen begnügt, so strahlt die byzantinische
Madonna in Gold und Edelsteinen und ist in die
reichsten orientalischen Prachtgewänder gehüllt.
Auch die Kunst der abendländischen Kirche blieb
bis an die Grenze der gotischen Zeit heran in
jenen Überlieferungen befangen und erst seit dem
12. bis 13. Jahrhundert wird das anders, neben
dem Christuskinde erlangt seine Mutter allmählich
gleiche Berücksichtigung. bis sie zur Hauptfigur
wird. So hat Cimabue (geb. 1240 in Florenz)
eine hoheitsvolle thronende Madonna gemalt,
welche liebevoll zum Beschauer gewendet, auf das
Jesukind hinweist. Auch die den Thron tragenden
Engel wenden den Blick zum Beschauer, der so
in die Jdee des Bildes mit eingezogen ist.
(Abb. 48.) Eine andere Madonna, welche von
PietroCavallini (1430)stammt, wird wie imZwie-
gespräch vom Jesukinde gesegnet. (Abb. 49.) Von
Stefano da Ferrara befindet sich eine gar liebliche
MadonnawiezufreundlichemWillkommgrußegleich
am Eingang in der St. Antoniuskirche zu Padua.
(Abb. 50.) Jn jene Zeit des Mittelalters, welche
die Blüteperiode der Symbolik in der kirchlichen
Liturgie, wie in der Baukunst, Bildhauerei und
Malerei war, fällt auch die Entstehung der
schwarzen Madonnen. Sie sind ver-
schieden erklärt worden, am richtigsten wohl in
der Weise, daß man diese Bilder als eine buch-
stäbliche und symbolische Wiedergabe ansieht für
Abb.58
Stephan Lochnor, Madonna (Text S. 48)
Küln, Erzbischöfl. Museum
Abb. 57
MeisterWilhelm zugeschrieben. DieMndonnn mitdcrWicken-
blüte (Text S. 4S>. Köln, Museum
stürmen Nuhe erhalten und seiile Bewegungs-
freiheit und öffentliche Anerkennung gefunden
hatte, sehen wir auch, wie das liebliche Madon-
nenbild rasch allerorts in weitere Kreise ver-
breitet wird. Wir finden es nicht nur in den
Basiliken, sondern auch in den Wohnungen der
Gläubigen, ja sogar die Schiffe, worauf Heraklus
(610) zum Kampfe gegen Phokas ausfuhr, tragen
Marias Bild auf den Spitzen ihrer Masten. Jn
jener Periode der Kunst wird der Hauptwert auf
die Darstellung des göttlichen Kindes gelegt und
die Mutter ist nur seinetwegen da. Jesus sitzt auf
dem Schoße der Madonna meist vollständig be-
kleidet und in der Haltung wie ein thronender
junger König, Maria ist ernst, still und ruhig,
ohne einen Zug von mütterlicher Zärtlichkeit; „sie
ist die Trägerin des Heiles der Welt, das Werk-
zeug der göttlichen Gnade, der lebendige Thron
des Fürsten des Lebens". Jegliche Ungebunden-
heit wurde eingeschränkt durch den künstlerischen
Formalismus des byzantinischen Wesens, welches
äußere Pracht statt innerlicher Vertiefung bietet.
Hatte die frühere Kunst sich mit einfachen Farben-
wirkungen begnügt, so strahlt die byzantinische
Madonna in Gold und Edelsteinen und ist in die
reichsten orientalischen Prachtgewänder gehüllt.
Auch die Kunst der abendländischen Kirche blieb
bis an die Grenze der gotischen Zeit heran in
jenen Überlieferungen befangen und erst seit dem
12. bis 13. Jahrhundert wird das anders, neben
dem Christuskinde erlangt seine Mutter allmählich
gleiche Berücksichtigung. bis sie zur Hauptfigur
wird. So hat Cimabue (geb. 1240 in Florenz)
eine hoheitsvolle thronende Madonna gemalt,
welche liebevoll zum Beschauer gewendet, auf das
Jesukind hinweist. Auch die den Thron tragenden
Engel wenden den Blick zum Beschauer, der so
in die Jdee des Bildes mit eingezogen ist.
(Abb. 48.) Eine andere Madonna, welche von
PietroCavallini (1430)stammt, wird wie imZwie-
gespräch vom Jesukinde gesegnet. (Abb. 49.) Von
Stefano da Ferrara befindet sich eine gar liebliche
MadonnawiezufreundlichemWillkommgrußegleich
am Eingang in der St. Antoniuskirche zu Padua.
(Abb. 50.) Jn jene Zeit des Mittelalters, welche
die Blüteperiode der Symbolik in der kirchlichen
Liturgie, wie in der Baukunst, Bildhauerei und
Malerei war, fällt auch die Entstehung der
schwarzen Madonnen. Sie sind ver-
schieden erklärt worden, am richtigsten wohl in
der Weise, daß man diese Bilder als eine buch-
stäbliche und symbolische Wiedergabe ansieht für
Abb.58
Stephan Lochnor, Madonna (Text S. 48)
Küln, Erzbischöfl. Museum