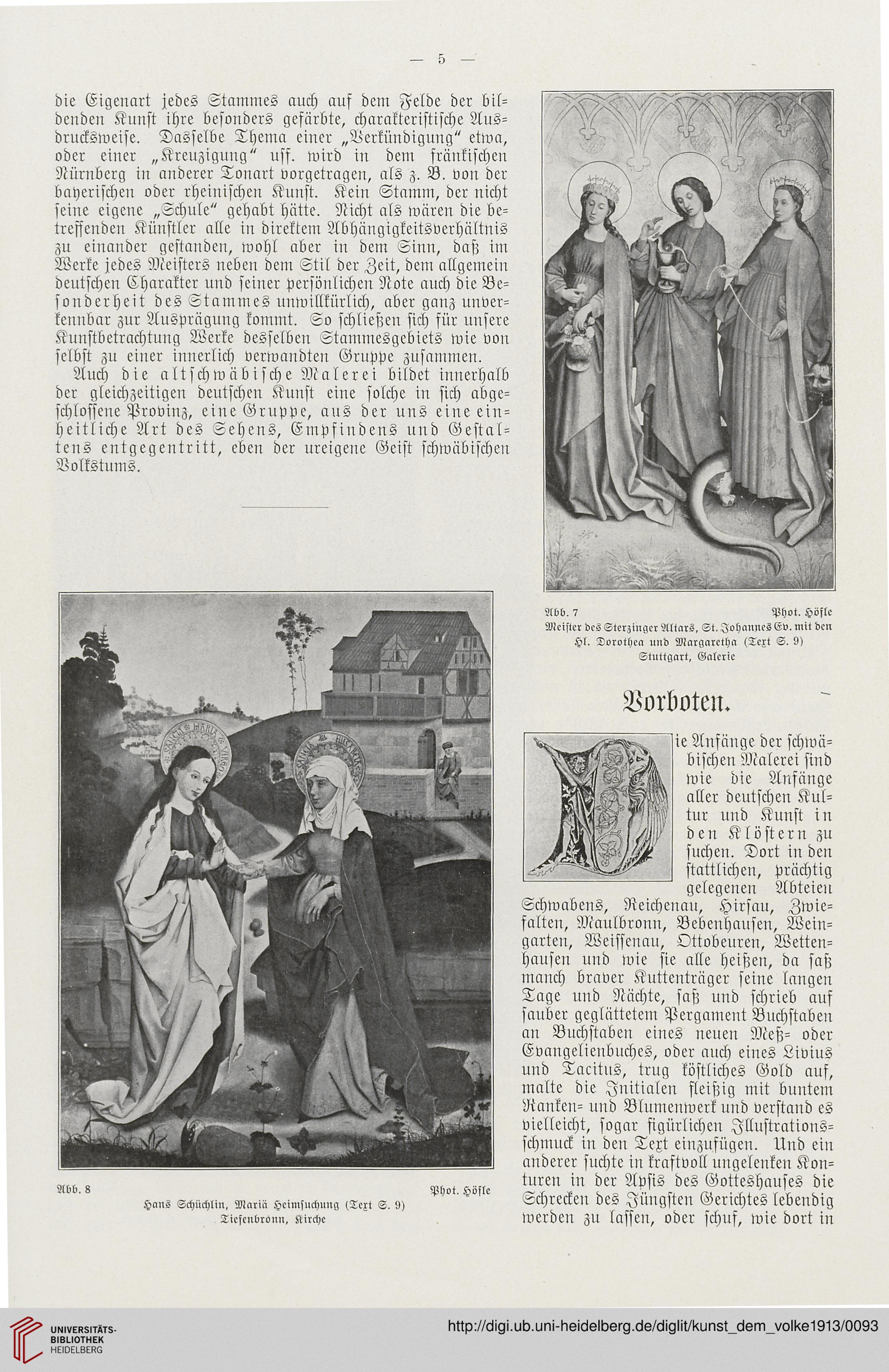5
die Eigenart jedes Stammes auch auf dem Felde der bil-
denden Kunst ihre besonders gefärbte, charakteristische Aus-
drucksweise. Dasselbe Thema einer „Verkündigung" etwa,
oder einer „Kreuzigung" usf. wird in dem fränkischen
Nürnberg in anderer Tonart vorgetragen, als z. B. von der
bayerischen oder rheinischen Kunst. Kein Stamm, der nicht
seine eigene „Schule" gehabt hätte. Nicht als wären die be-
treffenden Künstler alle in direktem Abhängigkeitsverhältnis
zu einander gestanden, wohl aber in dem Sinn, daß im
Werke jedes Meisters neben dem Stil der Zeit, dem allgemein
deutschen Charakter und seiner persönlichen Note auch die Be-
sonderheit des Stammes unwillkürlich, aber ganz unver-
kennbar zur Ausprägung kommt. So schließen sich für unsere
Kunstbetrachtung Werke desselben Stammesgebiets wie von
selbst zu einer innerlich verwandten Gruppe zusammen.
Auch die altschwäbische Malerei bildet innerhalb
der gleichzeitigen deutschen Kunst eine solche in sich abge-
schlossene Provinz, eine Gruppe, ans der uns eine ein-
heitliche Art des Sehens, Empfindens und Gestal-
tens entgegentritt, eben der ureigene Geist schwäbischen
Volkstums.
Abb. 8 Phot. Höslc
Hans Schüchlin, Mariä Heimsuchung (Text S. 9)
Tiefcnbronn, Kirche
Abb. 7 Phot. Höfle
Meister des Sterzinger Altars, St. Johannes Ev. mit den
Hl. Dorothea und Margaretha (Text S. 9)
Stuttgart, Galerie
Vorboten.
ie Anfänge der schwä-
bischen Malerei sind
wie die Anfänge
aller deutschen Kul-
tur und Kunst in
den Klöstern zu
suchen. Dort in den
stattlichen, prächtig
gelegenen Abteien
Schwabens, Reichenau, Hirsau, Zwie-
falten, Maulbronn, Bebenhausen, Wein-
garten, Weissenau, Ottobeuren, Wetten-
hausen und lvie sie alle heißen, da saß
manch braver Kuttenträger seine langen
Tage und Nächte, saß und schrieb auf
sauber geglättetem Pergament Buchstaben
an Buchstaben eines neuen Meß- oder
Evangelienbuches, oder auch eines Livius
und Tacitus, trug köstliches Gold auf,
malte die Jnitialen fleißig mit buntem
Ranken- und Blumenwerk und verstand es
vielleicht, sogar figürlichen Jllustrations-
schmuck in den Text einzufügen. Und ein
anderer suchte in kraftvoll ungelenken Kon-
turen in der Apsis des Gotteshauses die
Schrecken des Jüngsten Gerichtes lebendig
werden zu lassen, oder schus, wie dort in
die Eigenart jedes Stammes auch auf dem Felde der bil-
denden Kunst ihre besonders gefärbte, charakteristische Aus-
drucksweise. Dasselbe Thema einer „Verkündigung" etwa,
oder einer „Kreuzigung" usf. wird in dem fränkischen
Nürnberg in anderer Tonart vorgetragen, als z. B. von der
bayerischen oder rheinischen Kunst. Kein Stamm, der nicht
seine eigene „Schule" gehabt hätte. Nicht als wären die be-
treffenden Künstler alle in direktem Abhängigkeitsverhältnis
zu einander gestanden, wohl aber in dem Sinn, daß im
Werke jedes Meisters neben dem Stil der Zeit, dem allgemein
deutschen Charakter und seiner persönlichen Note auch die Be-
sonderheit des Stammes unwillkürlich, aber ganz unver-
kennbar zur Ausprägung kommt. So schließen sich für unsere
Kunstbetrachtung Werke desselben Stammesgebiets wie von
selbst zu einer innerlich verwandten Gruppe zusammen.
Auch die altschwäbische Malerei bildet innerhalb
der gleichzeitigen deutschen Kunst eine solche in sich abge-
schlossene Provinz, eine Gruppe, ans der uns eine ein-
heitliche Art des Sehens, Empfindens und Gestal-
tens entgegentritt, eben der ureigene Geist schwäbischen
Volkstums.
Abb. 8 Phot. Höslc
Hans Schüchlin, Mariä Heimsuchung (Text S. 9)
Tiefcnbronn, Kirche
Abb. 7 Phot. Höfle
Meister des Sterzinger Altars, St. Johannes Ev. mit den
Hl. Dorothea und Margaretha (Text S. 9)
Stuttgart, Galerie
Vorboten.
ie Anfänge der schwä-
bischen Malerei sind
wie die Anfänge
aller deutschen Kul-
tur und Kunst in
den Klöstern zu
suchen. Dort in den
stattlichen, prächtig
gelegenen Abteien
Schwabens, Reichenau, Hirsau, Zwie-
falten, Maulbronn, Bebenhausen, Wein-
garten, Weissenau, Ottobeuren, Wetten-
hausen und lvie sie alle heißen, da saß
manch braver Kuttenträger seine langen
Tage und Nächte, saß und schrieb auf
sauber geglättetem Pergament Buchstaben
an Buchstaben eines neuen Meß- oder
Evangelienbuches, oder auch eines Livius
und Tacitus, trug köstliches Gold auf,
malte die Jnitialen fleißig mit buntem
Ranken- und Blumenwerk und verstand es
vielleicht, sogar figürlichen Jllustrations-
schmuck in den Text einzufügen. Und ein
anderer suchte in kraftvoll ungelenken Kon-
turen in der Apsis des Gotteshauses die
Schrecken des Jüngsten Gerichtes lebendig
werden zu lassen, oder schus, wie dort in