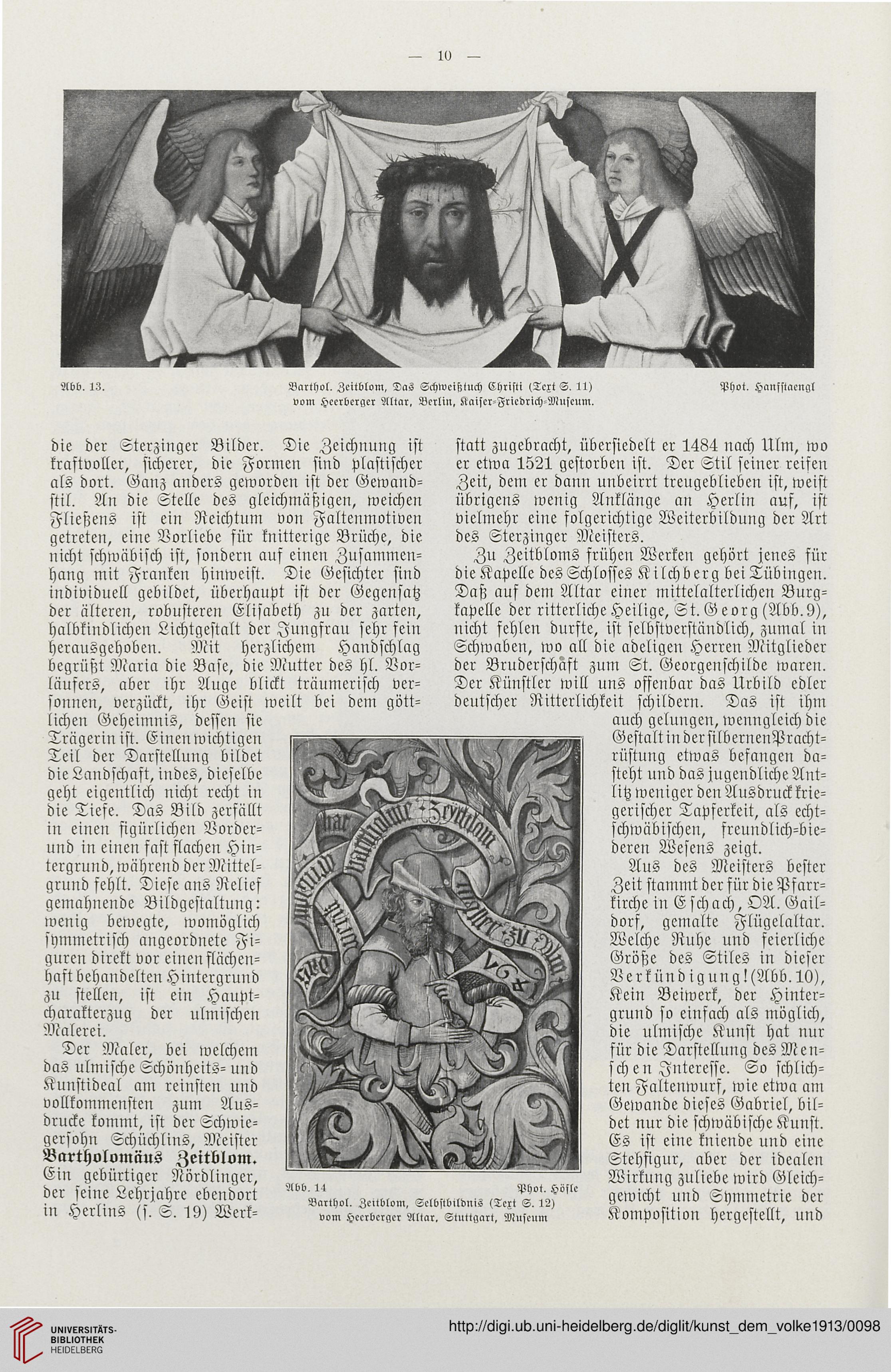10
Abb. 13. Barthol. Zeitblom, Das Schwcihtuch Christi (Tcxt S. 11) Phot. Hansstaengl
vom Hecrberger Altar, Bcrlin, Kaiser-Fricdrich-Mnseum.
die der Sterzinger Bilder. Die Zeichnung ist
kraftvoller, sicherer, die Formen sind plastischer
als dort. Ganz anders geworden ist der Gewand-
stil. An die Stelle des gleichmäßigen, weichen
Fließens ist ein Reichtum von Faltenmotiven
getreten, eine Vorliebe für knitterige Brüche, die
nicht schwäbisch ist, sondern auf einen Zusammen-
hang mit Franken hinweist. Die Gesichter sind
individuell gebildet, überhaupt ist der Gegensatz
der älteren, robusteren Elisabeth zu der zarten,
halbkindlichen Lichtgestalt der Jungfrau sehr fein
herausgehoben. Mit herzlichem Handschlag
begrüßt Maria die Base, die Mutter des hl. Vor-
läufers, aber ihr Auge blickt träumerisch ver-
sonnen, verzückt, ihr Geist weilt bei dem gött-
lichen Geheimnis, dessen sie
Trägerin ist. Einenwichtigen
Teil der Darstellung bildet
die Landschaft, indes, dieselbe
geht eigentlich nicht recht in
die Tiefe. Das Bild zerfällt
in einen sigürlichen Vorder-
und in einen sast flachen Hin-
tergrund, während der Mittel-
grund fehlt. Diese ans Relief
gemahnende Bildgestaltung:
wenig bewegte, womöglich
symmetrisch angeordnete Fi-
guren direkt vor einenstächen-
haftbehandelten Hintergrund
zu stellen, ist ein Haupt-
charakterzug der ulmischen
Malerei.
Der Maler, bei welchem
das ulmische Schöuheits- und
Kunstideal am reinsten und
vollkommensten zum Aus-
drucke kommt, ist der Schwie-
gersohn Schüchlins, Meister
Bartholomäus Zeitblom.
Ein gebürtiger Nördlinger,
der seine Lehrjahre ebendort
in Herlins (s. S. 19) Werk-
statt zugebracht, übersiedelt er 1484 nach Ulm, wo
er etwa 1521 gestorben ist. Der Stil seiner reisen
Zeit, dem er dann unbeirrt treugeblieben ist, weist
übrigens wenig Anklänge an Herlin auf, ist
vielmehr eine folgerichtige Weiterbildung der Art
des Sterzinger Meisters.
Zu Zeitbloms frühen Werken gehört jenes für
die Kapelle des Schtosses Kilchberg bei Tübingen.
Daß auf dem Altar einer mittelalterlichen Burg-
kapelle der ritterliche Heilige, St. G eorg (Abb.9),
uicht fehlen durfte, ist selbstverständlich, zumal in
Schwaben, wo all die adeligen Herren Mitglieder
der Bruderschaft zum St. Georgenschilde waren.
Der Künstler will uns offenbar das Urbild edler
deutscher Ritterlichkeit schildern. Das ist ihm
auch gelungen, wenngleich die
Gestalt in der silbernenPracht-
rüstung etwas befangen da-
steht und das jugendliche Ant-
litz weniger den Ausdruck krie-
gerischer Tapferkeit, als echt-
schwäbischen, freundlich-bie-
deren Wesens zeigt.
Aus des Meisters bester
Zeit stammt der für die Pfarr-
kirche iu Eschach, OA. Gail-
dorf, gemalte Flügelaltar.
Welche Ruhe und feierliche
Größe des Stiles in dieser
Verkündigung!(Abb.10),
Kein Beiwerk, der Hinter-
grund so einfach als möglich,
die ulmische Kunst hat nur
für die Darstellung des Men-
sch e n Jnteresse. So schlich-
ten Faltenwurf, wie etwa am
Gewande dieses Gabriel, bil-
det nur die schwäbische Kunst.
Es ist eine kniende und eine
Stehfigur, aber der idealen
Wirk'ung zuliebe wird Gleich-
gewicht und Symmetrie der
Komposition hergestellt, und
Abb. 14 Phot. Hösle
Barthol. Zeitblom, Selbstbildnis (Text S. 12)
vom Hecrberger Altar. Stuttgart, Musenm
Abb. 13. Barthol. Zeitblom, Das Schwcihtuch Christi (Tcxt S. 11) Phot. Hansstaengl
vom Hecrberger Altar, Bcrlin, Kaiser-Fricdrich-Mnseum.
die der Sterzinger Bilder. Die Zeichnung ist
kraftvoller, sicherer, die Formen sind plastischer
als dort. Ganz anders geworden ist der Gewand-
stil. An die Stelle des gleichmäßigen, weichen
Fließens ist ein Reichtum von Faltenmotiven
getreten, eine Vorliebe für knitterige Brüche, die
nicht schwäbisch ist, sondern auf einen Zusammen-
hang mit Franken hinweist. Die Gesichter sind
individuell gebildet, überhaupt ist der Gegensatz
der älteren, robusteren Elisabeth zu der zarten,
halbkindlichen Lichtgestalt der Jungfrau sehr fein
herausgehoben. Mit herzlichem Handschlag
begrüßt Maria die Base, die Mutter des hl. Vor-
läufers, aber ihr Auge blickt träumerisch ver-
sonnen, verzückt, ihr Geist weilt bei dem gött-
lichen Geheimnis, dessen sie
Trägerin ist. Einenwichtigen
Teil der Darstellung bildet
die Landschaft, indes, dieselbe
geht eigentlich nicht recht in
die Tiefe. Das Bild zerfällt
in einen sigürlichen Vorder-
und in einen sast flachen Hin-
tergrund, während der Mittel-
grund fehlt. Diese ans Relief
gemahnende Bildgestaltung:
wenig bewegte, womöglich
symmetrisch angeordnete Fi-
guren direkt vor einenstächen-
haftbehandelten Hintergrund
zu stellen, ist ein Haupt-
charakterzug der ulmischen
Malerei.
Der Maler, bei welchem
das ulmische Schöuheits- und
Kunstideal am reinsten und
vollkommensten zum Aus-
drucke kommt, ist der Schwie-
gersohn Schüchlins, Meister
Bartholomäus Zeitblom.
Ein gebürtiger Nördlinger,
der seine Lehrjahre ebendort
in Herlins (s. S. 19) Werk-
statt zugebracht, übersiedelt er 1484 nach Ulm, wo
er etwa 1521 gestorben ist. Der Stil seiner reisen
Zeit, dem er dann unbeirrt treugeblieben ist, weist
übrigens wenig Anklänge an Herlin auf, ist
vielmehr eine folgerichtige Weiterbildung der Art
des Sterzinger Meisters.
Zu Zeitbloms frühen Werken gehört jenes für
die Kapelle des Schtosses Kilchberg bei Tübingen.
Daß auf dem Altar einer mittelalterlichen Burg-
kapelle der ritterliche Heilige, St. G eorg (Abb.9),
uicht fehlen durfte, ist selbstverständlich, zumal in
Schwaben, wo all die adeligen Herren Mitglieder
der Bruderschaft zum St. Georgenschilde waren.
Der Künstler will uns offenbar das Urbild edler
deutscher Ritterlichkeit schildern. Das ist ihm
auch gelungen, wenngleich die
Gestalt in der silbernenPracht-
rüstung etwas befangen da-
steht und das jugendliche Ant-
litz weniger den Ausdruck krie-
gerischer Tapferkeit, als echt-
schwäbischen, freundlich-bie-
deren Wesens zeigt.
Aus des Meisters bester
Zeit stammt der für die Pfarr-
kirche iu Eschach, OA. Gail-
dorf, gemalte Flügelaltar.
Welche Ruhe und feierliche
Größe des Stiles in dieser
Verkündigung!(Abb.10),
Kein Beiwerk, der Hinter-
grund so einfach als möglich,
die ulmische Kunst hat nur
für die Darstellung des Men-
sch e n Jnteresse. So schlich-
ten Faltenwurf, wie etwa am
Gewande dieses Gabriel, bil-
det nur die schwäbische Kunst.
Es ist eine kniende und eine
Stehfigur, aber der idealen
Wirk'ung zuliebe wird Gleich-
gewicht und Symmetrie der
Komposition hergestellt, und
Abb. 14 Phot. Hösle
Barthol. Zeitblom, Selbstbildnis (Text S. 12)
vom Hecrberger Altar. Stuttgart, Musenm