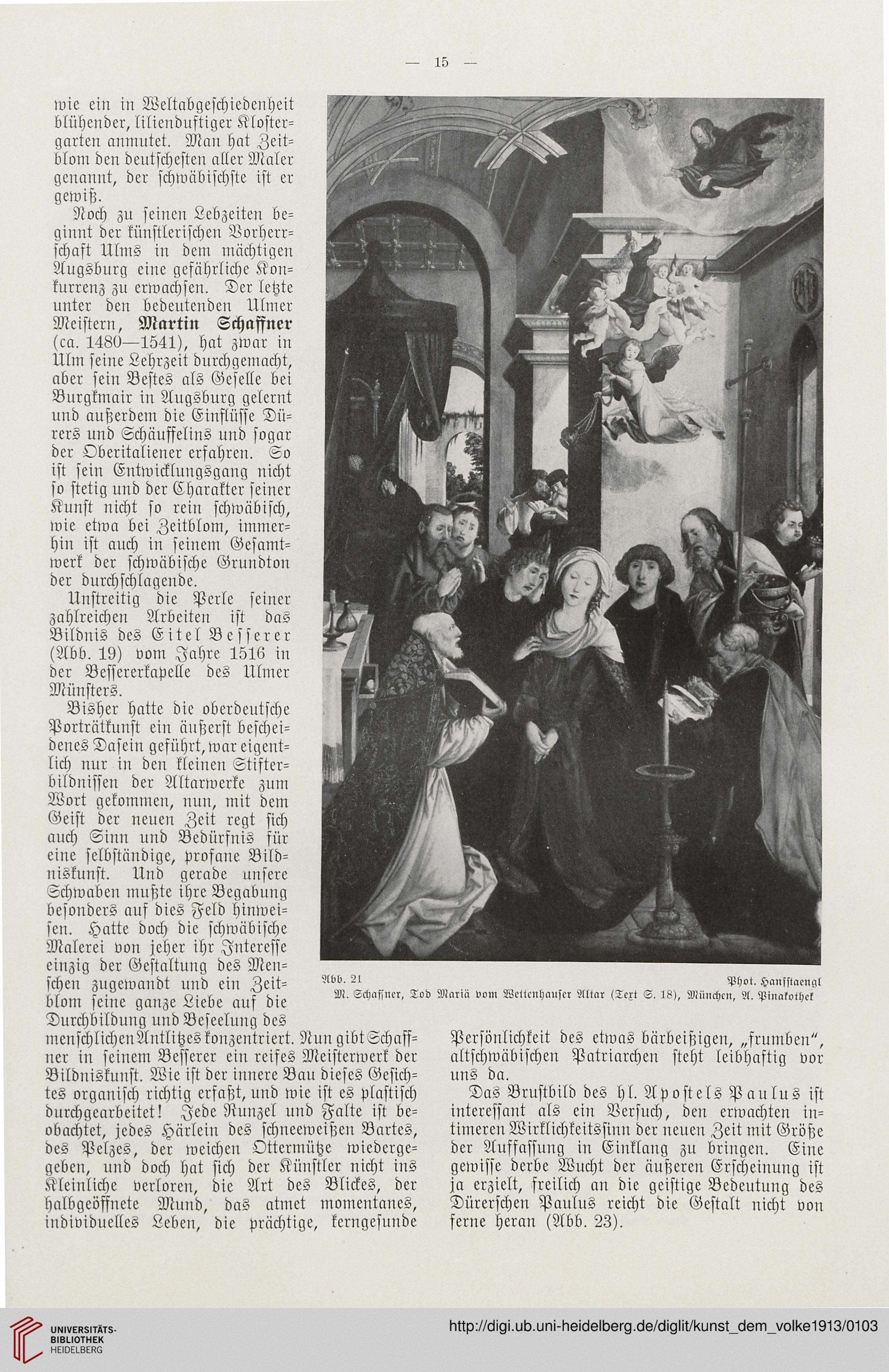15
>vie ei» in Weltabgeschiedenheit
blühender, lilienduftiger Kloster-
garten anmutet. Man hat Zeit-
blom den deutschesten aller Maler
genannt, der schwäbischste ist er
gewiß.
Noch zu seinen Lebzeiten be-
ginnt der künstlerischen Vorherr-
schaft Ulms in dem mächtigen
Augsburg cine gefährliche Kon-
kurrenz zu erwachsen. Der letzte
unter den bedeutenden Ulmer
Meistern, Martin Schaffner
(ca. 1480—1541), hat zwar in
Ulm seine Lehrzeit durchgemacht,
aber sein Bestes als Geselle bei
Burgkmair in Augsburg gelernt
und außerdem die Einflüsse Dü-
rers und Schäuffelins und sogar
der Oberitaliener erfahren. So
ist sein Entwicklungsgang nicht
so stetig und der Charakter seiner
Kunst nicht so rein schwäbisch,
wie etwa bei Zeitblom, immer-
hin ist auch in seinem Gesamt-
werk der schwäbische Grundton
der durchschlagende.
Unstreitig die Perle seiner
zahlreichen Arbeiten ist das
Bildnis des Eitel Besserer
(Abb. 19) vom Jahre 1516 in
der Beffererkapelle des Ulmer
Münsters.
Bisher hatte die oberdeutsche
Porträtkunst ein änßerst beschei-
denes Dasein geführt, war eigent-
lich nur in den kleinen Stifter-
bildnissen der Altarwerke zum
Wort gekommen, nun, mit dem
Geist der neuen Zeit regt sich
auch Sinn und Bedürfnis für
eine selbständige, profane Bild-
niskunst. Und gerade unsere
Schwaben mußte ihre Begabung
besonders auf dies Feld hinwei-
sen. Hatte doch die schwäbische
Malerei von jeher ihr Jnteresse
einzig der Gestaltung des Men-
schen zugewandt und ein Zeit-
blom seine ganze Liebe auf die
Durchbildung und Beseelung des
menschlichenAntlitzeskonzcntriert. Nun gibtSchaff-
ner in seinem Befferer ein reifes Meisterwerk der
Bildniskunst. Wie ist der innere Bau dieses Gesich-
tes organisch richtig erfaßt, nnd wie ist es plastisch
durchgearbeitet! Jede Runzel und Falte ist be-
obachtet, jedes Härlein des schneeweißen Bartes,
des Pelzes, der weichen Ottermütze wiederge-
geben, und doch hat sich der Künstler nicht ins
Kleinliche verloren, die Art des Blickes, der
halbgeöffnete Mund, das atmet momentanes,
individnelles Leben, die prächtige, kerngesunde
Abb. 21
M. Schaffncr, Tod
Phot. Hansstacngl
Mariä vom Wcttcnhauscr Altar <Tc;t S. 18), Miiiichcii, A. Pinakothck
Pcrsönlichkeit des etwas bärbeißigen, „frumben",
altschwäbischen Patriarchen steht leibhaftig vor
uns da.
Das Brustbild des hl. Apostels Paulus ist
interessant als ein Versuch, den erwachten in-
timeren Wirklichkeitssinn der neuen Zeit mit Größe
der Auffaffung in Einklang zu bringen. Eine
gewisse derbe Wucht der äußeren Erscheinung ist
ja erzielt, freilich an die geistige Bedeutung des
Dürerschen Paulus reicht die Gestalt nicht von
ferne heran (Abb. 23).
>vie ei» in Weltabgeschiedenheit
blühender, lilienduftiger Kloster-
garten anmutet. Man hat Zeit-
blom den deutschesten aller Maler
genannt, der schwäbischste ist er
gewiß.
Noch zu seinen Lebzeiten be-
ginnt der künstlerischen Vorherr-
schaft Ulms in dem mächtigen
Augsburg cine gefährliche Kon-
kurrenz zu erwachsen. Der letzte
unter den bedeutenden Ulmer
Meistern, Martin Schaffner
(ca. 1480—1541), hat zwar in
Ulm seine Lehrzeit durchgemacht,
aber sein Bestes als Geselle bei
Burgkmair in Augsburg gelernt
und außerdem die Einflüsse Dü-
rers und Schäuffelins und sogar
der Oberitaliener erfahren. So
ist sein Entwicklungsgang nicht
so stetig und der Charakter seiner
Kunst nicht so rein schwäbisch,
wie etwa bei Zeitblom, immer-
hin ist auch in seinem Gesamt-
werk der schwäbische Grundton
der durchschlagende.
Unstreitig die Perle seiner
zahlreichen Arbeiten ist das
Bildnis des Eitel Besserer
(Abb. 19) vom Jahre 1516 in
der Beffererkapelle des Ulmer
Münsters.
Bisher hatte die oberdeutsche
Porträtkunst ein änßerst beschei-
denes Dasein geführt, war eigent-
lich nur in den kleinen Stifter-
bildnissen der Altarwerke zum
Wort gekommen, nun, mit dem
Geist der neuen Zeit regt sich
auch Sinn und Bedürfnis für
eine selbständige, profane Bild-
niskunst. Und gerade unsere
Schwaben mußte ihre Begabung
besonders auf dies Feld hinwei-
sen. Hatte doch die schwäbische
Malerei von jeher ihr Jnteresse
einzig der Gestaltung des Men-
schen zugewandt und ein Zeit-
blom seine ganze Liebe auf die
Durchbildung und Beseelung des
menschlichenAntlitzeskonzcntriert. Nun gibtSchaff-
ner in seinem Befferer ein reifes Meisterwerk der
Bildniskunst. Wie ist der innere Bau dieses Gesich-
tes organisch richtig erfaßt, nnd wie ist es plastisch
durchgearbeitet! Jede Runzel und Falte ist be-
obachtet, jedes Härlein des schneeweißen Bartes,
des Pelzes, der weichen Ottermütze wiederge-
geben, und doch hat sich der Künstler nicht ins
Kleinliche verloren, die Art des Blickes, der
halbgeöffnete Mund, das atmet momentanes,
individnelles Leben, die prächtige, kerngesunde
Abb. 21
M. Schaffncr, Tod
Phot. Hansstacngl
Mariä vom Wcttcnhauscr Altar <Tc;t S. 18), Miiiichcii, A. Pinakothck
Pcrsönlichkeit des etwas bärbeißigen, „frumben",
altschwäbischen Patriarchen steht leibhaftig vor
uns da.
Das Brustbild des hl. Apostels Paulus ist
interessant als ein Versuch, den erwachten in-
timeren Wirklichkeitssinn der neuen Zeit mit Größe
der Auffaffung in Einklang zu bringen. Eine
gewisse derbe Wucht der äußeren Erscheinung ist
ja erzielt, freilich an die geistige Bedeutung des
Dürerschen Paulus reicht die Gestalt nicht von
ferne heran (Abb. 23).