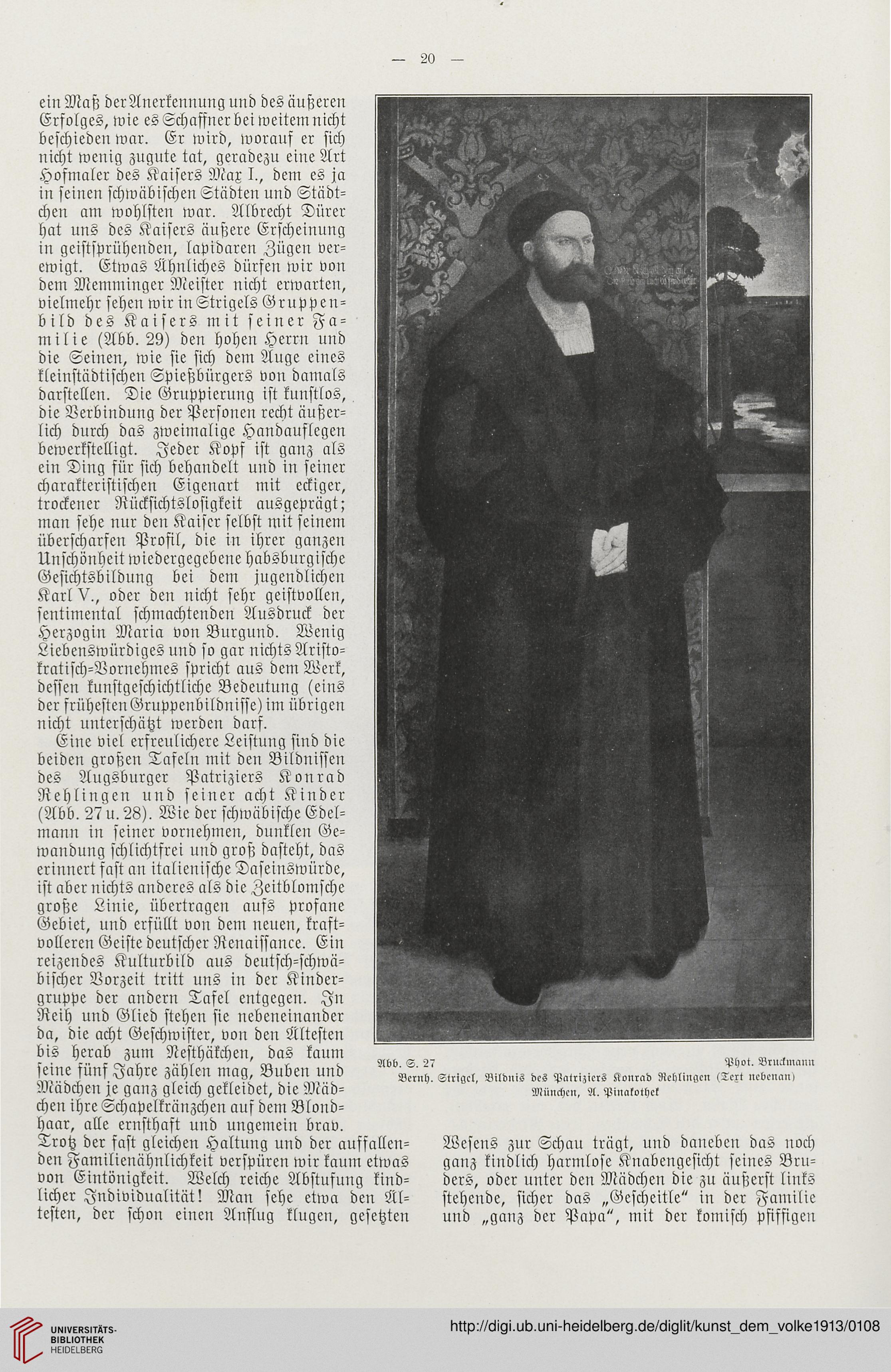20
ein Maß derAnerkennung und des äußeren
Erfolges, wie esSchaffnerbei weitemnicht
beschieden war. Er wird, worauf er sich
nicht wenig zugute tat, geradezu eine Art
Hofmaler des Kaisers Max I., dem es ja
in seinen schwäbischen Städten und Städt-
chen am wohlsten war. Albrecht Dürer
hat uns des Kaisers äußere Erscheinung
in geistsprühenden, lapidaren Zügen ver-
ewigt. Etwas Ahnliches dürfen wir von
dem Memminger Meister nicht erwarten,
vielmehr sehen wir inStrigels Gruppen-
bild des Kaisers mit seiner Fa-
milie (Abb. 29) den hohen Herrn und
die Seinen, wie sie sich dem Auge eines
kleinstädtischen Spießbürgers von damaks
darstellen. Die Gruppierung ist kunstlos,
die Verbindung der Personen recht äußer-
lich durch das zweimalige Handauflegen
bewerkstelligt. Jeder Kopf ist gauz als
ein Ding für sich behandelt und in seiner
charakteristischen Eigenart mit eckiger,
trockener Rücksichtslosigkeit ausgeprägt;
man sehe nur den Kaiser selbst mit seinem
überscharfen Profil, die in ihrer ganzen
Unschönheit wiedergegebene habsburgische
Gesichtsbildung bei dem jugendlichen
Karl V., oder den nicht sehr geistvollen,
sentimental schmachtenden Ausdruck der
Herzogin Maria von Burgund. Wenig
Liebenswürdiges und so gar nichts Aristo-
kratisch-Vornehmes spricht aus dem Werk,
dessen kunstgeschichtliche Bedeutung (eins
der frühestenGruppenbildnisse) im übrigen
nicht unterschätzt werden darf.
Eine viel erfreulichere Leistung sind die
beiden großen Tafeln mit den Bildnissen
des Augsburger Patriziers Konrad
Rehlingen und seiner acht Kinder
(Abb. 27 u. 28). Wie der schwäbische Edel-
mann in seiner vornehmen, dunklen Ge-
wandung schlichtfrei und groß dasteht, das
erinnert fast au italienische Daseinswürde,
ist aber nichts anderes als die Zeitblomsche
große Linie, übertragen aufs profane
Gebiet, und erfüllt von dem neuen, kraft-
volleren Geiste deutscher Renaissance. Ein
reizendes Kulturbild aus deutsch-schwä-
bischer Vorzeit tritt uns in der Kinder-
gruppe der andern Tafel entgegen. Jn
Reih und Glied stehen sie nebeneinander
da, die acht Geschwister, von den Ältesten
bis herab zum Nesthäkchen, das kaum
seine fünf Jahre zählen mag, Buben und
Mädchen je ganz gleich gekleidet, die Mäd-
chen ihre Schapelkränzchen auf dem Blond-
haar, alle ernsthaft und ungemein brav.
Trotz der fast gleichen Haltung und der auffallen-
den Familienähnlichkeit verspüren wir kaum etwas
oon Eintönigkeit. Welch reiche Abstufung kind-
licher Jndividualität! Man sehe etwa den Al-
testen, der schon einen Anslug klugen, gesetzten
Phot. Bruckmm»!
Strigcl, Bildnis dcs Patrizicrs Konrad Rchliugcn <Tcrt ncbenan)
Miinchcn, A. Pinakothck
Wesens zur Schau trägt, und daneben das noch
ganz kindlich harmlose Knabengesicht seines Bru-
ders, oder unter den Mädchen die zu äußerst links
stehende, sicher das „Gescheitle" in der Familie
und „ganz der Papa", mit der komisch pfiffigen
ein Maß derAnerkennung und des äußeren
Erfolges, wie esSchaffnerbei weitemnicht
beschieden war. Er wird, worauf er sich
nicht wenig zugute tat, geradezu eine Art
Hofmaler des Kaisers Max I., dem es ja
in seinen schwäbischen Städten und Städt-
chen am wohlsten war. Albrecht Dürer
hat uns des Kaisers äußere Erscheinung
in geistsprühenden, lapidaren Zügen ver-
ewigt. Etwas Ahnliches dürfen wir von
dem Memminger Meister nicht erwarten,
vielmehr sehen wir inStrigels Gruppen-
bild des Kaisers mit seiner Fa-
milie (Abb. 29) den hohen Herrn und
die Seinen, wie sie sich dem Auge eines
kleinstädtischen Spießbürgers von damaks
darstellen. Die Gruppierung ist kunstlos,
die Verbindung der Personen recht äußer-
lich durch das zweimalige Handauflegen
bewerkstelligt. Jeder Kopf ist gauz als
ein Ding für sich behandelt und in seiner
charakteristischen Eigenart mit eckiger,
trockener Rücksichtslosigkeit ausgeprägt;
man sehe nur den Kaiser selbst mit seinem
überscharfen Profil, die in ihrer ganzen
Unschönheit wiedergegebene habsburgische
Gesichtsbildung bei dem jugendlichen
Karl V., oder den nicht sehr geistvollen,
sentimental schmachtenden Ausdruck der
Herzogin Maria von Burgund. Wenig
Liebenswürdiges und so gar nichts Aristo-
kratisch-Vornehmes spricht aus dem Werk,
dessen kunstgeschichtliche Bedeutung (eins
der frühestenGruppenbildnisse) im übrigen
nicht unterschätzt werden darf.
Eine viel erfreulichere Leistung sind die
beiden großen Tafeln mit den Bildnissen
des Augsburger Patriziers Konrad
Rehlingen und seiner acht Kinder
(Abb. 27 u. 28). Wie der schwäbische Edel-
mann in seiner vornehmen, dunklen Ge-
wandung schlichtfrei und groß dasteht, das
erinnert fast au italienische Daseinswürde,
ist aber nichts anderes als die Zeitblomsche
große Linie, übertragen aufs profane
Gebiet, und erfüllt von dem neuen, kraft-
volleren Geiste deutscher Renaissance. Ein
reizendes Kulturbild aus deutsch-schwä-
bischer Vorzeit tritt uns in der Kinder-
gruppe der andern Tafel entgegen. Jn
Reih und Glied stehen sie nebeneinander
da, die acht Geschwister, von den Ältesten
bis herab zum Nesthäkchen, das kaum
seine fünf Jahre zählen mag, Buben und
Mädchen je ganz gleich gekleidet, die Mäd-
chen ihre Schapelkränzchen auf dem Blond-
haar, alle ernsthaft und ungemein brav.
Trotz der fast gleichen Haltung und der auffallen-
den Familienähnlichkeit verspüren wir kaum etwas
oon Eintönigkeit. Welch reiche Abstufung kind-
licher Jndividualität! Man sehe etwa den Al-
testen, der schon einen Anslug klugen, gesetzten
Phot. Bruckmm»!
Strigcl, Bildnis dcs Patrizicrs Konrad Rchliugcn <Tcrt ncbenan)
Miinchcn, A. Pinakothck
Wesens zur Schau trägt, und daneben das noch
ganz kindlich harmlose Knabengesicht seines Bru-
ders, oder unter den Mädchen die zu äußerst links
stehende, sicher das „Gescheitle" in der Familie
und „ganz der Papa", mit der komisch pfiffigen