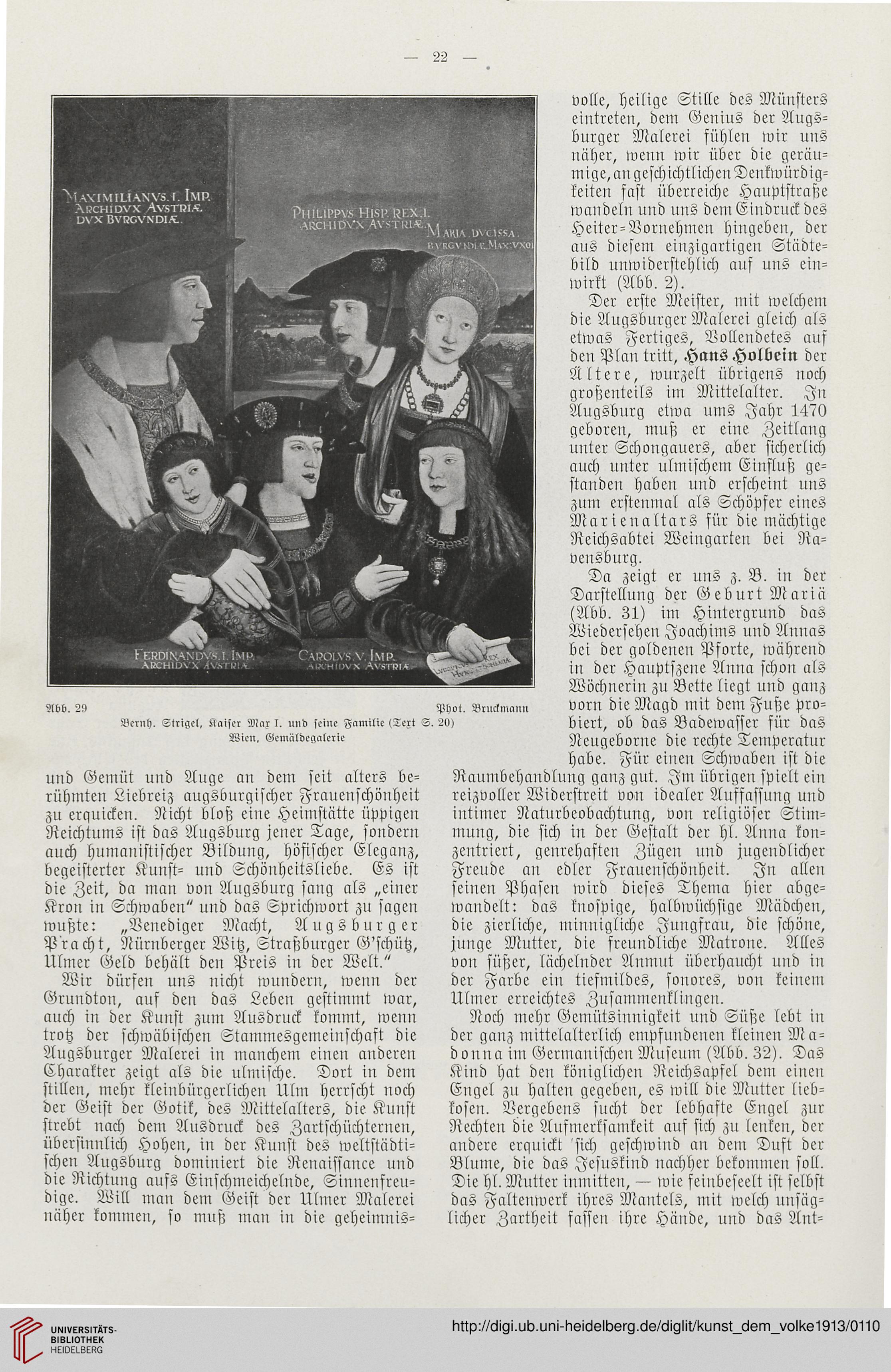22
>lbb. 29 Pbot. Bruckmann
Bernh. Strigel, Kaiser Max I. und scine Familie (Tert S. 2g>
Wicn, Gemäldcaalcrie
und Gemüt und Auge an dem seit alters be-
rühmteu Liebreiz augsburgischer Fraueuschönheit
zu erquicken. Nicht bloß eine Heimstätte üppigen
Reichtums ist das Augsburg jener Tage, soudern
auch humanistischer Bildung, höfischer Eleganz,
begeisterter Kunst- und Schöuheitsliebe. Es ist
die Zeit, da man von Augsburg sang als „einer
Kron in Schwaben" und das Sprichmort zu sagen
wußte: „Venediger Macht, Augsburger
Pracht, Nürnberger Witz, Straßburger G'schütz,
Ulmer Geld behält den Preis in der Welt."
Wir dürfen uns nicht wundern, wenu der
Grundton, auf den das Leben gestimmt war,
auch in der Kunst zum Ausdruck kommt, wenn
trotz der schwäbischen Stammesgemeinschaft die
Augsburger Malerei in manchem einen anderen
Charakter zeigt als die ulmische. Dort in dem
stillen, mehr kleinbürgerlichen Ulm herrscht noch
der Geist der Gotik, des Mittelalters, die Kunst
strebt nach dem Ausdruck des Zartschüchternen,
übersinulich Hohen, in der Kunst des weltstädti-
schen Augsburg dominiert die Renaissance und
die Richtung aufs Einschmeichelude, Sinnenfreu-
dige. Will man dem Geist der Ulmer Malerei
näher kommen, so muß man iu die geheimnis-
volle, heilige Stille des Münsters
eintreten, dem Genius der Augs-
burger Malerei fühlen wir uns
näher, wenn wir über die geräu-
mige,augeschichtlichenDenkwürdig-
keiten fast überreiche Hauptstraße
wandeln und uns dem Eindruck des
Heiter-Vornehmen hingeben, der
aus diesem einzigartigeu Städte-
bild unwiderstehlich auf uus ein-
wirkt (Abb. 2).
Der erste Meister, mit welchem
die Augsburger Malerei gleich als
etwas Fertiges, Vollendetes auf
den Plan tritt, Hans Holbein der
Altere, wurzelt übrigens noch
großenteils im Mittelalter. Jn
Augsburg etwa ums Jahr 1470
geboren, muß er eine Zeitlang
unter Schongauers, aber sicherlich
auch unter ulmischem Einfluß ge-
standen haben und erscheint uns
zum erstenmal als Schöpfer eines
Marienaltars für die mächtige
Reichsabtei Weingarten bei Ra-
vensburg.
Da zeigt er uns z. B. in der
Darstellung der Geburt Mariä
(Abb. 31) im Hintergrund das
Wiedersehen Joachims und Annas
bei der goldenen Pforte, während
in der Hauptszene Anna schon als
Wöchnerin zu Bette liegt und ganz
vorn die Magd mit dem Fuße pro-
biert, ob das Badewasser für das
Neugeborue die rechte Temperatur
habe. Für einen Schwaben ist die
Raumbehandlung ganz gut. Jm übrigen spielt ein
reizvoller Widerstreit von idealer Aufsassung und
intimer Naturbeobachtung, von religiöser Stim-
mung, die sich in der Gestalt der hl. Anna kon-
zentriert, genrehaften Zügen und jugendlicher
Freude an edler Frauenschönheit. Jn allen
seinen Phasen wird dieses Thema hier abge-
wandelt: das knospige, Halbwüchsige Mädchen,
die zierliche, minnigliche Jungfrau, die schöne,
junge Mutter, die freundliche Matrone. Alles
von süßer, lächelnder Anmut überhaucht und i»
der Farbe ein tiefmildes, sonores, von keinem
Ulmer erreichtes Zusammenklingen.
Noch mehr Gemütsinnigkeit und Süße lebt in
der ganz mittelalterlich empfundenen kleinen Ma-
donna inr Germanischen Museum (Abb. 32). Das
Kind hat den königlichen Reichsapfel dem einen
Engel zu halten gegeben, es will die Mutter lieb-
kosen. Vergebens sucht der lebhafte Engel zur
Rechten die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, der
andere erquickl 'sich geschwind an dem Duft der
Blume, die das Jesuskiud nachher bekommen soll.
Die hl. Mutter inmitten, — wie feinbeseelt ist selbst
das Faltenwerk ihres Mantels, mit welch unsäg-
licher Zartheit fassen ihre Hände, und das Ant-
>lbb. 29 Pbot. Bruckmann
Bernh. Strigel, Kaiser Max I. und scine Familie (Tert S. 2g>
Wicn, Gemäldcaalcrie
und Gemüt und Auge an dem seit alters be-
rühmteu Liebreiz augsburgischer Fraueuschönheit
zu erquicken. Nicht bloß eine Heimstätte üppigen
Reichtums ist das Augsburg jener Tage, soudern
auch humanistischer Bildung, höfischer Eleganz,
begeisterter Kunst- und Schöuheitsliebe. Es ist
die Zeit, da man von Augsburg sang als „einer
Kron in Schwaben" und das Sprichmort zu sagen
wußte: „Venediger Macht, Augsburger
Pracht, Nürnberger Witz, Straßburger G'schütz,
Ulmer Geld behält den Preis in der Welt."
Wir dürfen uns nicht wundern, wenu der
Grundton, auf den das Leben gestimmt war,
auch in der Kunst zum Ausdruck kommt, wenn
trotz der schwäbischen Stammesgemeinschaft die
Augsburger Malerei in manchem einen anderen
Charakter zeigt als die ulmische. Dort in dem
stillen, mehr kleinbürgerlichen Ulm herrscht noch
der Geist der Gotik, des Mittelalters, die Kunst
strebt nach dem Ausdruck des Zartschüchternen,
übersinulich Hohen, in der Kunst des weltstädti-
schen Augsburg dominiert die Renaissance und
die Richtung aufs Einschmeichelude, Sinnenfreu-
dige. Will man dem Geist der Ulmer Malerei
näher kommen, so muß man iu die geheimnis-
volle, heilige Stille des Münsters
eintreten, dem Genius der Augs-
burger Malerei fühlen wir uns
näher, wenn wir über die geräu-
mige,augeschichtlichenDenkwürdig-
keiten fast überreiche Hauptstraße
wandeln und uns dem Eindruck des
Heiter-Vornehmen hingeben, der
aus diesem einzigartigeu Städte-
bild unwiderstehlich auf uus ein-
wirkt (Abb. 2).
Der erste Meister, mit welchem
die Augsburger Malerei gleich als
etwas Fertiges, Vollendetes auf
den Plan tritt, Hans Holbein der
Altere, wurzelt übrigens noch
großenteils im Mittelalter. Jn
Augsburg etwa ums Jahr 1470
geboren, muß er eine Zeitlang
unter Schongauers, aber sicherlich
auch unter ulmischem Einfluß ge-
standen haben und erscheint uns
zum erstenmal als Schöpfer eines
Marienaltars für die mächtige
Reichsabtei Weingarten bei Ra-
vensburg.
Da zeigt er uns z. B. in der
Darstellung der Geburt Mariä
(Abb. 31) im Hintergrund das
Wiedersehen Joachims und Annas
bei der goldenen Pforte, während
in der Hauptszene Anna schon als
Wöchnerin zu Bette liegt und ganz
vorn die Magd mit dem Fuße pro-
biert, ob das Badewasser für das
Neugeborue die rechte Temperatur
habe. Für einen Schwaben ist die
Raumbehandlung ganz gut. Jm übrigen spielt ein
reizvoller Widerstreit von idealer Aufsassung und
intimer Naturbeobachtung, von religiöser Stim-
mung, die sich in der Gestalt der hl. Anna kon-
zentriert, genrehaften Zügen und jugendlicher
Freude an edler Frauenschönheit. Jn allen
seinen Phasen wird dieses Thema hier abge-
wandelt: das knospige, Halbwüchsige Mädchen,
die zierliche, minnigliche Jungfrau, die schöne,
junge Mutter, die freundliche Matrone. Alles
von süßer, lächelnder Anmut überhaucht und i»
der Farbe ein tiefmildes, sonores, von keinem
Ulmer erreichtes Zusammenklingen.
Noch mehr Gemütsinnigkeit und Süße lebt in
der ganz mittelalterlich empfundenen kleinen Ma-
donna inr Germanischen Museum (Abb. 32). Das
Kind hat den königlichen Reichsapfel dem einen
Engel zu halten gegeben, es will die Mutter lieb-
kosen. Vergebens sucht der lebhafte Engel zur
Rechten die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, der
andere erquickl 'sich geschwind an dem Duft der
Blume, die das Jesuskiud nachher bekommen soll.
Die hl. Mutter inmitten, — wie feinbeseelt ist selbst
das Faltenwerk ihres Mantels, mit welch unsäg-
licher Zartheit fassen ihre Hände, und das Ant-