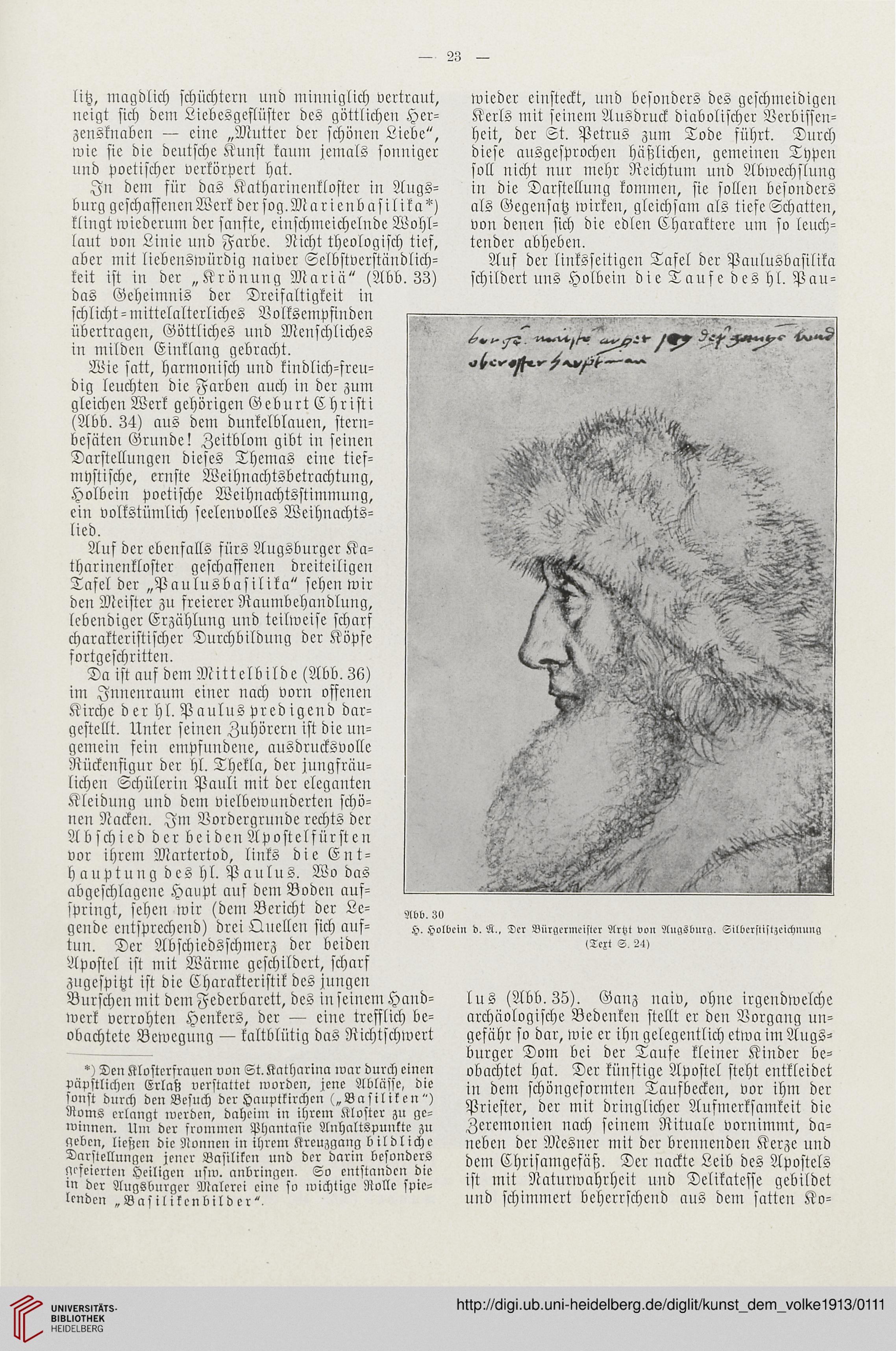23
litz, magdlich schüchtern und minniglich vertraut,
neigt sich dem Liebesgeflüster des göttlichen Her-
zensknaben — eine „Mutter der schönen Liebe",
wie sie die deutsche Kunst kanm jemals sonniger
und poetischer verkörpert hat.
Jn dem für das Katharinenkloster in Augs-
burg geschaffenenWerk dersog.Marienb asilika*)
klingt iviederum der sanfte, einschmeichelnde Wohl-
laut von Linie und Farbe. Nicht theologisch tief,
aber mit liebenswürdig naiver Selbstverständlich-
keit ist in der „Krönung Mariä" (Abb. 33)
das Geheimnis der Dreifaltigkeit in
schlicht - mittelalterliches Volksempfinden
übertragen, Göttliches und Menschliches
in milden Einklang gebracht.
Wie satt, harmonisch und kindlich-freu-
dig leuchten die Farben anch in der zum
gleichen Werk gehörigen Geburt Christi
(Abb. 34) aus dem dunkelblauen, stern-
besäten Grunde! Zeitblom gibt in seinen
Darstellungen dieses Themas eine tief-
mystische, ernste Weihnachtsbetrachtung,
Holbein poetische Weihnachtsstimmung,
ein volkstümlich seelenvolles Weihnachts-
lied.
Auf der ebenfalls fürs Augsburger Ka-
tharinenkloster geschaffenen dreiteiligen
Tafel der „Paulusbasilika" sehen wir
den Meister zu freierer Raumbehandlung,
lebendiger Erzählung und teilweise scharf
charakteristischer Durchbildung der Köpfe
fortgeschritten.
Da ist auf dem Mittelbilde (Abb. 36)
im Jnnenraum einer nach vorn offenen
Kirche der hl. Pauluspredigend dar-
gestellt. Unter seinen Zuhörern ist die un-
gemein fein empfundene, ausdrucksvolle
Rückenfigur der hl. Thekla, der jungfräu-
lichen Schülerin Pauli mit der eleganten
Kleidung und dem vielbewunderten schö-
nen Nacken. Jm Vordergrunde rechts der
Abschied der bei den Apostelfürften
vor ihrem Martertod, links die Ent-
h auptung d es hl. P aulus. Wo das
abgeschlagene Havpt auf dem Boden auf-
springt, sehen wir (dem Bericht der Le-
gende entsprechend) drei Quellen sich auf-
tun. Der Abschiedsschmerz der beiden
Apostel ist mit Wärme geschildert, scharf
zugespitzt ist die Charakteristik des jungen
Burschen mit dem Federbarett, des inseinem Hand-
werk verrohten Henkers, der — eine trefflich be-
obachtete Bewegung — kaltblütig das Richtschwert
^) Den Klostcrfraucn von St.Kntharina war durch einen
Päpstlichen Erlast vcrstaltet ivorden, jenc Ablässe, die
sonst durch den Besuch dcr Hauptkirchcn („Basilikcn")
Roms erlangt iverden, daheim in ihrem Kloster zn ge-
ivinncn. Um der fromnien Phantasie Anhaltspunktc zu
gebcn, ließen die Nonnen in ihrem Kreuzgang bildliche
Darstellungcn jcncr Basilikcn und dcr darin besonders
gcfeierten Heiligen usiv. anbringen. So entstandcn die
>n der Augsburgcr Alalcrci eine so ivichtigc Rolle spie-
lenden „ B as i l i ken b il d c r
wieder einsteckt, und besonders des geschmeidigen
Kerls mit seinem Ausdruck diabolischer Verbissen-
heit, der St. Petrus zum Tode führt. Durch
diese ausgesprochen häßlichen, gemeinen Typen
soll nicht nur mehr Reichtum und Abwechslung
in die Darstellung kommen, sie sollen besonders
als Gegensatz wirken, gleichsam als tiefeSchatten,
von denen fich die edlen Charaktere um so leuch-
tender abheben.
Auf der linksseitigen Tafel der Paulusbasilika
schildert uns Holbein die Taufe des hl. Pau-
lus (Abb.35). Ganz naiv, ohne irgendwelche
archäologische Bedenken stellt er den Vorgang un-
gefähr so dar, wie er ihn gelegentlich etwa im Augs-
burger Dom bei der Taufe kleiner Kinder be-
obachtet hat. Der künftige Apostel steht entkleidet
in dem schöngeformten Taufbecken, vor ihm der
Priester, der mit dringlicher Aufmerksamkeit die
Zeremonien nach seinem Rituale vornimmt, da-
neben der Mesner mit der brennenden Kerze und
dem Chrisamgefäß. Der nackte Leib des Apostels
ist mit Naturwahrheit und Delikatesfe gebildet
und schimmert beherrschend aus dem satten Ko-
Abb. 30
H. Holbein d. Ä.. Der Bürgermeister Artzt von Augsburg. Silbcrstistzeichnung
(Text S. 24)
litz, magdlich schüchtern und minniglich vertraut,
neigt sich dem Liebesgeflüster des göttlichen Her-
zensknaben — eine „Mutter der schönen Liebe",
wie sie die deutsche Kunst kanm jemals sonniger
und poetischer verkörpert hat.
Jn dem für das Katharinenkloster in Augs-
burg geschaffenenWerk dersog.Marienb asilika*)
klingt iviederum der sanfte, einschmeichelnde Wohl-
laut von Linie und Farbe. Nicht theologisch tief,
aber mit liebenswürdig naiver Selbstverständlich-
keit ist in der „Krönung Mariä" (Abb. 33)
das Geheimnis der Dreifaltigkeit in
schlicht - mittelalterliches Volksempfinden
übertragen, Göttliches und Menschliches
in milden Einklang gebracht.
Wie satt, harmonisch und kindlich-freu-
dig leuchten die Farben anch in der zum
gleichen Werk gehörigen Geburt Christi
(Abb. 34) aus dem dunkelblauen, stern-
besäten Grunde! Zeitblom gibt in seinen
Darstellungen dieses Themas eine tief-
mystische, ernste Weihnachtsbetrachtung,
Holbein poetische Weihnachtsstimmung,
ein volkstümlich seelenvolles Weihnachts-
lied.
Auf der ebenfalls fürs Augsburger Ka-
tharinenkloster geschaffenen dreiteiligen
Tafel der „Paulusbasilika" sehen wir
den Meister zu freierer Raumbehandlung,
lebendiger Erzählung und teilweise scharf
charakteristischer Durchbildung der Köpfe
fortgeschritten.
Da ist auf dem Mittelbilde (Abb. 36)
im Jnnenraum einer nach vorn offenen
Kirche der hl. Pauluspredigend dar-
gestellt. Unter seinen Zuhörern ist die un-
gemein fein empfundene, ausdrucksvolle
Rückenfigur der hl. Thekla, der jungfräu-
lichen Schülerin Pauli mit der eleganten
Kleidung und dem vielbewunderten schö-
nen Nacken. Jm Vordergrunde rechts der
Abschied der bei den Apostelfürften
vor ihrem Martertod, links die Ent-
h auptung d es hl. P aulus. Wo das
abgeschlagene Havpt auf dem Boden auf-
springt, sehen wir (dem Bericht der Le-
gende entsprechend) drei Quellen sich auf-
tun. Der Abschiedsschmerz der beiden
Apostel ist mit Wärme geschildert, scharf
zugespitzt ist die Charakteristik des jungen
Burschen mit dem Federbarett, des inseinem Hand-
werk verrohten Henkers, der — eine trefflich be-
obachtete Bewegung — kaltblütig das Richtschwert
^) Den Klostcrfraucn von St.Kntharina war durch einen
Päpstlichen Erlast vcrstaltet ivorden, jenc Ablässe, die
sonst durch den Besuch dcr Hauptkirchcn („Basilikcn")
Roms erlangt iverden, daheim in ihrem Kloster zn ge-
ivinncn. Um der fromnien Phantasie Anhaltspunktc zu
gebcn, ließen die Nonnen in ihrem Kreuzgang bildliche
Darstellungcn jcncr Basilikcn und dcr darin besonders
gcfeierten Heiligen usiv. anbringen. So entstandcn die
>n der Augsburgcr Alalcrci eine so ivichtigc Rolle spie-
lenden „ B as i l i ken b il d c r
wieder einsteckt, und besonders des geschmeidigen
Kerls mit seinem Ausdruck diabolischer Verbissen-
heit, der St. Petrus zum Tode führt. Durch
diese ausgesprochen häßlichen, gemeinen Typen
soll nicht nur mehr Reichtum und Abwechslung
in die Darstellung kommen, sie sollen besonders
als Gegensatz wirken, gleichsam als tiefeSchatten,
von denen fich die edlen Charaktere um so leuch-
tender abheben.
Auf der linksseitigen Tafel der Paulusbasilika
schildert uns Holbein die Taufe des hl. Pau-
lus (Abb.35). Ganz naiv, ohne irgendwelche
archäologische Bedenken stellt er den Vorgang un-
gefähr so dar, wie er ihn gelegentlich etwa im Augs-
burger Dom bei der Taufe kleiner Kinder be-
obachtet hat. Der künftige Apostel steht entkleidet
in dem schöngeformten Taufbecken, vor ihm der
Priester, der mit dringlicher Aufmerksamkeit die
Zeremonien nach seinem Rituale vornimmt, da-
neben der Mesner mit der brennenden Kerze und
dem Chrisamgefäß. Der nackte Leib des Apostels
ist mit Naturwahrheit und Delikatesfe gebildet
und schimmert beherrschend aus dem satten Ko-
Abb. 30
H. Holbein d. Ä.. Der Bürgermeister Artzt von Augsburg. Silbcrstistzeichnung
(Text S. 24)