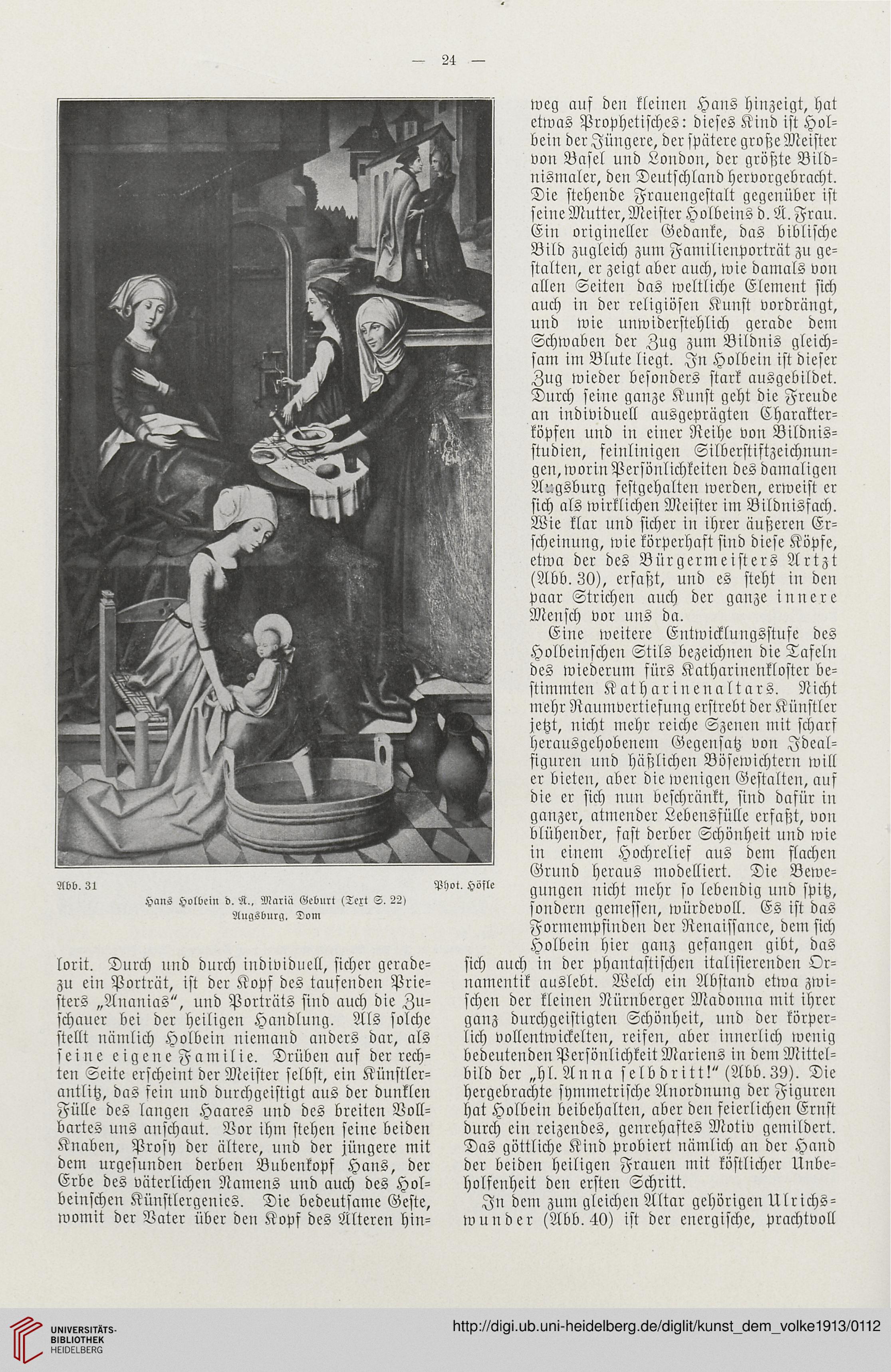24
Abb. 31
Hans Holbein d. Ä.. Mariä Gcbnrt (Text S. 22j
Augsburg. Dom
Phot. Hösle
lorit. Durch und durch iudividuell, sicher gerade-
zu ein Porträt, ist der Kopf des taufenden Prie-
sters „Ananias", und Porträts sind auch die Zu-
schauer bei der heiligen Handlung. Als solche
stellt nämlich Holbein niemand anders dar, als
seine eigeneFamilie. Drüben auf der rech-
ten Seite erscheint der Meister selbst, ein Künstler-
antlitz, das fein und durchgeistigt aus der dunklen
Fülle des langen Haares und des breiten Voll-
bartes uns anschaut. Vor ihm stehen seine beiden
Knaben, Prosy der ältere, und der jüngere mit
dem urgesunden derben Bubenkopf Hans, der
Erbe des üäterlichen Namens und auch des Hol-
beinschen Künstlergenies. Die bedeutsame Geste,
womit der Vater über den Kopf des Alteren hin-
weg auf den kleinen Hans hinzeigt, hat
etwas Prophetisches: dieses Kind ist Hol-
bein derJüngere, der spütere große Meister
von Basel und London, der größte Bild-
nismaler, den Deutschland hervorgebracht.
Die stehende Frauengestalt gegenüber ist
seineMutter,Meister Holbeins d. Ä. Frau.
Ein origineller Gedanke, das biblische
Bild zugleich zum Familienporträt zu ge-
stalten, er zeigt aber auch, wie damals von
allen Seiten das weltliche Element sich
auch in der religiösen Kunst vordrängt,
und wie unwiderstehlich gerade dem
Schwaben der Zug zum Bildnis gleich-
sam im Blute liegt. Jn Holbein ist dieser
Zug wieder besouders stark ausgebildet.
Durch seine ganze Kunst geht die Freude
an individuell ausgeprägten Charakter-
köpfen und in einer Reihe von Bildnis-
studien, feinlinigen Silberstiftzeichnun-
gen,worinPersönlichkeiten des damaligen
Augsburg festgehalten werden, erweist er
sich als wirklichen Meister im Bildnisfach.
Wie klar und sicher in ihrer außeren Er-
scheinung, wie körperhaft sind diese Köpfe,
etwa der des Bürgermeisters Artzt
(Abb. 30), erfaßt, und es steht in den
paar Strichen auch der ganze innere
Mensch vor uns da.
Eine weitere Entwicklungsstufe des
Holbeinschen Stils bezeichnen die Tafeln
des wiederum fürs Katharinenkloster be-
stimmten Kath arinenaltars. Nicht
mehr Raumvertiefung erstrebt der Künstler
jetzt, nicht mehr reiche Szenen mit scharf
herausgehobenem Gegensatz von Jdeal-
figuren und häßlichen Bösewichtern will
er bieten, aber die wenigen Gestalten, auf
die er sich nun beschränkt, sind dafür in
ganzer, atmender Lebensfülle erfaßt, von
blühender, fast derber Schönheit und wie
in einem Hochrelief aus dem slachen
Grund heraus modelliert. Die Bewe-
gungen nicht mehr so lebendig und spitz,
sondern gemessen, würdevoll. Es ist das
Formempftnden der Renaissanee, dem sich
Holbein hier ganz gefangen gibt, das
sich auch in der phantastischen italisierenden Or-
namentik auslebt. Welch ein Abstand etwa zwi-
schen der kleinen Nürnberger Madonna mit ihrer
ganz durchgeistigten Schönheit, und der körper-
lich vollentwickelten, reifen, aber innerlich wenig
bedeutenden Persönlichkeit Mariens in dem Mittel-
bild der „hl. Anna selb dritt!" (Abb.39). Die
hergebrachte symmetrische Anordnung der Figuren
hat Holbein beibehalten, aber den feierlichen Ernst
durch ein reizendes, genrehaftes Motiv gemildert.
Das göttliche Kind probiert nämlich an der Hand
der beiden heiligen Frauen mit köstlicher Unbe-
holfenheit den ersten Schritt.
Jn dem zum gleichen Altar gehörigen Ulrichs-
wunder (Abb. 40) ist der energische, prachtvoll
Abb. 31
Hans Holbein d. Ä.. Mariä Gcbnrt (Text S. 22j
Augsburg. Dom
Phot. Hösle
lorit. Durch und durch iudividuell, sicher gerade-
zu ein Porträt, ist der Kopf des taufenden Prie-
sters „Ananias", und Porträts sind auch die Zu-
schauer bei der heiligen Handlung. Als solche
stellt nämlich Holbein niemand anders dar, als
seine eigeneFamilie. Drüben auf der rech-
ten Seite erscheint der Meister selbst, ein Künstler-
antlitz, das fein und durchgeistigt aus der dunklen
Fülle des langen Haares und des breiten Voll-
bartes uns anschaut. Vor ihm stehen seine beiden
Knaben, Prosy der ältere, und der jüngere mit
dem urgesunden derben Bubenkopf Hans, der
Erbe des üäterlichen Namens und auch des Hol-
beinschen Künstlergenies. Die bedeutsame Geste,
womit der Vater über den Kopf des Alteren hin-
weg auf den kleinen Hans hinzeigt, hat
etwas Prophetisches: dieses Kind ist Hol-
bein derJüngere, der spütere große Meister
von Basel und London, der größte Bild-
nismaler, den Deutschland hervorgebracht.
Die stehende Frauengestalt gegenüber ist
seineMutter,Meister Holbeins d. Ä. Frau.
Ein origineller Gedanke, das biblische
Bild zugleich zum Familienporträt zu ge-
stalten, er zeigt aber auch, wie damals von
allen Seiten das weltliche Element sich
auch in der religiösen Kunst vordrängt,
und wie unwiderstehlich gerade dem
Schwaben der Zug zum Bildnis gleich-
sam im Blute liegt. Jn Holbein ist dieser
Zug wieder besouders stark ausgebildet.
Durch seine ganze Kunst geht die Freude
an individuell ausgeprägten Charakter-
köpfen und in einer Reihe von Bildnis-
studien, feinlinigen Silberstiftzeichnun-
gen,worinPersönlichkeiten des damaligen
Augsburg festgehalten werden, erweist er
sich als wirklichen Meister im Bildnisfach.
Wie klar und sicher in ihrer außeren Er-
scheinung, wie körperhaft sind diese Köpfe,
etwa der des Bürgermeisters Artzt
(Abb. 30), erfaßt, und es steht in den
paar Strichen auch der ganze innere
Mensch vor uns da.
Eine weitere Entwicklungsstufe des
Holbeinschen Stils bezeichnen die Tafeln
des wiederum fürs Katharinenkloster be-
stimmten Kath arinenaltars. Nicht
mehr Raumvertiefung erstrebt der Künstler
jetzt, nicht mehr reiche Szenen mit scharf
herausgehobenem Gegensatz von Jdeal-
figuren und häßlichen Bösewichtern will
er bieten, aber die wenigen Gestalten, auf
die er sich nun beschränkt, sind dafür in
ganzer, atmender Lebensfülle erfaßt, von
blühender, fast derber Schönheit und wie
in einem Hochrelief aus dem slachen
Grund heraus modelliert. Die Bewe-
gungen nicht mehr so lebendig und spitz,
sondern gemessen, würdevoll. Es ist das
Formempftnden der Renaissanee, dem sich
Holbein hier ganz gefangen gibt, das
sich auch in der phantastischen italisierenden Or-
namentik auslebt. Welch ein Abstand etwa zwi-
schen der kleinen Nürnberger Madonna mit ihrer
ganz durchgeistigten Schönheit, und der körper-
lich vollentwickelten, reifen, aber innerlich wenig
bedeutenden Persönlichkeit Mariens in dem Mittel-
bild der „hl. Anna selb dritt!" (Abb.39). Die
hergebrachte symmetrische Anordnung der Figuren
hat Holbein beibehalten, aber den feierlichen Ernst
durch ein reizendes, genrehaftes Motiv gemildert.
Das göttliche Kind probiert nämlich an der Hand
der beiden heiligen Frauen mit köstlicher Unbe-
holfenheit den ersten Schritt.
Jn dem zum gleichen Altar gehörigen Ulrichs-
wunder (Abb. 40) ist der energische, prachtvoll