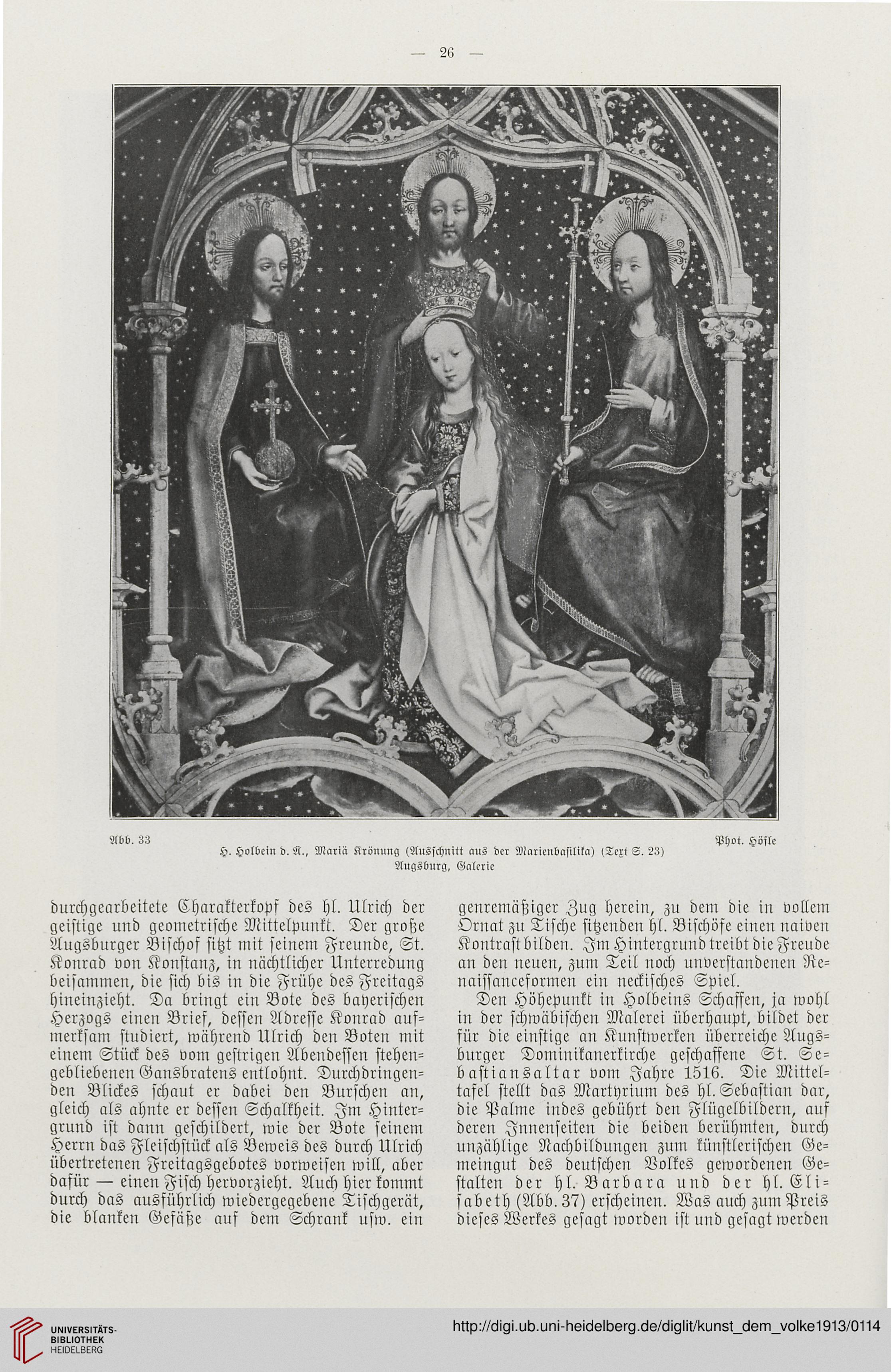26
Abb. 33 Phot. Hösle
H. Holbein d. Ä., Mariä Krönung (Ausschnitt ans dcr Maricnbasilika) lText S. 23)
Augsburg, Galcrie
durchgearbeitete Charakterkops des hl. Ulrich der
geistige und geometrische Mittelpunkt. Der große
Augsburger Bischof sitzt mit seinem Freunde, St.
Konrad von Konstanz, in nächtlicher Unterredung
beisammen, die sich bis in die Frühe des Freitags
hineinzieht. Da bringt ein Bote des bayerischen
Herzogs einen Brief, dessen Adresse Konrad auf-
merksam studiert, während Ulrich den Boten mit
einem Stück des vom gcstrigen Abendessen stehen-
gebliebenen Gansbratens entlohnt. Durchdringen-
den Blickes schaut er dabei den Burschen an,
gleich als ahnte er dessen Schalkheit. Jm Hinter-
grund ist dann geschildert, wie der Bote seinem
Herrn das Fleischstück als Beweis des durch Ulrich
übertretenen Freitagsgebotes vorweisen will, aber
dafür — einen Fisch hervorzieht. Auch hier kommt
durch das ausführlich wiedergegebene Tischgerät,
die blanken Gefäße auf dem Schrank usw. ein
genremäßiger Zug herein, zu dem die in vollem
Ornat zu Tische sitzenden hl. Bischöfe einen naiven
Kontrastbilden. Jm Hintergrund treibt die Freude
an den neuen, zum Teil noch unverstandenen Re-
naissanceformen ein neckisches Spiel.
Den Höhepunkt in Holbeins Schaffen, ja wohl
in der schwäbischen Malerei überhaupt, bildet der
für die einstige an Kunstwerken überreiche Augs-
burger Dominikanerkirche geschaffene St. Se-
bastiansaltar vom Jahre 1516. Die Mittel-
tafel stellt das Martyrium des hl. Sebastian dar,
die Palme indes gebührt den Flügelbildern, aus
deren Jnnenseiten die beiden berühmten, durch
unzählige Nachbildungen zum künstlerischen Ge-
meingut des deutschen Volkes gewordenen Ge-
stalten der hl. Barbara und der hl. Eli-
sab eth (Abb. 37) erscheinen. Was auch zum Preis
dieses Werkes gesagt worden ist und gesagt werden
Abb. 33 Phot. Hösle
H. Holbein d. Ä., Mariä Krönung (Ausschnitt ans dcr Maricnbasilika) lText S. 23)
Augsburg, Galcrie
durchgearbeitete Charakterkops des hl. Ulrich der
geistige und geometrische Mittelpunkt. Der große
Augsburger Bischof sitzt mit seinem Freunde, St.
Konrad von Konstanz, in nächtlicher Unterredung
beisammen, die sich bis in die Frühe des Freitags
hineinzieht. Da bringt ein Bote des bayerischen
Herzogs einen Brief, dessen Adresse Konrad auf-
merksam studiert, während Ulrich den Boten mit
einem Stück des vom gcstrigen Abendessen stehen-
gebliebenen Gansbratens entlohnt. Durchdringen-
den Blickes schaut er dabei den Burschen an,
gleich als ahnte er dessen Schalkheit. Jm Hinter-
grund ist dann geschildert, wie der Bote seinem
Herrn das Fleischstück als Beweis des durch Ulrich
übertretenen Freitagsgebotes vorweisen will, aber
dafür — einen Fisch hervorzieht. Auch hier kommt
durch das ausführlich wiedergegebene Tischgerät,
die blanken Gefäße auf dem Schrank usw. ein
genremäßiger Zug herein, zu dem die in vollem
Ornat zu Tische sitzenden hl. Bischöfe einen naiven
Kontrastbilden. Jm Hintergrund treibt die Freude
an den neuen, zum Teil noch unverstandenen Re-
naissanceformen ein neckisches Spiel.
Den Höhepunkt in Holbeins Schaffen, ja wohl
in der schwäbischen Malerei überhaupt, bildet der
für die einstige an Kunstwerken überreiche Augs-
burger Dominikanerkirche geschaffene St. Se-
bastiansaltar vom Jahre 1516. Die Mittel-
tafel stellt das Martyrium des hl. Sebastian dar,
die Palme indes gebührt den Flügelbildern, aus
deren Jnnenseiten die beiden berühmten, durch
unzählige Nachbildungen zum künstlerischen Ge-
meingut des deutschen Volkes gewordenen Ge-
stalten der hl. Barbara und der hl. Eli-
sab eth (Abb. 37) erscheinen. Was auch zum Preis
dieses Werkes gesagt worden ist und gesagt werden