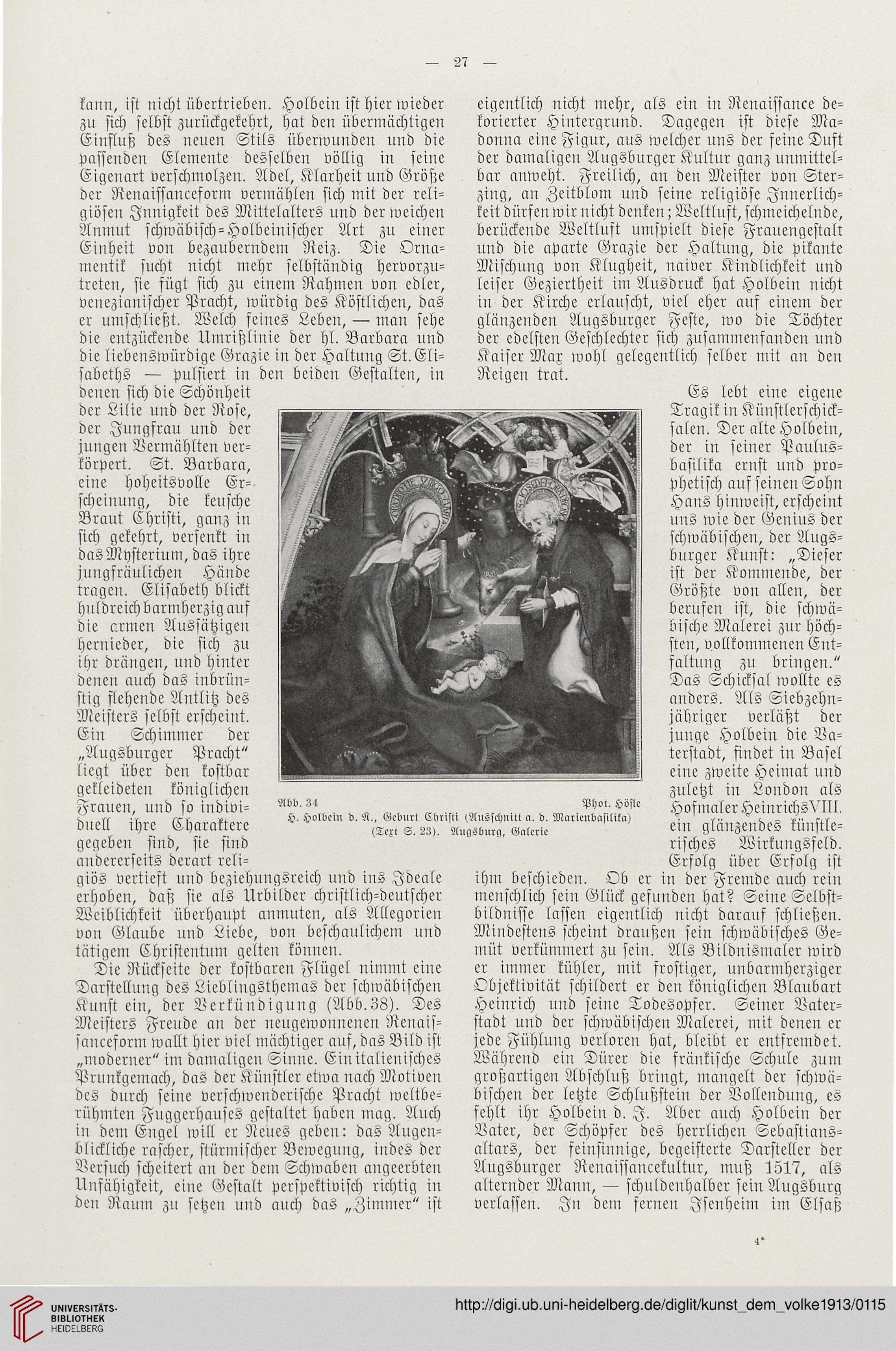27
kann, ist nicht übertrieben. Holbein ist hier wieder
zu sich selbst zurückgekehrt, hat den übermächtigen
Einfluß des neuen Stils überwunden und die
passenden Elemente desselben völlig in seine
Eigenart verschmolzen. Adel, Klarheit und Größe
der Renaissanceform vermählen sich mit der reli-
giösen Jnnigkeit des Mittelalters und der weichen
Anmut schwäbisch-Holbeinischer Art zu einer
Einheit von bezauberndem Reiz. Die Orna-
mentik sucht nicht mehr selbständig hervorzu-
treten, sie fügt sich zu einem Rahmen von edler,
venezianischer Pracht, würdig des Köstlichen, das
er umschließt. Welch feines Leben, — man sehe
die entzückende Umrißlinie der hl. Barbara und
die liebenswürdige Grazie in der Haltung St.Eli-
sabeths — pulsiert in den beiden Gestalten, in
denen sich die Schönheit
der Lilie und der Rose,
der Jungsrau und der
jungen Vermählten ver-
körpert. St. Barbara,
eine hoheitsvolle Er-
scheinung, die keusche
Braut Christi, ganz in
sich gekehrt, versenkt in
dasMysterium, das ihre
jungsräulichen Hände
tragen. Elisabeth blickt
huldreich barmherzig auf
die ermen Aussätzigen
hernieder, die sich zu
ihr drängen, und hinter
denen auch das inbrün-
stig flehende Antlitz des
Meisters selbst erscheint.
Ein Schimmer der
„Augsburger Pracht"
liegt über den kostbar
gekleideten königlichen
Frauen, und so indivi-
dnell ihre Charaktere
gegeben sind, sie sind
andererseits derart reli-
giös vertieft und beziehungsreich und ins Jdeale
erhoben, daß sie als Urbilder christlich-deutscher
Wciblichkeit überhaupt anmuten, als Allegorien
von Glaube und Liebe, von beschaulichem und
tätigem Christentum gelten können.
Die Rückseite der kostbaren Flügel nimmt eine
Darstellung des Lieblingsthemas der schwäbischen
Kunst ein, der Verkündigung (Abb.38). Des
Meisters Freude an der neugewonnenen Renais-
sanceform wallt hier viel mächtiger auf, das Bild ist
„moderner" im damaligen Sinne. Einitalienisches
Prunkgemach, das der Künstler etwa nach Motiven
des durch seine verschwenderische Pracht weltbe-
rühmten Fuggerhauses gestaltet habeu mag. Auch
in dem Eilgel will er Neues geben: das Augen-
blickliche rascher, stürmischer Bewegung, indes der
Versuch scheitert an der dem Schwaben angeerbten
Unfähigkeit, eine Gestalt perspektivisch richtig in
ben Raum zu setzen und auch das „Zimmer" ist
eigentlich nicht mehr, als ein in Renaissance de-
korierter Hintergrund. Dagegen ist diese Ma-
donna eine Figur, aus welcher uns der feine Duft
der damaligen Augsburger Kultur ganz unmittel-
bar anweht. Freilich, an den Meister von Ster-
zing, an Zeitblom und seine religiöse Jnnerlich-
keit dürsen wir nicht denken; Weltluft, schmeichelnde,
berückende Weltluft umspielt diese Frauengestall
und die aparte Grazie der Haltung, die pikante
Mischung von Klugheit, naiver Kindlichkeit und
leiser Geziertheit im Ausdruck hat Holbein nicht
in der Kirche erlauscht, viel eher auf einem der
glänzenden Augsburger Feste, wo die Töchter
der edelsten Geschlechter sich zusammenfanden und
Kaiser Max wohl gelegentlich selber mit an den
Reigen trat.
Es lebt eine eigene
Tragik in Künstlerschick-
salen. Der alte Holbein,
der in seiner Pcmlus-
basilika ernst und pro-
phetisch auf seinen Sohn
Hans hinweist, erscheint
uns wie der Genius der
schwäbischen, der Augs-
burger Kunst: „Dieser
ist der Kommende, der
Größte von allen, der
berufen ist, die schwä-
bische Malerei zur höch-
sten, vollkommenen Ent-
faltung zu bringen."
Das Schicksal wollte es
anders. Als Siebzehn-
jähriger verläßt der
junge Holbein die Va-
terstadt, findet in Basel
eine zweite Heimat und
zuletzt in London als
Hofmaler Heinrichs^'lll.
ein glänzendes künstle-
risches Wirkungsfeld.
Erfolg über Erfolg ist
ihm beschieden. Ob er in der Fremde auch rein
menschlich sein Glück gefunden hat? Seine Selbst-
bildnisse lassen eigentlich nicht darauf schließen.
Mindestens scheint draußen sein schwäbisches Ge-
niüt verkümmert zu seiu. Als Bildnismaler wird
er immer kühler, mit frostiger, uubarmherziger
Objektivitüt schildert er deu königlichen Blaubart
Heinrich und seine Todesopfer. Seiner Vater-
stadt und der schwäbischen Malerei, mit denen er
jede Fühlung verloren hat, bleiüt er entfremdet.
Während ein Dürer die fränkische Schule zum
großartigen Abschluß bringt, mangelt der schwä-
bischen der letzte Schlußstein der Vollendung, es
fehlt ihr Holbein d. I. Aber auch Holbein der
Vater, der Schöpfer des herrlichen Sebastians-
altars, der feinsinnige, begeisterte Darsteller der
Augsburger Renaissancekultur, muß 1517, als
alternder Mann, — schuldenhalber sein Augsburg
verlassen. Jn dem ferneu Jsenheim im Elsaß
4"
kann, ist nicht übertrieben. Holbein ist hier wieder
zu sich selbst zurückgekehrt, hat den übermächtigen
Einfluß des neuen Stils überwunden und die
passenden Elemente desselben völlig in seine
Eigenart verschmolzen. Adel, Klarheit und Größe
der Renaissanceform vermählen sich mit der reli-
giösen Jnnigkeit des Mittelalters und der weichen
Anmut schwäbisch-Holbeinischer Art zu einer
Einheit von bezauberndem Reiz. Die Orna-
mentik sucht nicht mehr selbständig hervorzu-
treten, sie fügt sich zu einem Rahmen von edler,
venezianischer Pracht, würdig des Köstlichen, das
er umschließt. Welch feines Leben, — man sehe
die entzückende Umrißlinie der hl. Barbara und
die liebenswürdige Grazie in der Haltung St.Eli-
sabeths — pulsiert in den beiden Gestalten, in
denen sich die Schönheit
der Lilie und der Rose,
der Jungsrau und der
jungen Vermählten ver-
körpert. St. Barbara,
eine hoheitsvolle Er-
scheinung, die keusche
Braut Christi, ganz in
sich gekehrt, versenkt in
dasMysterium, das ihre
jungsräulichen Hände
tragen. Elisabeth blickt
huldreich barmherzig auf
die ermen Aussätzigen
hernieder, die sich zu
ihr drängen, und hinter
denen auch das inbrün-
stig flehende Antlitz des
Meisters selbst erscheint.
Ein Schimmer der
„Augsburger Pracht"
liegt über den kostbar
gekleideten königlichen
Frauen, und so indivi-
dnell ihre Charaktere
gegeben sind, sie sind
andererseits derart reli-
giös vertieft und beziehungsreich und ins Jdeale
erhoben, daß sie als Urbilder christlich-deutscher
Wciblichkeit überhaupt anmuten, als Allegorien
von Glaube und Liebe, von beschaulichem und
tätigem Christentum gelten können.
Die Rückseite der kostbaren Flügel nimmt eine
Darstellung des Lieblingsthemas der schwäbischen
Kunst ein, der Verkündigung (Abb.38). Des
Meisters Freude an der neugewonnenen Renais-
sanceform wallt hier viel mächtiger auf, das Bild ist
„moderner" im damaligen Sinne. Einitalienisches
Prunkgemach, das der Künstler etwa nach Motiven
des durch seine verschwenderische Pracht weltbe-
rühmten Fuggerhauses gestaltet habeu mag. Auch
in dem Eilgel will er Neues geben: das Augen-
blickliche rascher, stürmischer Bewegung, indes der
Versuch scheitert an der dem Schwaben angeerbten
Unfähigkeit, eine Gestalt perspektivisch richtig in
ben Raum zu setzen und auch das „Zimmer" ist
eigentlich nicht mehr, als ein in Renaissance de-
korierter Hintergrund. Dagegen ist diese Ma-
donna eine Figur, aus welcher uns der feine Duft
der damaligen Augsburger Kultur ganz unmittel-
bar anweht. Freilich, an den Meister von Ster-
zing, an Zeitblom und seine religiöse Jnnerlich-
keit dürsen wir nicht denken; Weltluft, schmeichelnde,
berückende Weltluft umspielt diese Frauengestall
und die aparte Grazie der Haltung, die pikante
Mischung von Klugheit, naiver Kindlichkeit und
leiser Geziertheit im Ausdruck hat Holbein nicht
in der Kirche erlauscht, viel eher auf einem der
glänzenden Augsburger Feste, wo die Töchter
der edelsten Geschlechter sich zusammenfanden und
Kaiser Max wohl gelegentlich selber mit an den
Reigen trat.
Es lebt eine eigene
Tragik in Künstlerschick-
salen. Der alte Holbein,
der in seiner Pcmlus-
basilika ernst und pro-
phetisch auf seinen Sohn
Hans hinweist, erscheint
uns wie der Genius der
schwäbischen, der Augs-
burger Kunst: „Dieser
ist der Kommende, der
Größte von allen, der
berufen ist, die schwä-
bische Malerei zur höch-
sten, vollkommenen Ent-
faltung zu bringen."
Das Schicksal wollte es
anders. Als Siebzehn-
jähriger verläßt der
junge Holbein die Va-
terstadt, findet in Basel
eine zweite Heimat und
zuletzt in London als
Hofmaler Heinrichs^'lll.
ein glänzendes künstle-
risches Wirkungsfeld.
Erfolg über Erfolg ist
ihm beschieden. Ob er in der Fremde auch rein
menschlich sein Glück gefunden hat? Seine Selbst-
bildnisse lassen eigentlich nicht darauf schließen.
Mindestens scheint draußen sein schwäbisches Ge-
niüt verkümmert zu seiu. Als Bildnismaler wird
er immer kühler, mit frostiger, uubarmherziger
Objektivitüt schildert er deu königlichen Blaubart
Heinrich und seine Todesopfer. Seiner Vater-
stadt und der schwäbischen Malerei, mit denen er
jede Fühlung verloren hat, bleiüt er entfremdet.
Während ein Dürer die fränkische Schule zum
großartigen Abschluß bringt, mangelt der schwä-
bischen der letzte Schlußstein der Vollendung, es
fehlt ihr Holbein d. I. Aber auch Holbein der
Vater, der Schöpfer des herrlichen Sebastians-
altars, der feinsinnige, begeisterte Darsteller der
Augsburger Renaissancekultur, muß 1517, als
alternder Mann, — schuldenhalber sein Augsburg
verlassen. Jn dem ferneu Jsenheim im Elsaß
4"