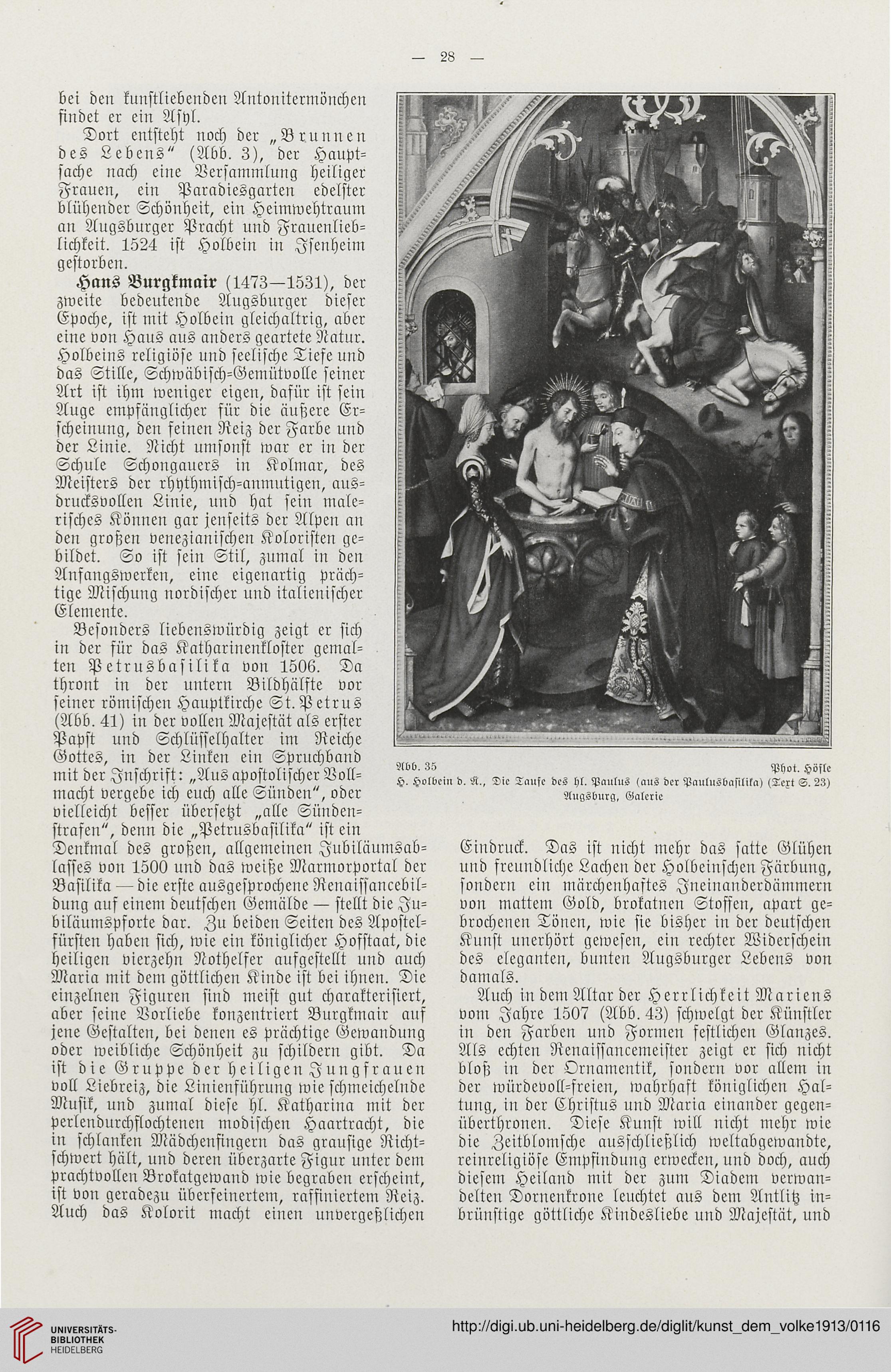28
bei den kunstliebenden Antonitermönchen
findet er ein Asyl.
Dort entsteht noch der „Brunnen
des Lebens" (Abb. 3), der Haupt-
sache nach eine Versammlung heiliger
Frauen, ein Paradiesgarten edelster
blühender Schönheit, ein Heimwehtraum
an Augsburger Pracht und Frauenlieb-
lichkeit. 1524 ist Holbein in Jsenheim
gestorben.
Hans Burgkmair (1473—1531), der
zweite bedeutende Augsburger dieser
Epoche, ist mit Holbein gleichaltrig, aber
eine von Haus aus anders geartete Natur.
Holbeins religiöse und seelische Tiefe und
das Stille, Schwäbisch-Gemütvolle seiner
Art ist ihm weniger eigen, dafür ist sein
Auge empfänglicher für die äußere Er-
scheinung, den feinen Reiz der Farbe und
der Linie. Nicht umsonst war er in der
Schule Schongauers in Kolmar, des
Meisters der rhythmisch-anmutigen, aus-
drucksvollen Linie, und hat sein male-
risches Können gar jenseits der Alpen an
den großen venezianischen Koloristen ge-
bildet. So ist sein Stil, zumal in den
Anfangswerken, eine eigenartig präch-
tige Mischung nordischer und italienischer
Elemente.
Besonders liebenswürdig zeigt er sich
in der für das Katharinenkloster gemal-
ten Petrusbasilika von 1506. Da
thront in der untern Bildhälfte vor
seiner römischen Hauptkirche St.Petrus
(Abb. 41) in der vollen Majestät als erster
Papst und Schlüsselhalter im Reiche
Gottes, in der Linken ein Spruchband
mit der Jnschrift: „Aus apostolischer Voll-
macht vergebe ich euch alle Sünden", oder
vielleicht besser übersetzt „alle Sünden-
strafen", denn die „Petrusbasilika" ist ein
Denkmal des großen, allgemeinen Jubiläumsab-
lasses von 1500 und das weiße Marmorportal der
Basilika — die erste ausgesprochene Renaissancebil-
dung auf einem deutschen Gemälde — stellt die Ju-
biläumspforte dar. Zu beiden Seiten des Apostel-
fürsten haben sich, wie ein königlicher Hosstaat, die
heiligen vierzehn Nothelfer aufgestellt und auch
Maria mit dem göttlichen Kinde ist bei ihnen. Die
einzelnen Figuren sind meist gut charakterisiert,
aber seine Vorliebe konzentriert Burgkmair auf
jene Gestalten, bei denen es prächtige Gewandung
oder weibliche Schönheit zu schildern gibt. Da
ist die Gruppe derheiligenJungfrauen
voll Liebreiz, die Linienführung wie schmeichelnde
Musik, und zumal diese hl. Katharina mit der
perlendurchflochtenen modischen Haartracht, die
in schlanken Mädchenfingern das grausige Richt-
schwert hält, und deren überzarte Figur unter dem
prachtvollen Brokatgewand wie begraben erscheint,
ist von geradezu überfeinertem, raffiniertem Reiz.
Auch das Kolorit macht einen unvergeßlichen
Abb. ss
H. Holbein
Phot. Hösle
d. Ä., Die Tcmfe des hl. Paulus (aus der Paulusbasilika) (Text S. 23)
Augsburg, Galerie
Eindruck. Das ist nicht mehr das satte Glühen
und sreundliche Lachen der Holbeinschen Färbung,
sondern ein märchenhaftes Jneinanderdämmern
von mattem Gold, brokatnen Stoffen, apart ge-
brochenen Tönen, wie sie bisher in der deutschen
Kunst unerhört gewesen, ein rechter Widerschein
des eleganten, bunten Augsburger Lebens von
damals.
Auch in dem Altar der Herrlichkeit Mariens
vom Jahre 1507 (Abb. 43) schwelgt der Künstler
in den Farben und Formen festlichen Glanzes.
Als echten Renaissancemeister zeigt er sich nicht
bloß in der Ornamentik, sondern vor allem in
der würdevoll-freien, wahrhaft königlichen Hal-
tung, in der Christus und Maria einander gegen-
überthronen. Diese Kunst will nicht mehr wie
die Zeitblomsche ausschließlich weltabgewandte,
reinreligiöse Empfindung erwecken, und doch, auch
diesem Heiland mit der zum Diadem verwan-
delten Dornenkrone keuchtet aus dem Antlitz in-
brünstige göttliche Kindesliebe und Majestät, und
bei den kunstliebenden Antonitermönchen
findet er ein Asyl.
Dort entsteht noch der „Brunnen
des Lebens" (Abb. 3), der Haupt-
sache nach eine Versammlung heiliger
Frauen, ein Paradiesgarten edelster
blühender Schönheit, ein Heimwehtraum
an Augsburger Pracht und Frauenlieb-
lichkeit. 1524 ist Holbein in Jsenheim
gestorben.
Hans Burgkmair (1473—1531), der
zweite bedeutende Augsburger dieser
Epoche, ist mit Holbein gleichaltrig, aber
eine von Haus aus anders geartete Natur.
Holbeins religiöse und seelische Tiefe und
das Stille, Schwäbisch-Gemütvolle seiner
Art ist ihm weniger eigen, dafür ist sein
Auge empfänglicher für die äußere Er-
scheinung, den feinen Reiz der Farbe und
der Linie. Nicht umsonst war er in der
Schule Schongauers in Kolmar, des
Meisters der rhythmisch-anmutigen, aus-
drucksvollen Linie, und hat sein male-
risches Können gar jenseits der Alpen an
den großen venezianischen Koloristen ge-
bildet. So ist sein Stil, zumal in den
Anfangswerken, eine eigenartig präch-
tige Mischung nordischer und italienischer
Elemente.
Besonders liebenswürdig zeigt er sich
in der für das Katharinenkloster gemal-
ten Petrusbasilika von 1506. Da
thront in der untern Bildhälfte vor
seiner römischen Hauptkirche St.Petrus
(Abb. 41) in der vollen Majestät als erster
Papst und Schlüsselhalter im Reiche
Gottes, in der Linken ein Spruchband
mit der Jnschrift: „Aus apostolischer Voll-
macht vergebe ich euch alle Sünden", oder
vielleicht besser übersetzt „alle Sünden-
strafen", denn die „Petrusbasilika" ist ein
Denkmal des großen, allgemeinen Jubiläumsab-
lasses von 1500 und das weiße Marmorportal der
Basilika — die erste ausgesprochene Renaissancebil-
dung auf einem deutschen Gemälde — stellt die Ju-
biläumspforte dar. Zu beiden Seiten des Apostel-
fürsten haben sich, wie ein königlicher Hosstaat, die
heiligen vierzehn Nothelfer aufgestellt und auch
Maria mit dem göttlichen Kinde ist bei ihnen. Die
einzelnen Figuren sind meist gut charakterisiert,
aber seine Vorliebe konzentriert Burgkmair auf
jene Gestalten, bei denen es prächtige Gewandung
oder weibliche Schönheit zu schildern gibt. Da
ist die Gruppe derheiligenJungfrauen
voll Liebreiz, die Linienführung wie schmeichelnde
Musik, und zumal diese hl. Katharina mit der
perlendurchflochtenen modischen Haartracht, die
in schlanken Mädchenfingern das grausige Richt-
schwert hält, und deren überzarte Figur unter dem
prachtvollen Brokatgewand wie begraben erscheint,
ist von geradezu überfeinertem, raffiniertem Reiz.
Auch das Kolorit macht einen unvergeßlichen
Abb. ss
H. Holbein
Phot. Hösle
d. Ä., Die Tcmfe des hl. Paulus (aus der Paulusbasilika) (Text S. 23)
Augsburg, Galerie
Eindruck. Das ist nicht mehr das satte Glühen
und sreundliche Lachen der Holbeinschen Färbung,
sondern ein märchenhaftes Jneinanderdämmern
von mattem Gold, brokatnen Stoffen, apart ge-
brochenen Tönen, wie sie bisher in der deutschen
Kunst unerhört gewesen, ein rechter Widerschein
des eleganten, bunten Augsburger Lebens von
damals.
Auch in dem Altar der Herrlichkeit Mariens
vom Jahre 1507 (Abb. 43) schwelgt der Künstler
in den Farben und Formen festlichen Glanzes.
Als echten Renaissancemeister zeigt er sich nicht
bloß in der Ornamentik, sondern vor allem in
der würdevoll-freien, wahrhaft königlichen Hal-
tung, in der Christus und Maria einander gegen-
überthronen. Diese Kunst will nicht mehr wie
die Zeitblomsche ausschließlich weltabgewandte,
reinreligiöse Empfindung erwecken, und doch, auch
diesem Heiland mit der zum Diadem verwan-
delten Dornenkrone keuchtet aus dem Antlitz in-
brünstige göttliche Kindesliebe und Majestät, und