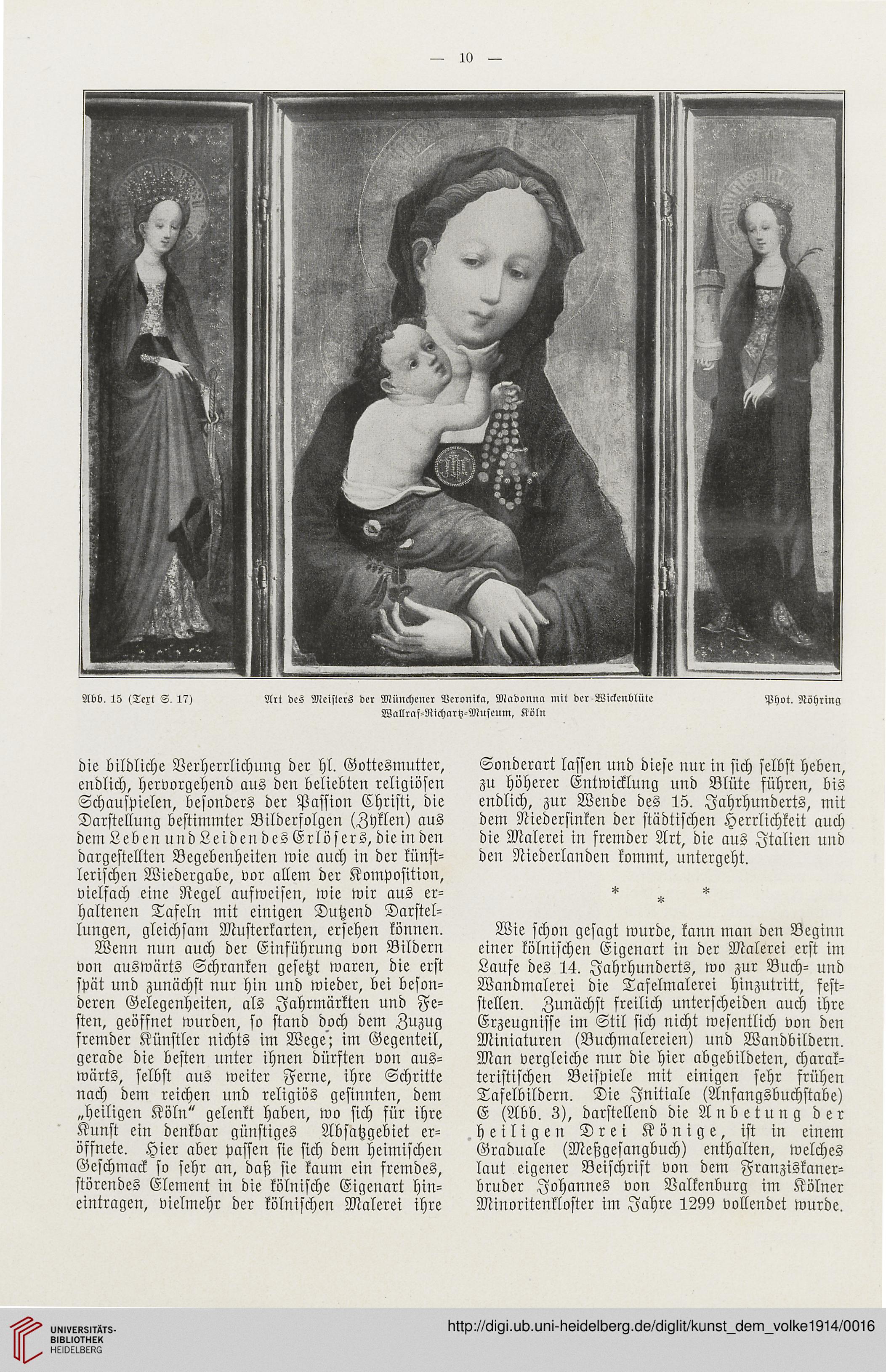10
Abb. 15 (Texl S. 17) Art des Meisters der Münchener Veronika, Madonna mit der Wickenblüte Phot. Nöhring
Wallraf-Nichartz-Musenm, Köln
die bildliche Verherrlichung der hl. Gottesmutter,
endlich, hervorgehend aus den beliebten religiösen
Schauspielen, besonders der Passion Christi, die
Darstellung bestimmter Bilderfolgen (Zyklen) aus
dem Leb en undLeidendesErlösers, diein den
dargestellten Begebenheiten wie auch in der künst-
lerischen Wiedergabe, vor allem der Komposition,
vielfach eine Regel aufweisen, wie wir aus er-
haltenen Tafeln mit einigen Dutzend Darstel-
lungen, gleichsam Musterkarten, ersehen können.
Wenn nun auch der Einführung von Bildern
von auswärts Schranken gesetzt waren, die erst
spät und zunächst nur hin und wieder, bei beson-
deren Gelegenheiten, als Jahrmärkten und Fe-
sten, geösfnet wurden, so stand doch dem Zuzug
fremder Künstler nichts im Wege'; im Gegenteil,
gerade die besten unter ihnen dürften von aus-
wärts, selbst aus weiter Ferne, ihre Schritte
nach dem reichen und religiös gesinnten, dem
„heiligen Köln" gelenkt haben, wo sich für ihre
Kunst ein denkbar günstiges Absatzgebiet er-
ösfnete. Hier aber passen sie sich dem heimischen
Geschmack so sehr an, daß sie kaum ein fremdes,
störendes Element in die kölnische Eigenart hin-
eintragen, vielmehr der kölnischen Malerei ihre
Sonderart lassen und diese nur in sich selbst heben,
zu höherer Entwicklung und Blüte führen, bis
endlich, zur Wende des 15. Jahrhunderts, mit
dem Niedersinken der städtischen Herrlichkeit auch
die Malerei in sremder Art, die aus Jtalien und
den Niederlanden kommt, untergeht.
-i- H
-!-
Wie schon gesagt wurde, kann man den Beginn
einer kölnischen Eigenart in der Malerei erst im
Laufe des 14. Jahrhunderts, wo zur Buch- und
Wandmalerei die Tafelmalerei hinzutritt, fest-
stellen. Zunächst freilich unterscheiden auch ihre
Erzeugnisse im Stil sich nicht wesentlich von den
Miniaturen (Buchmalereien) und Wandbildern.
Man vergleiche nur die hier abgebildeten, charak-
teristischen Beispiele mit einigen sehr frühen
Tafelbildern. Die Jnitiale (Anfangsbuchstabe)
E (Abb. 3), darstellend die Anbetung der
heiligen Drei Könige, ist in einem
Graduale (Meßgesangbuch) enthalten, welches
laut eigener Beischrift von dem Franziskaner-
bruder Johannes von Valkenburg im Kölner
Minoritenkloster im Jahre 1299 vollendet wurde.
Abb. 15 (Texl S. 17) Art des Meisters der Münchener Veronika, Madonna mit der Wickenblüte Phot. Nöhring
Wallraf-Nichartz-Musenm, Köln
die bildliche Verherrlichung der hl. Gottesmutter,
endlich, hervorgehend aus den beliebten religiösen
Schauspielen, besonders der Passion Christi, die
Darstellung bestimmter Bilderfolgen (Zyklen) aus
dem Leb en undLeidendesErlösers, diein den
dargestellten Begebenheiten wie auch in der künst-
lerischen Wiedergabe, vor allem der Komposition,
vielfach eine Regel aufweisen, wie wir aus er-
haltenen Tafeln mit einigen Dutzend Darstel-
lungen, gleichsam Musterkarten, ersehen können.
Wenn nun auch der Einführung von Bildern
von auswärts Schranken gesetzt waren, die erst
spät und zunächst nur hin und wieder, bei beson-
deren Gelegenheiten, als Jahrmärkten und Fe-
sten, geösfnet wurden, so stand doch dem Zuzug
fremder Künstler nichts im Wege'; im Gegenteil,
gerade die besten unter ihnen dürften von aus-
wärts, selbst aus weiter Ferne, ihre Schritte
nach dem reichen und religiös gesinnten, dem
„heiligen Köln" gelenkt haben, wo sich für ihre
Kunst ein denkbar günstiges Absatzgebiet er-
ösfnete. Hier aber passen sie sich dem heimischen
Geschmack so sehr an, daß sie kaum ein fremdes,
störendes Element in die kölnische Eigenart hin-
eintragen, vielmehr der kölnischen Malerei ihre
Sonderart lassen und diese nur in sich selbst heben,
zu höherer Entwicklung und Blüte führen, bis
endlich, zur Wende des 15. Jahrhunderts, mit
dem Niedersinken der städtischen Herrlichkeit auch
die Malerei in sremder Art, die aus Jtalien und
den Niederlanden kommt, untergeht.
-i- H
-!-
Wie schon gesagt wurde, kann man den Beginn
einer kölnischen Eigenart in der Malerei erst im
Laufe des 14. Jahrhunderts, wo zur Buch- und
Wandmalerei die Tafelmalerei hinzutritt, fest-
stellen. Zunächst freilich unterscheiden auch ihre
Erzeugnisse im Stil sich nicht wesentlich von den
Miniaturen (Buchmalereien) und Wandbildern.
Man vergleiche nur die hier abgebildeten, charak-
teristischen Beispiele mit einigen sehr frühen
Tafelbildern. Die Jnitiale (Anfangsbuchstabe)
E (Abb. 3), darstellend die Anbetung der
heiligen Drei Könige, ist in einem
Graduale (Meßgesangbuch) enthalten, welches
laut eigener Beischrift von dem Franziskaner-
bruder Johannes von Valkenburg im Kölner
Minoritenkloster im Jahre 1299 vollendet wurde.