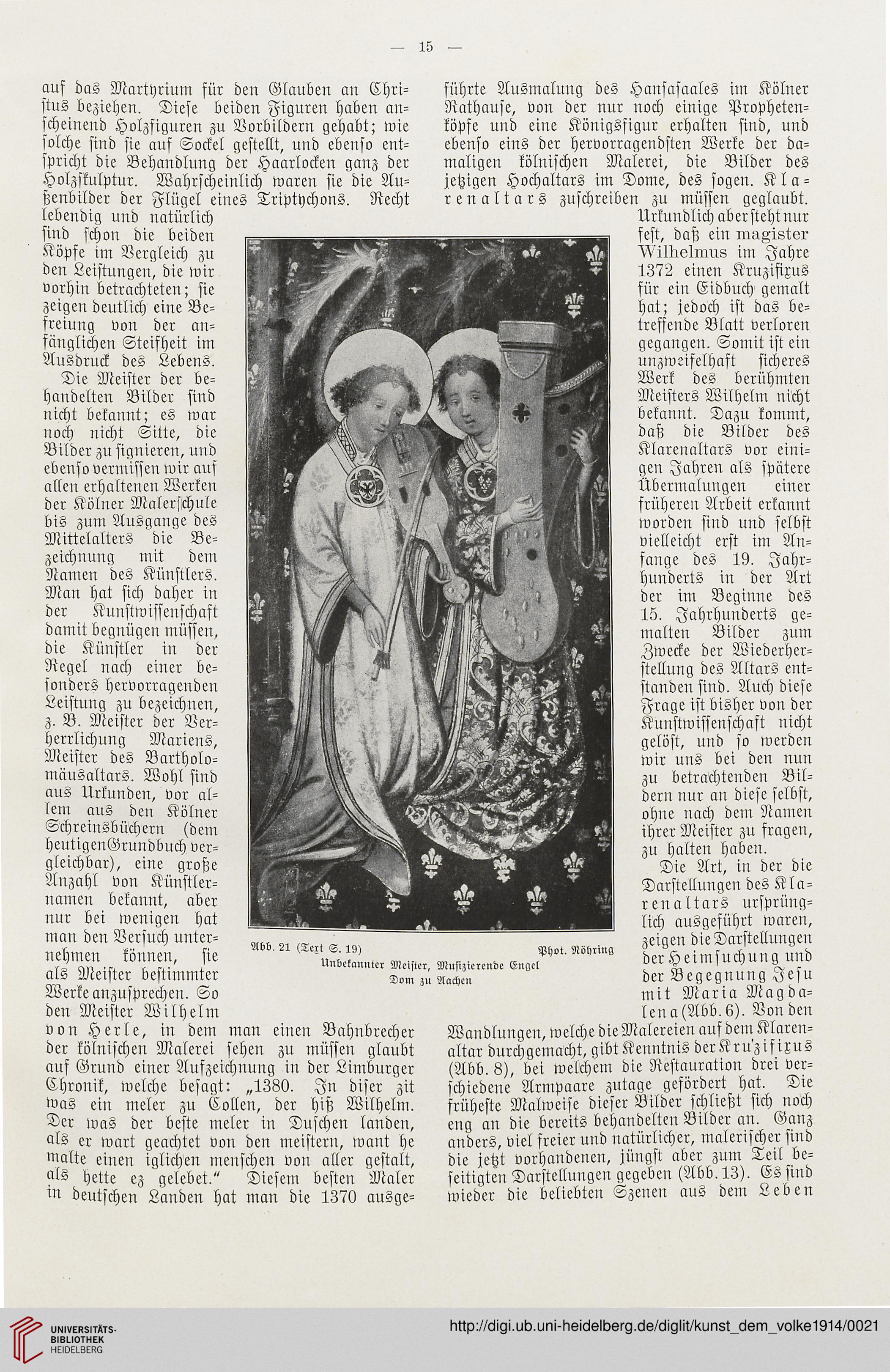15
auf das Martyrium für den Glauben an Chri-
stus beziehen. Diese beiden Figuren haben an-
scheinend Holzfiguren zu Vorbildern gehabt; wie
solche sind fie auf Sockel gestellt, und ebenso ent-
spricht die Behandlung der Haarlocken ganz der
Holzskulptur. Wahrscheinlich waren sie die Au-
ßenbilder der Flügel eines Triptychons. Recht
lebendig und natürlich
sind schon die beiden
Köpfe im Vergleich zu
den Leistungen, die wir
vorhin betrachteten; sie
zeigen deutlich eine Be-
freiung von der an-
fänglichen Steifheit im
Ausdruck des Lebens.
Die Meister der be-
handelten Bilder sind
nicht bekannt; es war
noch nicht Sitte, die
Bilder zu signieren, und
ebenso vermissen wir auf
allen erhaltenen Werken
der Kölner Malerschule
bis zum Ausgange des
Mittelalters die Be-
zeichnung mit dem
Namen des Künstlers.
Man hat sich daher in
der Kunstwissenschaft
damit begnügen müssen,
die Künstler in der
Regel nach einer be-
sonders hervorragenden
Leistung zu bezeichnen,
z. B. Meister der Ver-
Herrlichung Mariens,
Meister des Bartholo-
mäusaltars. Wohl sind
aus Urkunden, vor al-
lem aus den Kölner
Schreinsbüchern (dem
heutigenGrundbuch ver-
gleichbar), eine große
Anzahl von Künstler-
namen bekannt, aber
nur bei wenigen hat
man den Versuch unter-
nehmen können, sie
als Meister bestimmter
Werke anzusprechen. So
den Meister Wilhelm
vonHerle, in dem man einen Bahnbrecher
der kölnischen Malerei sehen zu müssen glaubt
auf Grund einer Aufzeichnung in der Limburger
Chronik, welche besagt: „1380. Jn diser zit
was ein meler zu Collen, der hiß Wilhelm.
Der was der beste meler in Duschen landen,
als er wart geachtet von den meistern, want he
malte einen iglichen menschen von aller gestalt,
aks hette ez gelebet." Diesem besten Maler
in deutschen Landen hat man die 1370 ausge-
führte Ausmalung des Hansasaales im Kölner
Rathause, von der nur noch einige Propheten-
köpfe und eine Königsfigur erhalten sind, und
ebenso eins der hervorragendsten Werke der da-
maligen kölnischen Malerei, die Bilder des
jetzigen Hochaltars im Dome, des sogen. Kla-
renaltars zuschreiben zu müssen geglaubt.
Urkundlich aberstehtnur
fest, daß ein ing.Alst6r
^illislniiis im Jahre
1372 einen Kruzifixus
für ein Eidbuch gemalt
hat; jedoch ist das be-
treffende Blatt verloren
gegangen. Somit ist ein
unzweifelhast sicheres
Werk des berühmten
Meisters Wilhelm nicht
bekannt. Dazu kommt,
daß die Bilder des
Klarenaltars vor eini-
gen Jahren als spätere
Übermalungen einer
früheren Arbeit erkannt
worden sind und selbst
vielleicht erst im An-
fange des 19. Jahr-
hunderts in der Art
der im Beginne des
15. Jahrhunderts ge-
malten Bilder zum
Zwecke der Wiederher-
stellung des Altars ent-
standen sind. Auch diese
Frage ist bisher von der
Kunstwissenschaft nicht
gelöst, und so werden
wir uns bei den nun
zu betrachtenden Bil-
dern nur an diese selbst,
ohne nach dem Namen
ihrer Meister zu fragen,
zu Halten haben.
Die Art, in der die
Darstellungen des Kla-
renaltars ursprüng-
lich ausgeführt waren,
zeigen dieDarstellungen
derHeimsuchung und
der Begegnung Jesu
mit Maria Magda-
lena(Abb.O). Von den
Wandlungen, welche die Malereien auf dem Klaren-
altar durchgemacht, gibt Kenntnis derKruzifixus
(Abb. 8), bei welchem die Restauration drei ver-
schiedene Armpaare zutage gefördert hat. Die
früheste Malweise dieser Bilder schließt sich noch
eng an die bereits behandelten Bilder an. Ganz
anders, viel freier und natürlicher, malerischer sind
die jetzt vorhandenen, jüngst aber zum Teil be-
seitigten Darstellungen gegeben (Abb. 13). Es stnd
wieder die beliebten Szenen aus dem Leben
Abb. 21 (Text S. 19) Phot. Nöhring
Unbekannter Meister, Musizierende Engel
Dom zu Aachcn
auf das Martyrium für den Glauben an Chri-
stus beziehen. Diese beiden Figuren haben an-
scheinend Holzfiguren zu Vorbildern gehabt; wie
solche sind fie auf Sockel gestellt, und ebenso ent-
spricht die Behandlung der Haarlocken ganz der
Holzskulptur. Wahrscheinlich waren sie die Au-
ßenbilder der Flügel eines Triptychons. Recht
lebendig und natürlich
sind schon die beiden
Köpfe im Vergleich zu
den Leistungen, die wir
vorhin betrachteten; sie
zeigen deutlich eine Be-
freiung von der an-
fänglichen Steifheit im
Ausdruck des Lebens.
Die Meister der be-
handelten Bilder sind
nicht bekannt; es war
noch nicht Sitte, die
Bilder zu signieren, und
ebenso vermissen wir auf
allen erhaltenen Werken
der Kölner Malerschule
bis zum Ausgange des
Mittelalters die Be-
zeichnung mit dem
Namen des Künstlers.
Man hat sich daher in
der Kunstwissenschaft
damit begnügen müssen,
die Künstler in der
Regel nach einer be-
sonders hervorragenden
Leistung zu bezeichnen,
z. B. Meister der Ver-
Herrlichung Mariens,
Meister des Bartholo-
mäusaltars. Wohl sind
aus Urkunden, vor al-
lem aus den Kölner
Schreinsbüchern (dem
heutigenGrundbuch ver-
gleichbar), eine große
Anzahl von Künstler-
namen bekannt, aber
nur bei wenigen hat
man den Versuch unter-
nehmen können, sie
als Meister bestimmter
Werke anzusprechen. So
den Meister Wilhelm
vonHerle, in dem man einen Bahnbrecher
der kölnischen Malerei sehen zu müssen glaubt
auf Grund einer Aufzeichnung in der Limburger
Chronik, welche besagt: „1380. Jn diser zit
was ein meler zu Collen, der hiß Wilhelm.
Der was der beste meler in Duschen landen,
als er wart geachtet von den meistern, want he
malte einen iglichen menschen von aller gestalt,
aks hette ez gelebet." Diesem besten Maler
in deutschen Landen hat man die 1370 ausge-
führte Ausmalung des Hansasaales im Kölner
Rathause, von der nur noch einige Propheten-
köpfe und eine Königsfigur erhalten sind, und
ebenso eins der hervorragendsten Werke der da-
maligen kölnischen Malerei, die Bilder des
jetzigen Hochaltars im Dome, des sogen. Kla-
renaltars zuschreiben zu müssen geglaubt.
Urkundlich aberstehtnur
fest, daß ein ing.Alst6r
^illislniiis im Jahre
1372 einen Kruzifixus
für ein Eidbuch gemalt
hat; jedoch ist das be-
treffende Blatt verloren
gegangen. Somit ist ein
unzweifelhast sicheres
Werk des berühmten
Meisters Wilhelm nicht
bekannt. Dazu kommt,
daß die Bilder des
Klarenaltars vor eini-
gen Jahren als spätere
Übermalungen einer
früheren Arbeit erkannt
worden sind und selbst
vielleicht erst im An-
fange des 19. Jahr-
hunderts in der Art
der im Beginne des
15. Jahrhunderts ge-
malten Bilder zum
Zwecke der Wiederher-
stellung des Altars ent-
standen sind. Auch diese
Frage ist bisher von der
Kunstwissenschaft nicht
gelöst, und so werden
wir uns bei den nun
zu betrachtenden Bil-
dern nur an diese selbst,
ohne nach dem Namen
ihrer Meister zu fragen,
zu Halten haben.
Die Art, in der die
Darstellungen des Kla-
renaltars ursprüng-
lich ausgeführt waren,
zeigen dieDarstellungen
derHeimsuchung und
der Begegnung Jesu
mit Maria Magda-
lena(Abb.O). Von den
Wandlungen, welche die Malereien auf dem Klaren-
altar durchgemacht, gibt Kenntnis derKruzifixus
(Abb. 8), bei welchem die Restauration drei ver-
schiedene Armpaare zutage gefördert hat. Die
früheste Malweise dieser Bilder schließt sich noch
eng an die bereits behandelten Bilder an. Ganz
anders, viel freier und natürlicher, malerischer sind
die jetzt vorhandenen, jüngst aber zum Teil be-
seitigten Darstellungen gegeben (Abb. 13). Es stnd
wieder die beliebten Szenen aus dem Leben
Abb. 21 (Text S. 19) Phot. Nöhring
Unbekannter Meister, Musizierende Engel
Dom zu Aachcn