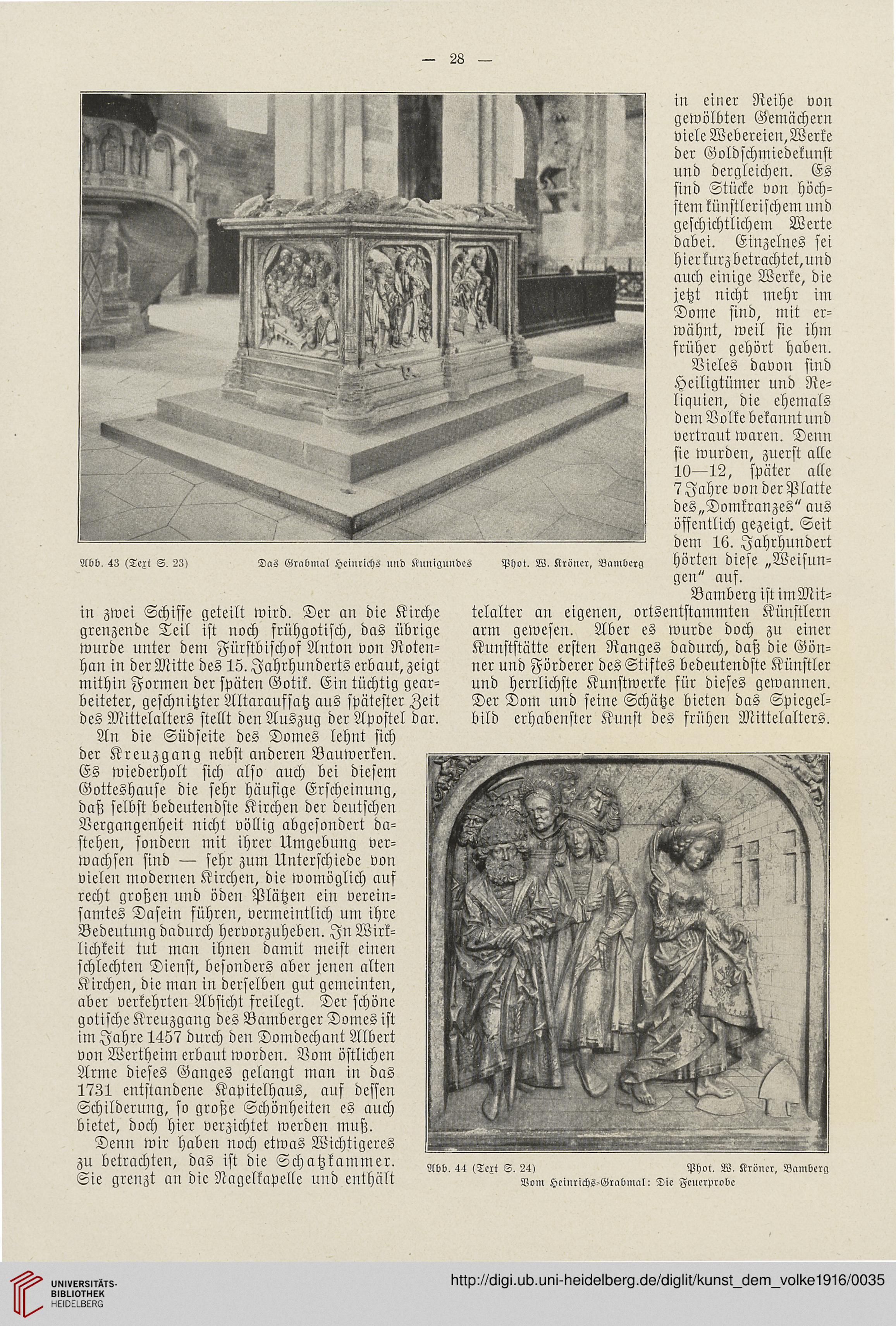28
Abb. 43 <Tcx1 S. 23>
Das Grabmal Hcinrlchs und Kunigundcs Phot. W. Kröner, Bambcrg
in zwei Schiffe geteilt wird. Der an die Kirche
grenzende Teil ist noch frühgotisch, das übrige
wurde unter dem Fürstbischof Anton von Roten-
han in derMitte des 15. Jahrhunderts erbaut, zeigt
mithin Formen der späten Gotik. Ein tüchtig gear-
beiteter, geschnitzter Altaraufsatz aus spätester Zeit
des Mittelalters stellt den Auszug der Apostel dar.
An die Südseite des Domes lehnt sich
der Kreuzgang nebst anderen Vauwcrken.
Es wiederholt sich also auch bei diesem
Gotteshause die sehr häufige Erscheinung,
daß selbst bedeutendste Kirchen der deutschen
Vergangenheit nicht völlig abgesondert da-
stehen, sondern mit ihrer Umgebung ver-
wachsen sind — sehr zum Unterschiede von
vielen modernen Kirchen, die womöglich auf
recht großen und öden Plätzen ein verein-
samtes Dasein führen, vermeintlich um ihre
Bedeutung dadurch hervorzuheben. Jn Wirk-
lichkeit tut man ihnen damit meist einen
schlechten Dienst, besonders aber jenen alten
Kirchen, die man in derselben gut gemeinten,
aber verkehrten Absicht freilegt. Der schöne
gotische Kreuzgang des Bamberger Domes ist
im Jahre 1457 durch den Domdechant Albert
von Wertheim erbaut worden. Vom östlichen
Arme dieses Ganges gelangt man in das
1731 entstandene Kapitelhaus, auf dessen
Schilderung, so große Schönheiten es auch
bietet, doch hier verzichtet werden muß.
Denn wir haben noch etwas Wichtigeres
zu betrachten, das ist die Schatzkammer.
Sie grenzt an die Nagelkapelle und enthält
in einer Reihe von
gewölbten Gemächern
viele Webereien, Werke
der Goldschmiedekunst
und dergleichen. Es
sind Stücke von höch-
stem künstlerischem und
geschichtlichem Werte
dabei. Einzelnes sei
h ier kurz b etrachtet, und
auch einige Werke, die
jetzt nicht mehr im
Dome sind, mit er-
wähnt, weil sie ihm
früher gehört haben.
Vieles davon sind
Heiligtümer und Re-
liquien, die ehemals
dem Volke bekannt und
vertraut waren. Denn
sie wurden, zuerst alle
10—12, später alle
7 Jahre von der Platte
des„Domkranzes" aus
öffentlich gezeigt. Seit
dem 16. Jahrhundert
hörten diese „Weisun-
gen" auf.
Bamberg ist imMit-
telalter an eigenen, ortsentstammten Künstlern
arm gewesen. Aber es wurde doch zu einer
Kunststätte ersten Ranges dadurch, daß die Gön-
ner und Förderer des Stiftes bedeutendste Künstler
und herrlichste Kunstwerke für dieses gewannen.
Der Dom und seine Schätze bieten das Spiegel-
bild erhabenster Kunst des frühen Mittelalters.
Abb. 44 <Tcxt S. 24>
Phot. W. Kröner, Bamberg
Vom Heinrichs-Grabmal: Die Fenerprobe
Abb. 43 <Tcx1 S. 23>
Das Grabmal Hcinrlchs und Kunigundcs Phot. W. Kröner, Bambcrg
in zwei Schiffe geteilt wird. Der an die Kirche
grenzende Teil ist noch frühgotisch, das übrige
wurde unter dem Fürstbischof Anton von Roten-
han in derMitte des 15. Jahrhunderts erbaut, zeigt
mithin Formen der späten Gotik. Ein tüchtig gear-
beiteter, geschnitzter Altaraufsatz aus spätester Zeit
des Mittelalters stellt den Auszug der Apostel dar.
An die Südseite des Domes lehnt sich
der Kreuzgang nebst anderen Vauwcrken.
Es wiederholt sich also auch bei diesem
Gotteshause die sehr häufige Erscheinung,
daß selbst bedeutendste Kirchen der deutschen
Vergangenheit nicht völlig abgesondert da-
stehen, sondern mit ihrer Umgebung ver-
wachsen sind — sehr zum Unterschiede von
vielen modernen Kirchen, die womöglich auf
recht großen und öden Plätzen ein verein-
samtes Dasein führen, vermeintlich um ihre
Bedeutung dadurch hervorzuheben. Jn Wirk-
lichkeit tut man ihnen damit meist einen
schlechten Dienst, besonders aber jenen alten
Kirchen, die man in derselben gut gemeinten,
aber verkehrten Absicht freilegt. Der schöne
gotische Kreuzgang des Bamberger Domes ist
im Jahre 1457 durch den Domdechant Albert
von Wertheim erbaut worden. Vom östlichen
Arme dieses Ganges gelangt man in das
1731 entstandene Kapitelhaus, auf dessen
Schilderung, so große Schönheiten es auch
bietet, doch hier verzichtet werden muß.
Denn wir haben noch etwas Wichtigeres
zu betrachten, das ist die Schatzkammer.
Sie grenzt an die Nagelkapelle und enthält
in einer Reihe von
gewölbten Gemächern
viele Webereien, Werke
der Goldschmiedekunst
und dergleichen. Es
sind Stücke von höch-
stem künstlerischem und
geschichtlichem Werte
dabei. Einzelnes sei
h ier kurz b etrachtet, und
auch einige Werke, die
jetzt nicht mehr im
Dome sind, mit er-
wähnt, weil sie ihm
früher gehört haben.
Vieles davon sind
Heiligtümer und Re-
liquien, die ehemals
dem Volke bekannt und
vertraut waren. Denn
sie wurden, zuerst alle
10—12, später alle
7 Jahre von der Platte
des„Domkranzes" aus
öffentlich gezeigt. Seit
dem 16. Jahrhundert
hörten diese „Weisun-
gen" auf.
Bamberg ist imMit-
telalter an eigenen, ortsentstammten Künstlern
arm gewesen. Aber es wurde doch zu einer
Kunststätte ersten Ranges dadurch, daß die Gön-
ner und Förderer des Stiftes bedeutendste Künstler
und herrlichste Kunstwerke für dieses gewannen.
Der Dom und seine Schätze bieten das Spiegel-
bild erhabenster Kunst des frühen Mittelalters.
Abb. 44 <Tcxt S. 24>
Phot. W. Kröner, Bamberg
Vom Heinrichs-Grabmal: Die Fenerprobe