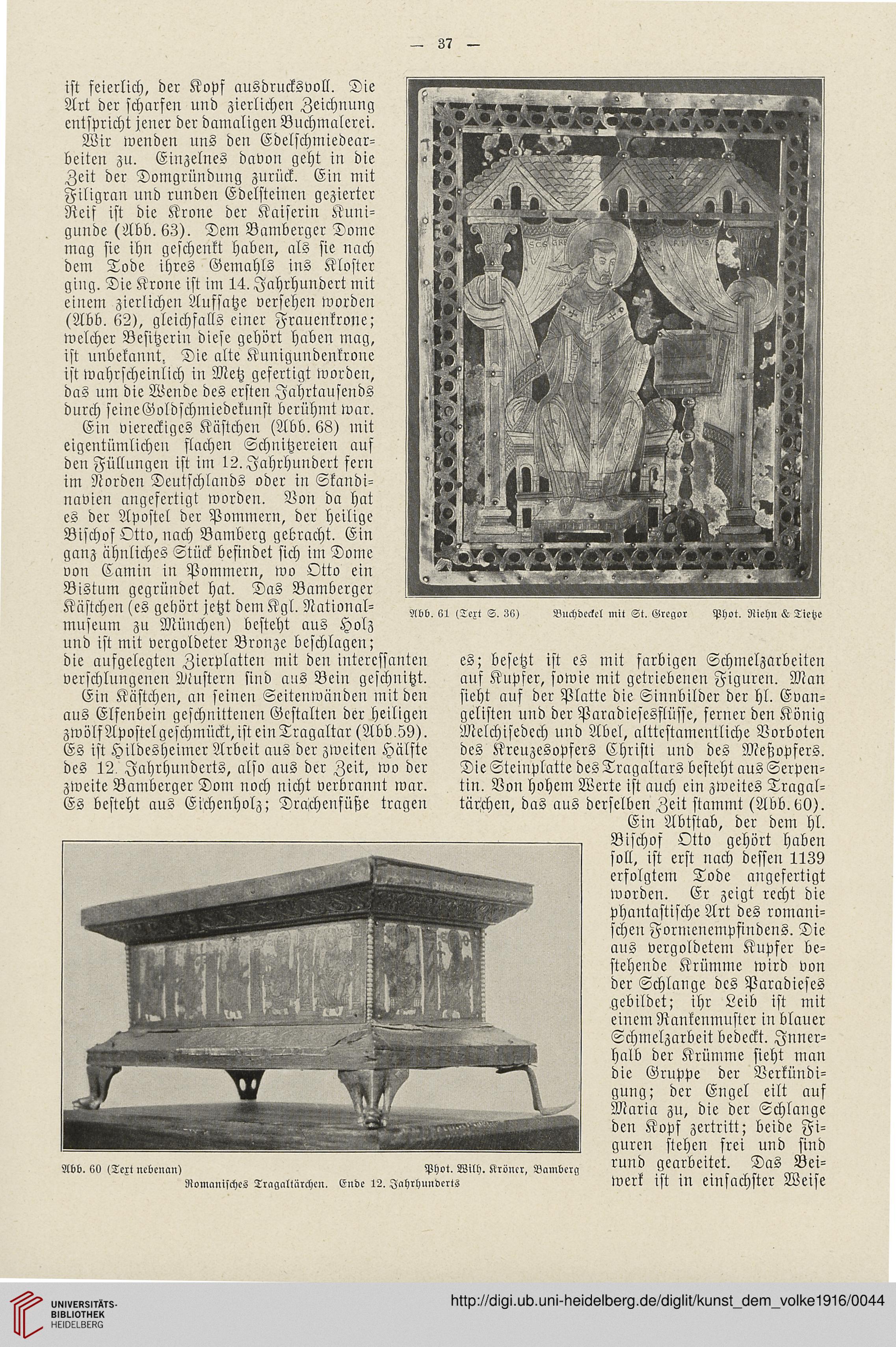37
ist feierlich, der Kopf ausdrucksvoll. Die
Art der scharfen und zierlichen Zeichnung
entspricht jener der damaligen Buchmalerei.
Wir wenden uns den Edelschmiedear-
beiten zu. Einzelnes davon geht in die
Zeit der Domgründung zurück. Ein mit
Filigran und runden Edelsteinen gezierter
Reif ist die Krone der Kaiserin Kuni-
gunde (Abb. 63). Dem Bamberger Dome
mag sie ihn geschenkt haben, als sie nach
dem Tode ihres Gemahls ins Kloster
ging. Die Krone ist im 14. Jahrhundert mit
einem zierlichen Aufsatze versehen worden
(Abb. 62), gleichfalls einer Frauenkrone;
welcher Besitzerin diese gehört haben mag,
ist unbekannt, Die alte Kunigundenkrone
ist wahrscheinlich in Metz gefertigt worden,
das um die Wende des ersten Jahrtausends
durch seineGoldschmiedekunst berühmt war.
Ein viereckiges Kästchen (Abb. 68) mit
eigentümlichen slachen Schnitzereien auf
den Füllungen ist im 12. Jahrhundert fern
im Norden Deutschlands oder in Skandi-
navien angefertigt worden. Bon da hat
es der Apostel der Pommern, der heilige
Bischof Otto, nach Bamberg gebracht. Ein
ganz ähnliches Stück befindet sich im Dome
von Camin in Pommern, wo Otto ein
Bistum gegründet hat. Das Bamberger
Kästchen (es gehört jetzt dem Kgl. National-
museum zu München) besteht aus Holz
und ist mit vergoldeter Bronze beschlagen;
die aufgelegten Zierplatten mit den interessanten
verschlungenen Mustern sind aus Bein geschnitzt.
Ein Kästchen, an seinen Seitenwänden mit den
aus Elfenbein geschnittenen Gcstalten der heiligen
zwölfApostelgeschmückt, isteinTragaltar (Abb.59).
Es ist Hildesheimer Arbeit aus der zweiten Hälfte
des 12. Jahrhunderts, also aus der Zeit, wo der
zweite Bamberger Dom noch nicht verbrannt war.
Es besteht aus Eichenholz; Drachenfüße tragen
Abb. 61 iText S. 36)
Buchdeckel mit St. Gregor Phot. Riehn L Tietze
Abb. 60 (Text nebenan)
Nomanisches Tragaltärchen. Ende 12. Jahrhunderts
es; besetzt ist es mit farbigen Schmelzarbeiten
auf Kupfer, sowie mit getriebenen Figuren. Man
sieht auf der Platte die Sinnbilder der hl. Evan-
gelisten und der Paradiesesflüsse, ferner den König
Melchisedech und Abel, alttestamentliche Vorboten
des Kreuzesopfers Christi und des Meßopfers.
Die Steinplatte des Tragaltars besteht aus Serpen-
tin. Von hohem Werte ist auch ein zweites Tragal-
tärchen, das aus derselben Zeit stammt (Abb.60).
Ein Abtstab, der dem hl.
Bischof Otto gehört haben
soll, ist erst nach dessen 1139
erfolgtem Tode angefertigt
worden. Er zeigt recht die
phantastische Art des romani-
schen Fornienempfindens. Die
aus vergoldetem Kupser be-
stehende Krümme wird von
der Schlange dcs Paradieses
gebildet; ihr Leib ist mit
einem Rankenmuster in blauer
Schmelzarbeit bedeckt. Jnner-
halb der Krümme sieht man
die Gruppe der Verkündi-
gung; der Engel eilt auf
Maria zu, die der Schlange
den Kopf zertritt; beide Fi-
guren stehen frei und sind
rund gearbeitet. Das Bei-
werk ist in einsachster Weise
Phot. Wilh. Kröncr, Bambcrg
ist feierlich, der Kopf ausdrucksvoll. Die
Art der scharfen und zierlichen Zeichnung
entspricht jener der damaligen Buchmalerei.
Wir wenden uns den Edelschmiedear-
beiten zu. Einzelnes davon geht in die
Zeit der Domgründung zurück. Ein mit
Filigran und runden Edelsteinen gezierter
Reif ist die Krone der Kaiserin Kuni-
gunde (Abb. 63). Dem Bamberger Dome
mag sie ihn geschenkt haben, als sie nach
dem Tode ihres Gemahls ins Kloster
ging. Die Krone ist im 14. Jahrhundert mit
einem zierlichen Aufsatze versehen worden
(Abb. 62), gleichfalls einer Frauenkrone;
welcher Besitzerin diese gehört haben mag,
ist unbekannt, Die alte Kunigundenkrone
ist wahrscheinlich in Metz gefertigt worden,
das um die Wende des ersten Jahrtausends
durch seineGoldschmiedekunst berühmt war.
Ein viereckiges Kästchen (Abb. 68) mit
eigentümlichen slachen Schnitzereien auf
den Füllungen ist im 12. Jahrhundert fern
im Norden Deutschlands oder in Skandi-
navien angefertigt worden. Bon da hat
es der Apostel der Pommern, der heilige
Bischof Otto, nach Bamberg gebracht. Ein
ganz ähnliches Stück befindet sich im Dome
von Camin in Pommern, wo Otto ein
Bistum gegründet hat. Das Bamberger
Kästchen (es gehört jetzt dem Kgl. National-
museum zu München) besteht aus Holz
und ist mit vergoldeter Bronze beschlagen;
die aufgelegten Zierplatten mit den interessanten
verschlungenen Mustern sind aus Bein geschnitzt.
Ein Kästchen, an seinen Seitenwänden mit den
aus Elfenbein geschnittenen Gcstalten der heiligen
zwölfApostelgeschmückt, isteinTragaltar (Abb.59).
Es ist Hildesheimer Arbeit aus der zweiten Hälfte
des 12. Jahrhunderts, also aus der Zeit, wo der
zweite Bamberger Dom noch nicht verbrannt war.
Es besteht aus Eichenholz; Drachenfüße tragen
Abb. 61 iText S. 36)
Buchdeckel mit St. Gregor Phot. Riehn L Tietze
Abb. 60 (Text nebenan)
Nomanisches Tragaltärchen. Ende 12. Jahrhunderts
es; besetzt ist es mit farbigen Schmelzarbeiten
auf Kupfer, sowie mit getriebenen Figuren. Man
sieht auf der Platte die Sinnbilder der hl. Evan-
gelisten und der Paradiesesflüsse, ferner den König
Melchisedech und Abel, alttestamentliche Vorboten
des Kreuzesopfers Christi und des Meßopfers.
Die Steinplatte des Tragaltars besteht aus Serpen-
tin. Von hohem Werte ist auch ein zweites Tragal-
tärchen, das aus derselben Zeit stammt (Abb.60).
Ein Abtstab, der dem hl.
Bischof Otto gehört haben
soll, ist erst nach dessen 1139
erfolgtem Tode angefertigt
worden. Er zeigt recht die
phantastische Art des romani-
schen Fornienempfindens. Die
aus vergoldetem Kupser be-
stehende Krümme wird von
der Schlange dcs Paradieses
gebildet; ihr Leib ist mit
einem Rankenmuster in blauer
Schmelzarbeit bedeckt. Jnner-
halb der Krümme sieht man
die Gruppe der Verkündi-
gung; der Engel eilt auf
Maria zu, die der Schlange
den Kopf zertritt; beide Fi-
guren stehen frei und sind
rund gearbeitet. Das Bei-
werk ist in einsachster Weise
Phot. Wilh. Kröncr, Bambcrg