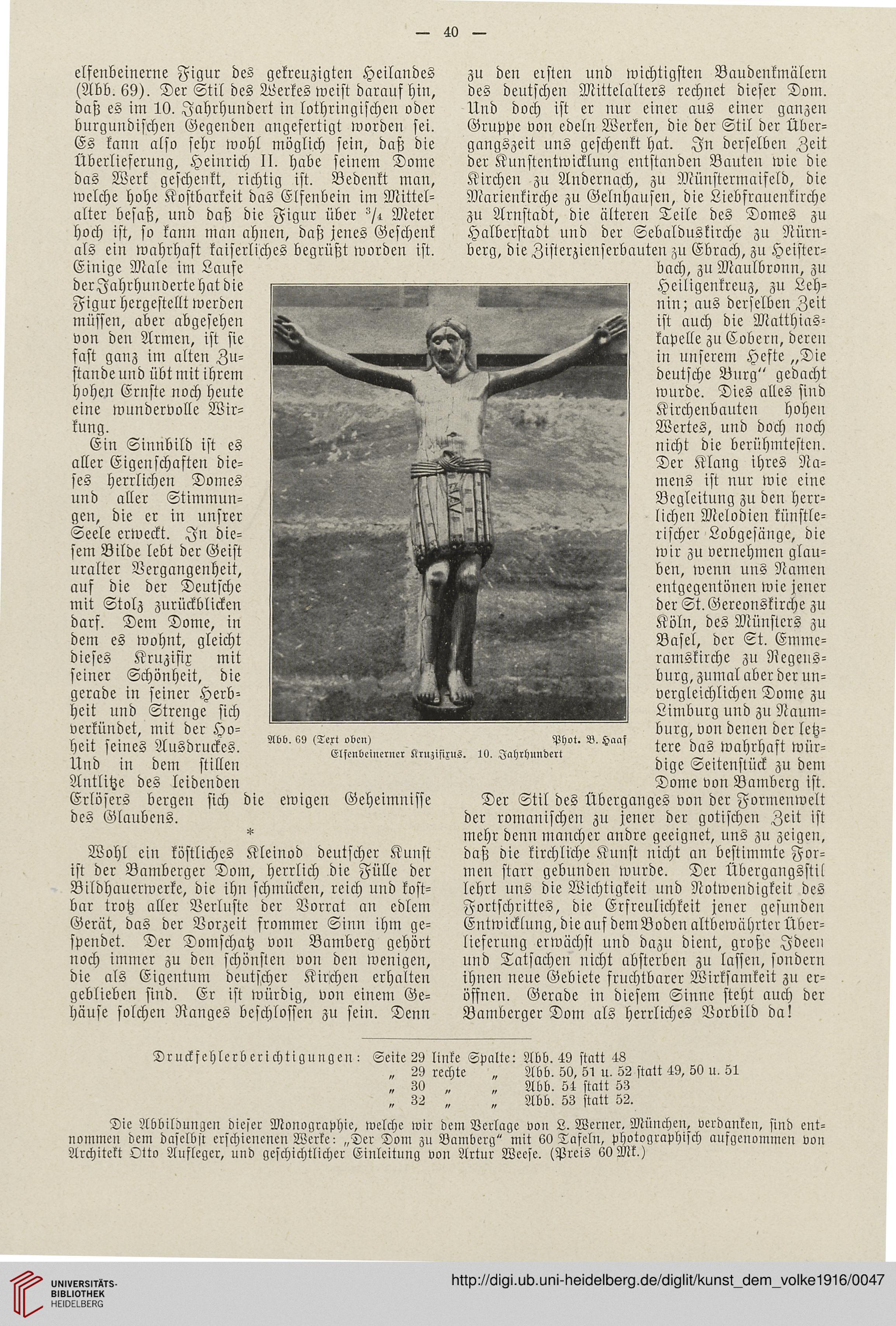40
elfenbeinerne Figur des gekreuzigten Heilandes
(Abb. 69). Der Stil des LÜerkes weist darauf hin,
daß es im 10. Jahrhundert in lothringischen oder
burgundifchen Gegenden angefertigt worden sei.
Es kann also sehr wohl möglich sein, daß die
Überlieferung, Heinrich II. habe seinem Dome
das Werk geschenkt, richtig ist. Bedenkt man,
welche hohe Kostbarkeit das Elfenbein im Mittel-
alter besaß, und daß die Figur über Meter
hoch ist, so kann man ahnen, daß jenes Geschenk
als ein wahrhaft kaiserliches begrüßt worden ist.
Einige Male im Laufe
derJahrhunvertehatdie
Figur hergestellt werden
müssen, aber abgesehen
von den Armen, ist sie
fast ganz im alten Zu-
stande und übt mit ihrem
hohen Ernste noch heute
eine wundervolle Wir-
kung.
Ein Sinnbild ist es
aller Eigenschaften die-
ses herrlichen Domes
und aller Stimmun-
gen, die er in unsrer
Seele erweckt. Jn die-
sem Bilde lebt der Geist
uralter Vergangenheit,
aus die der Deutsche
mit Stolz zurückblicken
darf. Dem Dome, in
dem es wohnt, gleicht
dieses Kruzifix mit
seiner Schönheit, die
gerade in seiner Herb-
heit und Strenge sich
verkündet, mit der Ho-
heit seines Ausdruckes.
Und in dem stillen
Antlitze des leidenden
Erlösers bergen sich die ewigen Geheimnisse
des Glaubens.
Wohl ein köstliches Kleinod deutscher Kunst
ist der Bamberger Dom, herrlich die Fülle der
Bildhauerwerke, die ihn schmücken, reich und kost-
bar trotz aller Verluste der Vorrat an edlem
Gerät, das der Vorzeit srommer Sinn ihm ge-
spendet. Der Domschatz von Bamberg gehört
noch immer zu den schönsten von den wenigen,
die als Eigentum deutscher Kirchen erhalten
geblieben sind. Er ist würdig, von einem Ge-
häuse solchen Ranges beschlossen zu sein. Denn
zu den eisten und wichtigsten Baudenkmalern
des deutschen Mittelalters rechnet dieser Dom.
Und doch ist er nur einer aus einer ganzen
Gruppe von edeln Werken, die der Stil der Über-
gangszeit uns geschenkt hat. Jn derselben Zeit
der Kunstentwicklung entstanden Bauten wie die
Kirchen zu Andernach, zu Münstermaifeld, die
Marienkirche zu Gelnhausen, die Liebfrauenkirche
zu Arnstadt, die älteren Teile des Domes zu
Halberstadt und der Sebalduskirche zu Nürn-
berg, die Zisterzienserbauten zu Ebrach, zu Heister-
bach, zu Maulbronn, zu
Heiligenkreuz, zu Leh-
nin; aus derselben Zeit
ist auch die Matthias-
kapelle zu Cobern, deren
in unserem Hefte „Die
deutsche Burg" gedacht
wurde. Dies alles sind
Kirchenbauten hohen
Wertes, und doch noch
nicht die berühmtesten.
Der Klang ihres Na-
mens ist nur wie eine
Bcgleitung zu den herr-
lichen Melodien künstle-
rischer Lobgesänge, die
wir zu vernehmen glau-
ben, wenn uns Namen
entgegentönen wie jener
der St. Gereonskirche zu
Köln, des Münsters zu
Basel, der St. Emme-
ramskirche zu Negens-
burg, zumal aber der un-
vergleichlichen Dome zu
Limburg und zu Naum-
burg, von denen der letz-
tere das wahrhaft wür-
dige Seitenstück zu dem
Dome von Bamberg ist.
Der Stil des Überganges von der Formenwelt
der romanischen zu jener der gotischen Zeit ist
mehr denn mancher andre geeignet, uns zu zeigen,
daß die kirchliche Kunst nicht an bestimmte For-
men starr gebunden wurde. Der Übergangsstil
lehrt uns die Wichtigkeit und Notwendigkeit des
Fortschrittes, die Erfreulichkeit jener gesunden
Entwicklung, die auf demBoden altbewährter Über-
lieferung erwächst und dazu dient, großc Jdeeu
und Tatsachen nicht absterben zu lassen, sondern
ihnen neue Gebiete fruchtbarer Wirksamkeit zu er-
öffnen. Gerade in diesem Sinne steht auch der
Bamberger Dom als herrliches Vorbild da!
Abb. 6g (Text oben) Phot. B. Haas
Elscnbeincrncr KruzifiruZ. 10. Jahrhundcrt
Druckfehlerberichtigungen i Seite 29 linke Spalte: Abb. 49 statt 48
„ 29 rechte „ Abb. 50, 51 u. 52 statt 49, 50 u. 51
„ 30 „ „ Abb. 54 statt 53
„ 32 „ „ Abb. 53 statt 52.
Die Abbildungen diesec Monographie, wclche wir dem Verlage oon L. Werner, München, verdanken, sind ent-
nommen dem daselbst erschienenen Wcrke i „Der Dom zu Bamberg" mit 60 Tafeln, photographisch aufgenommen von
Architekt Otto Aufleger, und geschichtlicher Einleitung von Artur Weese. (Preis 60 Mk.)
elfenbeinerne Figur des gekreuzigten Heilandes
(Abb. 69). Der Stil des LÜerkes weist darauf hin,
daß es im 10. Jahrhundert in lothringischen oder
burgundifchen Gegenden angefertigt worden sei.
Es kann also sehr wohl möglich sein, daß die
Überlieferung, Heinrich II. habe seinem Dome
das Werk geschenkt, richtig ist. Bedenkt man,
welche hohe Kostbarkeit das Elfenbein im Mittel-
alter besaß, und daß die Figur über Meter
hoch ist, so kann man ahnen, daß jenes Geschenk
als ein wahrhaft kaiserliches begrüßt worden ist.
Einige Male im Laufe
derJahrhunvertehatdie
Figur hergestellt werden
müssen, aber abgesehen
von den Armen, ist sie
fast ganz im alten Zu-
stande und übt mit ihrem
hohen Ernste noch heute
eine wundervolle Wir-
kung.
Ein Sinnbild ist es
aller Eigenschaften die-
ses herrlichen Domes
und aller Stimmun-
gen, die er in unsrer
Seele erweckt. Jn die-
sem Bilde lebt der Geist
uralter Vergangenheit,
aus die der Deutsche
mit Stolz zurückblicken
darf. Dem Dome, in
dem es wohnt, gleicht
dieses Kruzifix mit
seiner Schönheit, die
gerade in seiner Herb-
heit und Strenge sich
verkündet, mit der Ho-
heit seines Ausdruckes.
Und in dem stillen
Antlitze des leidenden
Erlösers bergen sich die ewigen Geheimnisse
des Glaubens.
Wohl ein köstliches Kleinod deutscher Kunst
ist der Bamberger Dom, herrlich die Fülle der
Bildhauerwerke, die ihn schmücken, reich und kost-
bar trotz aller Verluste der Vorrat an edlem
Gerät, das der Vorzeit srommer Sinn ihm ge-
spendet. Der Domschatz von Bamberg gehört
noch immer zu den schönsten von den wenigen,
die als Eigentum deutscher Kirchen erhalten
geblieben sind. Er ist würdig, von einem Ge-
häuse solchen Ranges beschlossen zu sein. Denn
zu den eisten und wichtigsten Baudenkmalern
des deutschen Mittelalters rechnet dieser Dom.
Und doch ist er nur einer aus einer ganzen
Gruppe von edeln Werken, die der Stil der Über-
gangszeit uns geschenkt hat. Jn derselben Zeit
der Kunstentwicklung entstanden Bauten wie die
Kirchen zu Andernach, zu Münstermaifeld, die
Marienkirche zu Gelnhausen, die Liebfrauenkirche
zu Arnstadt, die älteren Teile des Domes zu
Halberstadt und der Sebalduskirche zu Nürn-
berg, die Zisterzienserbauten zu Ebrach, zu Heister-
bach, zu Maulbronn, zu
Heiligenkreuz, zu Leh-
nin; aus derselben Zeit
ist auch die Matthias-
kapelle zu Cobern, deren
in unserem Hefte „Die
deutsche Burg" gedacht
wurde. Dies alles sind
Kirchenbauten hohen
Wertes, und doch noch
nicht die berühmtesten.
Der Klang ihres Na-
mens ist nur wie eine
Bcgleitung zu den herr-
lichen Melodien künstle-
rischer Lobgesänge, die
wir zu vernehmen glau-
ben, wenn uns Namen
entgegentönen wie jener
der St. Gereonskirche zu
Köln, des Münsters zu
Basel, der St. Emme-
ramskirche zu Negens-
burg, zumal aber der un-
vergleichlichen Dome zu
Limburg und zu Naum-
burg, von denen der letz-
tere das wahrhaft wür-
dige Seitenstück zu dem
Dome von Bamberg ist.
Der Stil des Überganges von der Formenwelt
der romanischen zu jener der gotischen Zeit ist
mehr denn mancher andre geeignet, uns zu zeigen,
daß die kirchliche Kunst nicht an bestimmte For-
men starr gebunden wurde. Der Übergangsstil
lehrt uns die Wichtigkeit und Notwendigkeit des
Fortschrittes, die Erfreulichkeit jener gesunden
Entwicklung, die auf demBoden altbewährter Über-
lieferung erwächst und dazu dient, großc Jdeeu
und Tatsachen nicht absterben zu lassen, sondern
ihnen neue Gebiete fruchtbarer Wirksamkeit zu er-
öffnen. Gerade in diesem Sinne steht auch der
Bamberger Dom als herrliches Vorbild da!
Abb. 6g (Text oben) Phot. B. Haas
Elscnbeincrncr KruzifiruZ. 10. Jahrhundcrt
Druckfehlerberichtigungen i Seite 29 linke Spalte: Abb. 49 statt 48
„ 29 rechte „ Abb. 50, 51 u. 52 statt 49, 50 u. 51
„ 30 „ „ Abb. 54 statt 53
„ 32 „ „ Abb. 53 statt 52.
Die Abbildungen diesec Monographie, wclche wir dem Verlage oon L. Werner, München, verdanken, sind ent-
nommen dem daselbst erschienenen Wcrke i „Der Dom zu Bamberg" mit 60 Tafeln, photographisch aufgenommen von
Architekt Otto Aufleger, und geschichtlicher Einleitung von Artur Weese. (Preis 60 Mk.)