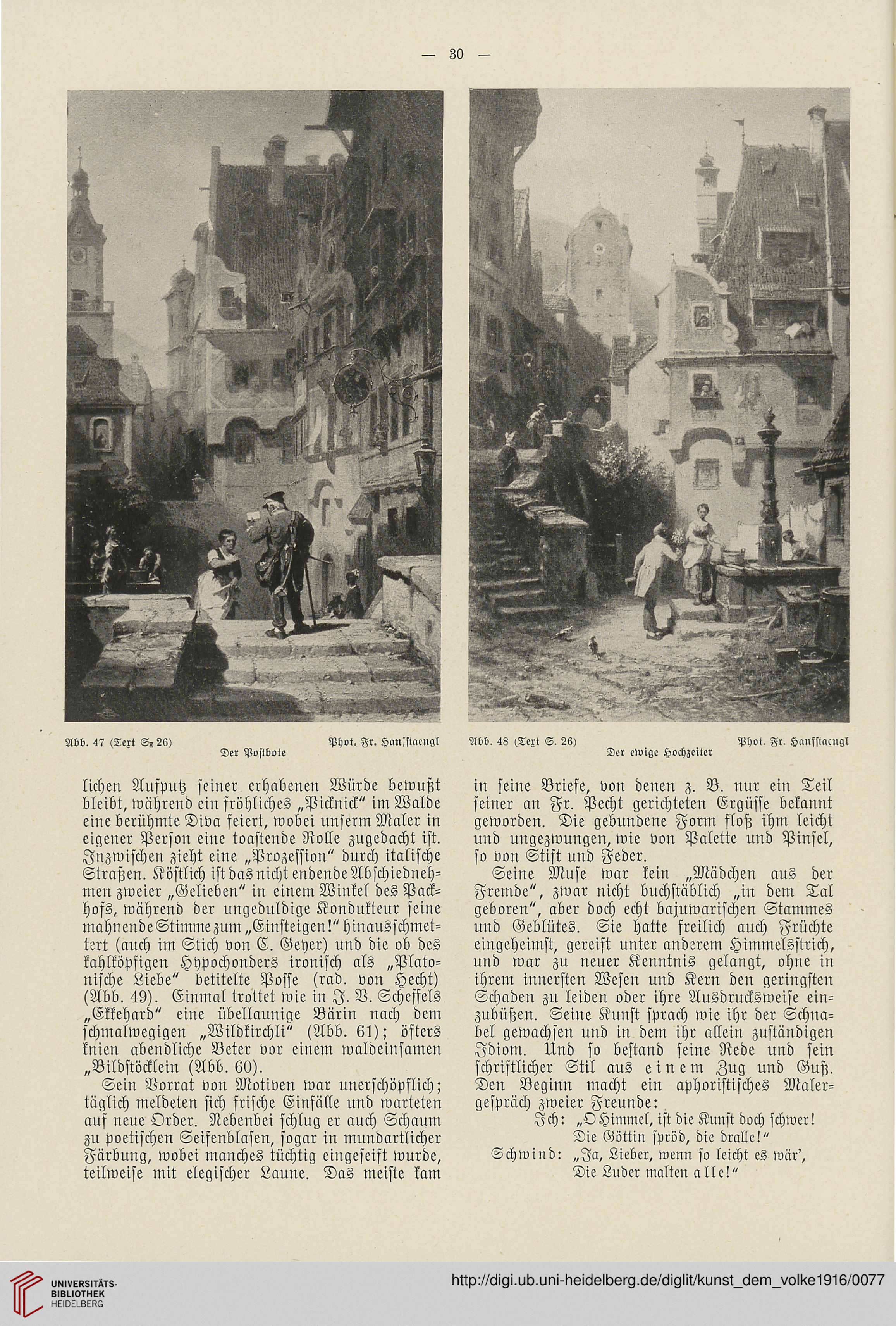30
Abb. 47 (Text S- 26) Phot. Fr. Hanlstaengl
Der Postbole
lichen Aufputz seiner erhabenen Würde bewußt
bleibt, während ein fröhliches „Picknick" im Walde
eine berühmte Diva feiert, wobei unserm Maler in
eigener Person eine toastende Rolle zugedacht ist.
Jnzwischen zieht eine „Prozession" durch italische
Straßen. Köstlich istdas nicht endendeAbschiedneh-
men zweier „Gelieben" in einem Winkel des Pack-
hofs, während der ungeduldige Kondukteur seine
mahnendeStimmezum„Einsteigen!"hinausschmet-
tert (auch im Stich von C. Geyer) und die ob des
kahlköpfigen Hypochonders ironisch als „Plato-
nische Liebe" betitelte Posse (rad. von Hecht)
(Abb. 49). Einmal trottet wie in I. V. Scheffels
„Ekkehard" eine übellaunige Bärin nach dem
schmalwegigen „Wildkirchli" (Abb. 6t); öfters
knien abendliche Beter vor einem waldeinsamen
„Bildstöcklein (Abb. 60).
Sein Vorrat von Motiven war unerschöpflich;
täglich meldeten sich frische Einfälle und warteten
auf neue Order. Nebenbei schlug er auch Schaum
zu poetischen Seifenblasen, sogar in mundartlicher
Färbung, wobei manches tüchtig eingeseift wurde,
teilweise mit elegischer Laune. Das meiste kam
Abb. 48 (Text S. 26) Phot. Fr. Hanfstacngl
Der ewige Hochzeiter
in seine Briefe, von denen z. B. nur ein Teil
seiner an Fr. Pecht gerichteten Ergüsse bekannt
geworden. Die gebundene Form floß ihm leicht
und ungezwungen, wie von Palette und Pinsel,
so von Stift und Feder.
Seine Muse war kein „Mädchen aus der
Fremde", zwar nicht buchstäblich „in dem Tal
geboren", aber doch echt bajuwarischen Stammes
und Geblütes. Sie hatte freilich auch Früchte
eingeheimst, gereist unter anderem Himmelsstrich,
und war zu neuer Kenntnis gelangt, ohne in
ihrem innersten Wesen und Kern den geringsten
Schaden zu leiden oder ihre Ausdrucksweise ein-
zubüßen. Seine Kunst sprach wie ihr der Schna-
bel gewachsen und in dem ihr allein zuständigen
Jdiom. Und so bestand seine Rede und sein
schriftlicher Stil aus einem Zug und Guß.
Den Beginn macht ein aphoristisches Maler-
gespräch zweier Freunde:
Jch: „OHimmel, ist die Kunst doch schwer!
Die Göttin spröd, die dralle!"
Schwind: „Ja, Lieber, wenn so leicht es wär',
Die Luder malten alle!"
Abb. 47 (Text S- 26) Phot. Fr. Hanlstaengl
Der Postbole
lichen Aufputz seiner erhabenen Würde bewußt
bleibt, während ein fröhliches „Picknick" im Walde
eine berühmte Diva feiert, wobei unserm Maler in
eigener Person eine toastende Rolle zugedacht ist.
Jnzwischen zieht eine „Prozession" durch italische
Straßen. Köstlich istdas nicht endendeAbschiedneh-
men zweier „Gelieben" in einem Winkel des Pack-
hofs, während der ungeduldige Kondukteur seine
mahnendeStimmezum„Einsteigen!"hinausschmet-
tert (auch im Stich von C. Geyer) und die ob des
kahlköpfigen Hypochonders ironisch als „Plato-
nische Liebe" betitelte Posse (rad. von Hecht)
(Abb. 49). Einmal trottet wie in I. V. Scheffels
„Ekkehard" eine übellaunige Bärin nach dem
schmalwegigen „Wildkirchli" (Abb. 6t); öfters
knien abendliche Beter vor einem waldeinsamen
„Bildstöcklein (Abb. 60).
Sein Vorrat von Motiven war unerschöpflich;
täglich meldeten sich frische Einfälle und warteten
auf neue Order. Nebenbei schlug er auch Schaum
zu poetischen Seifenblasen, sogar in mundartlicher
Färbung, wobei manches tüchtig eingeseift wurde,
teilweise mit elegischer Laune. Das meiste kam
Abb. 48 (Text S. 26) Phot. Fr. Hanfstacngl
Der ewige Hochzeiter
in seine Briefe, von denen z. B. nur ein Teil
seiner an Fr. Pecht gerichteten Ergüsse bekannt
geworden. Die gebundene Form floß ihm leicht
und ungezwungen, wie von Palette und Pinsel,
so von Stift und Feder.
Seine Muse war kein „Mädchen aus der
Fremde", zwar nicht buchstäblich „in dem Tal
geboren", aber doch echt bajuwarischen Stammes
und Geblütes. Sie hatte freilich auch Früchte
eingeheimst, gereist unter anderem Himmelsstrich,
und war zu neuer Kenntnis gelangt, ohne in
ihrem innersten Wesen und Kern den geringsten
Schaden zu leiden oder ihre Ausdrucksweise ein-
zubüßen. Seine Kunst sprach wie ihr der Schna-
bel gewachsen und in dem ihr allein zuständigen
Jdiom. Und so bestand seine Rede und sein
schriftlicher Stil aus einem Zug und Guß.
Den Beginn macht ein aphoristisches Maler-
gespräch zweier Freunde:
Jch: „OHimmel, ist die Kunst doch schwer!
Die Göttin spröd, die dralle!"
Schwind: „Ja, Lieber, wenn so leicht es wär',
Die Luder malten alle!"