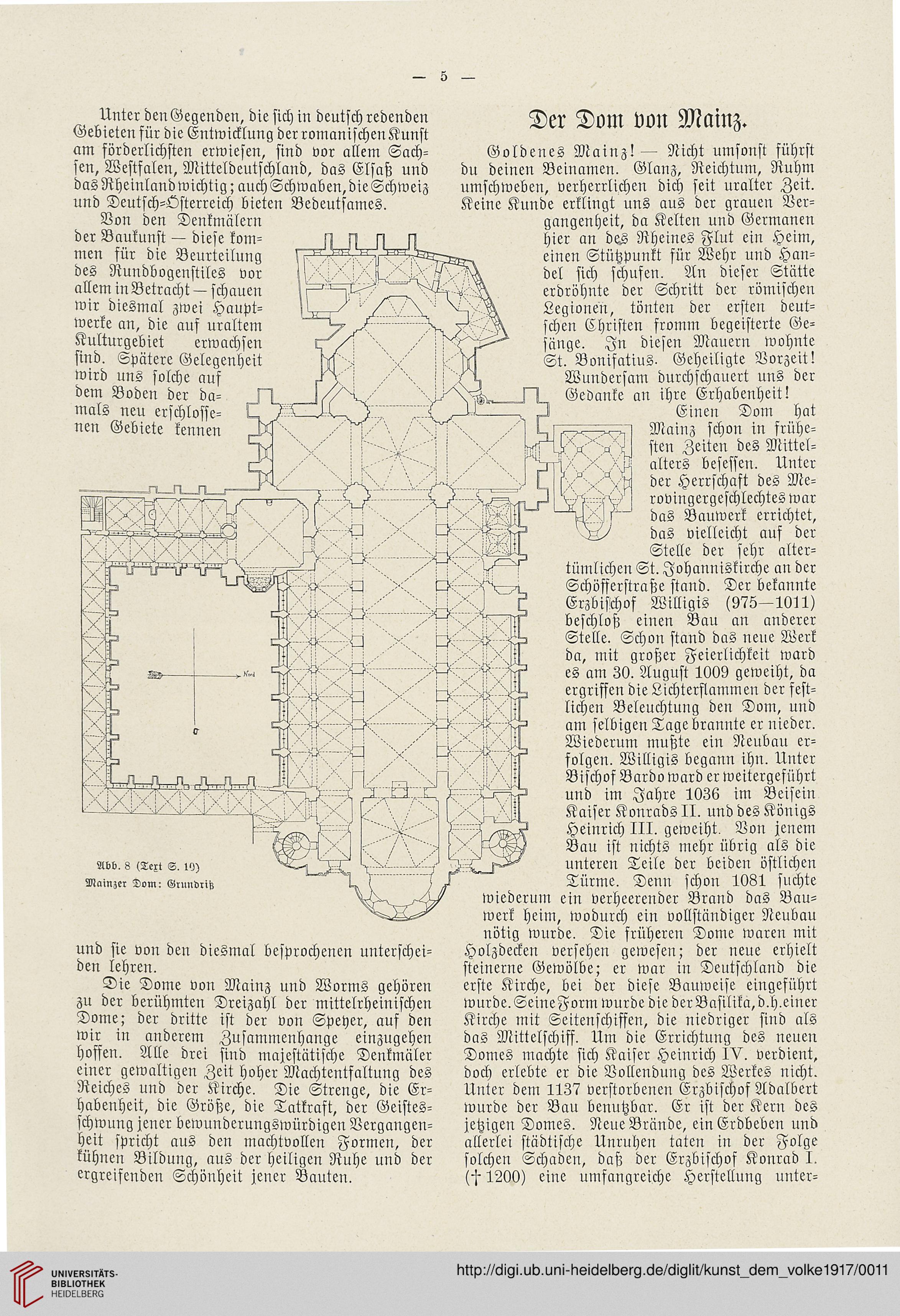5
Unter denGegenden, die sich in deutsch redenden
Gebieten für die Entwicklung der romanischenKunst
am förderlichsten erwiesen, sind vor allem Sach-
sen, Westfalen, Mitteldeutschland, das Elsaß und
dasRheinlandwichtig; auchSchwaben,dieSchweiz
und Deutsch-Osterreich bieten Bedeutsames.
Von den Denkmälern
der Baukunst — diese kom-
men für die Beurteilung
des Rundbogenstiles vor
allem inBetracht — schauen
wir diesmal zwei Haupt-
werke an, die auf uraltem
Kulturgebiet erwachsen
sind. Spätere Gelegenheit
wird uns solche auf
dem Boden der da-
mals neu erschlosse-
nen Gebiete kennen
»ix-sxx
--Hsnsts
>< X
.VsX
G<< ><<
X!X
Abb. 8 (Text S. 10)
Mainzer Dom: Grundritz
und sie von den diesmal besprochenen unterschei-
den lehren.
Die Dome von Mainz und Worms gehören
zu der berühmten Dreizahl der mittelrheinischen
Dome; der dritte ist der von Speyer, auf den
wir in anderem Zusammenhange einzugehen
hoffen. Alle drei sind majestätische Denkmäler
einer gewaltigen Zeit hoher Machtentfaltung des
Reiches und der Kirche. Die Strenge, die Er-
habenheit, die Größe, die Tatkraft, der Geistes-
schwung jener bewunderungswürdigen Vergangen-
heit spricht aus den machtvollen Formen, der
kühnen Bildung, aus der hciligcn Ruhe und der
ergreifenden Schönheit jener Bauten.
Der Dom von Mainz.
Goldenes Mainz! — Nicht umsonst führst
du deinen Beinamen. Glanz, Reichtum, Ruhm
umschweben, verherrlichen dich seit uralter Zeit.
Keinc Kunde erklingt uns aus der grauen Ver-
gangenheit, da Kelten und Germanen
hier an des Rheines Flut ein Heim,
einen Stützpunkt für Wehr und Han-
del sich schufen. An dieser Stätte
erdröhnte der Schritt der römischen
Legionen, tönten der ersten deut-
schen Christen fromm begeisterte Ge-
sänge. Jn diesen Mauern wohnte
St. Bonifatius. Geheiligte Vorzeit!
Wundersam durchschauert uns der
Gedanke an ihre Erhabenheit!
Einen Dom hat
Mainz schon in frühe-
sten Zeiten des Blittel-
alters besessen. Unter
der Herrschaft des Me-
rovingergeschlechtes war
das Bauwerk errichtet,
das vielleicht auf der
Stelle der sehr alter-
tümlichen St. Johanniskirche an der
Schöfferstraße stand. Der bekannte
Erzbifchof Willigis (975-IOll)
beschloß einen Bau an anderer
Stelle. Schon stand das neue Werk
da, mit großer Feierlichkeit ward
es am 30. August 1009 geweiht, da
ergriffen die Lichterflammen der fest-
lichen Beleuchtung den Dom, und
am selbigen Tage brannte er nieder.
Wiederum mußte ein Neubau er-
folgen. Willigis begann ihn. Unter
Bischof Bardo ward er weitergeführt
und im Jahre 1036 im Beisein
Kaiser Konrads 11. und des Königs
Heinrich III. geweiht. Von jenem
Bau ist nichts mehr übrig als die
unteren Teile der beiden östlichen
Türme. Denn schon 1081 suchte
wiederum ein verheerender Brand das Bau-
werk heim, wodurch ein vollständiger Neubau
nötig wurde. Die früheren Dome waren mit
Holzdecken versehen gewesen; der neue erhielt
steinerne Gewölbe; er war in Deutschland die
erste Kirche, bei der diese Bauweise eingeführt
wurde. SeineForm wurde die der Basilika, d.h.einer
Kirche mit Seitenschiffen, die niedriger sind als
das Mittelschiff. Um die Errichtung des neuen
Domes machte sich Kaiser Heinrich IV. verdient,
doch erlebte er die Vollendung des Werkes nicht.
Unter dem 1137 verstorbenen Erzbischof Adalbert
wurde der Bau benutzbar. Er ist der Kern des
jetzigen Domes. Neue Brände, ein Erdbeben und
allerlei städtische Unruhen taten in der Folge
solchen Schaden, daß der Erzbischof Konrad I.
(ch 1200) eine umfangreiche Herstellung unter-
Unter denGegenden, die sich in deutsch redenden
Gebieten für die Entwicklung der romanischenKunst
am förderlichsten erwiesen, sind vor allem Sach-
sen, Westfalen, Mitteldeutschland, das Elsaß und
dasRheinlandwichtig; auchSchwaben,dieSchweiz
und Deutsch-Osterreich bieten Bedeutsames.
Von den Denkmälern
der Baukunst — diese kom-
men für die Beurteilung
des Rundbogenstiles vor
allem inBetracht — schauen
wir diesmal zwei Haupt-
werke an, die auf uraltem
Kulturgebiet erwachsen
sind. Spätere Gelegenheit
wird uns solche auf
dem Boden der da-
mals neu erschlosse-
nen Gebiete kennen
»ix-sxx
--Hsnsts
>< X
.VsX
G<< ><<
X!X
Abb. 8 (Text S. 10)
Mainzer Dom: Grundritz
und sie von den diesmal besprochenen unterschei-
den lehren.
Die Dome von Mainz und Worms gehören
zu der berühmten Dreizahl der mittelrheinischen
Dome; der dritte ist der von Speyer, auf den
wir in anderem Zusammenhange einzugehen
hoffen. Alle drei sind majestätische Denkmäler
einer gewaltigen Zeit hoher Machtentfaltung des
Reiches und der Kirche. Die Strenge, die Er-
habenheit, die Größe, die Tatkraft, der Geistes-
schwung jener bewunderungswürdigen Vergangen-
heit spricht aus den machtvollen Formen, der
kühnen Bildung, aus der hciligcn Ruhe und der
ergreifenden Schönheit jener Bauten.
Der Dom von Mainz.
Goldenes Mainz! — Nicht umsonst führst
du deinen Beinamen. Glanz, Reichtum, Ruhm
umschweben, verherrlichen dich seit uralter Zeit.
Keinc Kunde erklingt uns aus der grauen Ver-
gangenheit, da Kelten und Germanen
hier an des Rheines Flut ein Heim,
einen Stützpunkt für Wehr und Han-
del sich schufen. An dieser Stätte
erdröhnte der Schritt der römischen
Legionen, tönten der ersten deut-
schen Christen fromm begeisterte Ge-
sänge. Jn diesen Mauern wohnte
St. Bonifatius. Geheiligte Vorzeit!
Wundersam durchschauert uns der
Gedanke an ihre Erhabenheit!
Einen Dom hat
Mainz schon in frühe-
sten Zeiten des Blittel-
alters besessen. Unter
der Herrschaft des Me-
rovingergeschlechtes war
das Bauwerk errichtet,
das vielleicht auf der
Stelle der sehr alter-
tümlichen St. Johanniskirche an der
Schöfferstraße stand. Der bekannte
Erzbifchof Willigis (975-IOll)
beschloß einen Bau an anderer
Stelle. Schon stand das neue Werk
da, mit großer Feierlichkeit ward
es am 30. August 1009 geweiht, da
ergriffen die Lichterflammen der fest-
lichen Beleuchtung den Dom, und
am selbigen Tage brannte er nieder.
Wiederum mußte ein Neubau er-
folgen. Willigis begann ihn. Unter
Bischof Bardo ward er weitergeführt
und im Jahre 1036 im Beisein
Kaiser Konrads 11. und des Königs
Heinrich III. geweiht. Von jenem
Bau ist nichts mehr übrig als die
unteren Teile der beiden östlichen
Türme. Denn schon 1081 suchte
wiederum ein verheerender Brand das Bau-
werk heim, wodurch ein vollständiger Neubau
nötig wurde. Die früheren Dome waren mit
Holzdecken versehen gewesen; der neue erhielt
steinerne Gewölbe; er war in Deutschland die
erste Kirche, bei der diese Bauweise eingeführt
wurde. SeineForm wurde die der Basilika, d.h.einer
Kirche mit Seitenschiffen, die niedriger sind als
das Mittelschiff. Um die Errichtung des neuen
Domes machte sich Kaiser Heinrich IV. verdient,
doch erlebte er die Vollendung des Werkes nicht.
Unter dem 1137 verstorbenen Erzbischof Adalbert
wurde der Bau benutzbar. Er ist der Kern des
jetzigen Domes. Neue Brände, ein Erdbeben und
allerlei städtische Unruhen taten in der Folge
solchen Schaden, daß der Erzbischof Konrad I.
(ch 1200) eine umfangreiche Herstellung unter-