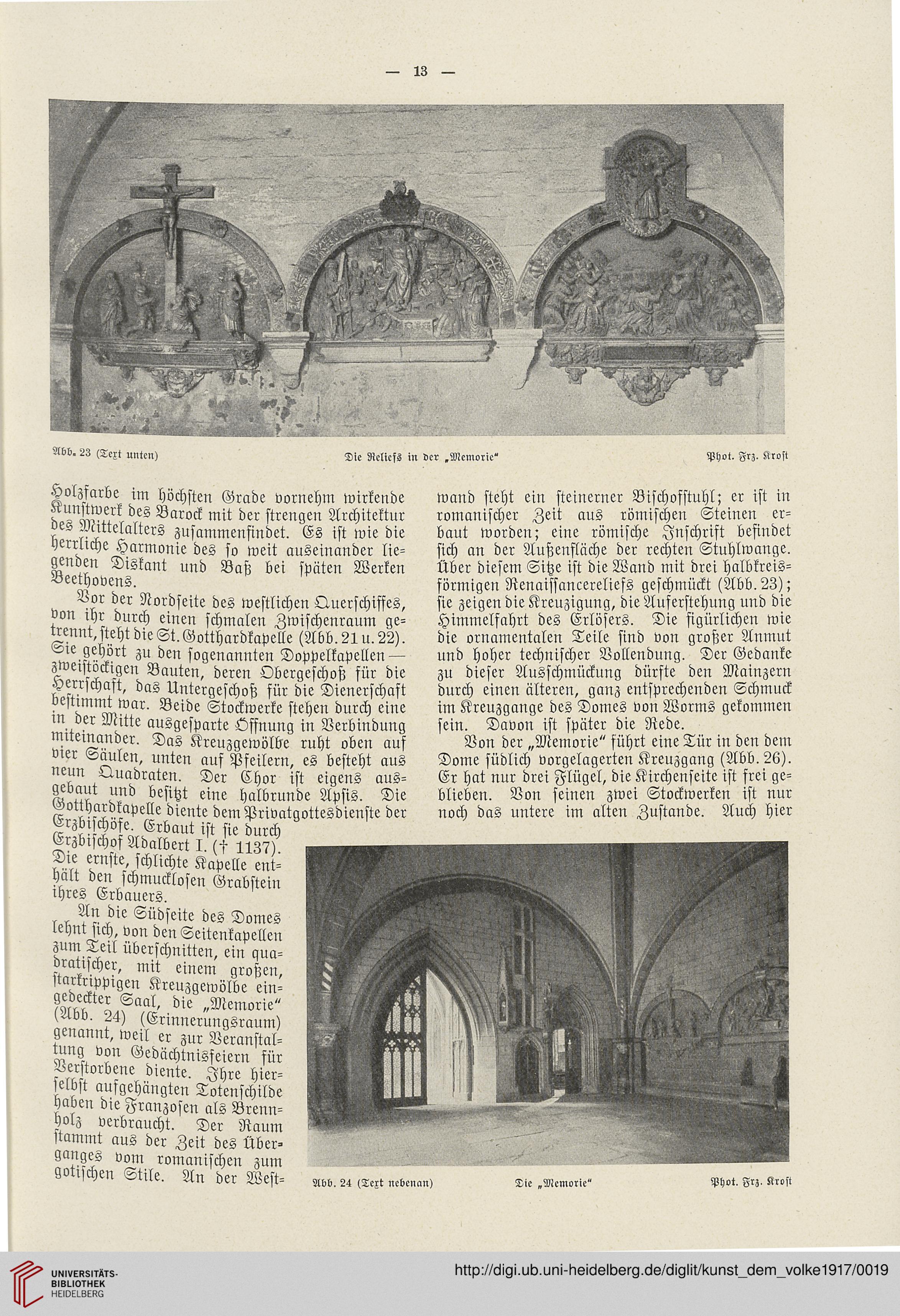13
Dic Reliess in ver .M-moric"
Phot. Frz. Krost
Abb. 23 (Tcxt untcn)
Holzfarbe im höchsten Grade vornehm wtrkende
Kunstwerl des Barock mit der strengen Archltettur
des Mittelalters zusammenfindet. Es ist wre me
herrliche Harmonie des so weit auseinander ue-
genden Diskant und Baß bei späten A-erten
Beethovens. ^
Vor der Nordseite des westlichen Querschrfies,
von ihr durch einen schmalen Zwlschenraum ge-
trenntZteht dieSt.Gotthardkapelle (Abb.2l u. 22).
Sie gehört zu den sogenannten Doppelkapellen
zweistöckigen Bauten, deren Obergeschoß sur oi
Herrschaft, das Untergeschoß für die Drenerschas
bestimmt war. Beide Stockwerke stehen durch ern
in der Mitte ausgesparte Offnung iir Verbmdung
miteinander. Das Kreuzgewölbe ruht oben aus
vier Säulen, unten auf Pfeilern, es besteht aus
neun Quadraten. Der Chor ist eigens aus-
gebaut und besitzt eine halbrunde Apfis.
Gotthardkapelle diente dem Privatgottesdrenste ver
Erzbischöfe. Erbaut ist sie durch
Erzbischof Adalbert I. (st 1137).
Die ernste, schlichte Kapelle ent-
hält den schmucklosen Grabstein
ihres Erbauers.
An die Südseite des Domes
lehnt sich, von den Seitenkapellen
zum Teil überschnitten, ein qua-
dratischer, mit einem großen,
starkrippigen Kreuzgewölbe ein-
gedeckter Saal, die „Memorie"
(Abb. 24) (Erinnerungsraum)
genannt, weil er zur Veranstal-
tung von Gedächtnisfeiern für
Verstorbene diente. Jhre hier-
selbst aufgehängten Totenschilde
haben die Franzosen als Brenn-
holz verbraucht. Der Raum
stammt aus der Zeit des Über--
ganges vom romanischen zum
gotischen Stile. An der West- Abb. 24 (Tcxt ncbc»»»)
wand steht ein steinerner Bischofstuhl; er ist in
romanischer Zeit aus römischen Steinen er-
baut worden; eine römische Jnschrift befindet
sich an der Außenfläche der rechten Stuhlwange.
Über diesem Sitze ist die Wand mit drei halbkreis-
förmigen Renaissancereliefs geschmückt (Abb.23);
sie zeigen die Kreuzigung, die Auferstehung und die
Himmelfahrt des Erlösers. Die figürlichen wie
die ornamentalen Teile sind von großer Annmt
und hoher technischer Vollendung. Der Gedanke
zu dieser Ausschmückung dürfte den Mainzern
durch einen älteren, ganz entsprechenden Schmuck
im Kreuzgange des Domes von Worms gekommen
sein. Davon ist später die Rede.
Von der „Memorie" suhrt eine Tür in den dem
Dome südlich vorgelagerten Kreuzgang (Abb.26).
Er hat nur drei Flügel, die Kirchenscite ist frei ge-
blieben. Von seinen zwei Stockwerken ist nur
noch das untere im alten Zustande. Auch hier
H /ä.
KV
Zi W? W
!is
^ W
«L-
Dic „Mcmorie"
Phot. Frz. Krost
Dic Reliess in ver .M-moric"
Phot. Frz. Krost
Abb. 23 (Tcxt untcn)
Holzfarbe im höchsten Grade vornehm wtrkende
Kunstwerl des Barock mit der strengen Archltettur
des Mittelalters zusammenfindet. Es ist wre me
herrliche Harmonie des so weit auseinander ue-
genden Diskant und Baß bei späten A-erten
Beethovens. ^
Vor der Nordseite des westlichen Querschrfies,
von ihr durch einen schmalen Zwlschenraum ge-
trenntZteht dieSt.Gotthardkapelle (Abb.2l u. 22).
Sie gehört zu den sogenannten Doppelkapellen
zweistöckigen Bauten, deren Obergeschoß sur oi
Herrschaft, das Untergeschoß für die Drenerschas
bestimmt war. Beide Stockwerke stehen durch ern
in der Mitte ausgesparte Offnung iir Verbmdung
miteinander. Das Kreuzgewölbe ruht oben aus
vier Säulen, unten auf Pfeilern, es besteht aus
neun Quadraten. Der Chor ist eigens aus-
gebaut und besitzt eine halbrunde Apfis.
Gotthardkapelle diente dem Privatgottesdrenste ver
Erzbischöfe. Erbaut ist sie durch
Erzbischof Adalbert I. (st 1137).
Die ernste, schlichte Kapelle ent-
hält den schmucklosen Grabstein
ihres Erbauers.
An die Südseite des Domes
lehnt sich, von den Seitenkapellen
zum Teil überschnitten, ein qua-
dratischer, mit einem großen,
starkrippigen Kreuzgewölbe ein-
gedeckter Saal, die „Memorie"
(Abb. 24) (Erinnerungsraum)
genannt, weil er zur Veranstal-
tung von Gedächtnisfeiern für
Verstorbene diente. Jhre hier-
selbst aufgehängten Totenschilde
haben die Franzosen als Brenn-
holz verbraucht. Der Raum
stammt aus der Zeit des Über--
ganges vom romanischen zum
gotischen Stile. An der West- Abb. 24 (Tcxt ncbc»»»)
wand steht ein steinerner Bischofstuhl; er ist in
romanischer Zeit aus römischen Steinen er-
baut worden; eine römische Jnschrift befindet
sich an der Außenfläche der rechten Stuhlwange.
Über diesem Sitze ist die Wand mit drei halbkreis-
förmigen Renaissancereliefs geschmückt (Abb.23);
sie zeigen die Kreuzigung, die Auferstehung und die
Himmelfahrt des Erlösers. Die figürlichen wie
die ornamentalen Teile sind von großer Annmt
und hoher technischer Vollendung. Der Gedanke
zu dieser Ausschmückung dürfte den Mainzern
durch einen älteren, ganz entsprechenden Schmuck
im Kreuzgange des Domes von Worms gekommen
sein. Davon ist später die Rede.
Von der „Memorie" suhrt eine Tür in den dem
Dome südlich vorgelagerten Kreuzgang (Abb.26).
Er hat nur drei Flügel, die Kirchenscite ist frei ge-
blieben. Von seinen zwei Stockwerken ist nur
noch das untere im alten Zustande. Auch hier
H /ä.
KV
Zi W? W
!is
^ W
«L-
Dic „Mcmorie"
Phot. Frz. Krost