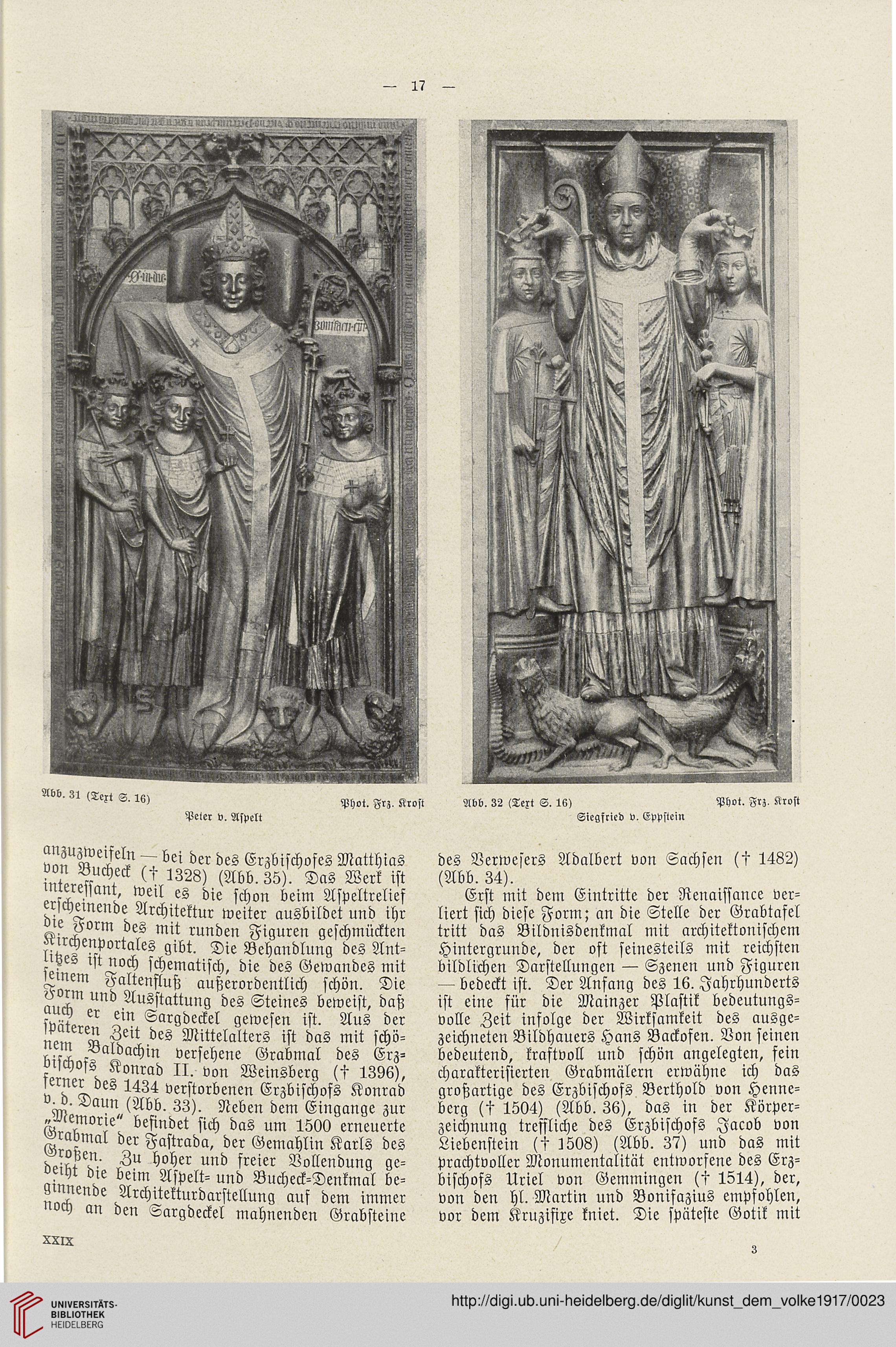17
Phot. Frz. Krost
Abb. S1 (Text S. ig)
Peter v. Aspelt
Abb. 32 <Text S. 1K,
Phot. Frz. Krost
Siegsried v. Eppstein
anzuzweifeln — bei der des Erzbischofes Matthms
von Bucheck (-f 1328) (Abb.35). Das Werr rfr
interefsant, weil es die schon beim Aspeltreuei
erscheinende Architektur weiter ausbildet und ryr
die Form des mit runden Figuren geschmuckten
Kirchenportales gibt. Die Behandlung
litzes ist noch schematisch, die des Gewandes mr
seinem Faltenfluß außerordentlich schou-
Form und Ausstattung des Steines bewerist dai
auch er ein Sargdeckel gewesen rst. -lluS oer
späteren Zeit des Mittelalters ist das mrt scho-
nem Baldachin versehene Grabmal des Erz-
bischofs Konrad II. von Weinsberg (^^96),
ferner des 1434 verstorbenen Erzbischofs Korrrao
v. d. Daun (Abb. 33). Neben dem Eingange zur
„Memorie" bestndet sich das um 1500 erneuer e
Grabmal der Fastrada, der Gemahlin Karts oe
Großen. Zu hoher und freier Vollendung ge-
deiht die beim Aspelt- und Bucheck-Denkmal be-
ginnende Architekturdarstellung auf dem imnrer
noch an den Sargdeckel mahnenden Grabsterne
des Verwesers Adalbert von Sachsen (f 1482)
(Abb. 34).
Erst mit dem Eintritte der Renaissance ver-
liert sich diese Form; an die Stelle der Grabtafel
tritt das Bildnisdenkmal mit architektorrischem
Hintergrunde, der oft seinesteils mit reichsten
bildlichen Darstellungen — Szenen und Figuren
— bedeckt ist. Der Anfang des 16. Jahrhunderts
ist eine für die Mainzer Plastik bedeutungs-
volle Zeit infolge der Wirksamkeit des ausge-
zeichneten Bildhauers Hans Backofen. Von seinen
bedeutend, kraftvoll und schön angelegten, sein
charakterisierten Grabmälern erwähne ich das
großartige des Erzbischofs Berthold von Henne-
berg (st 1504) (Abb. 36), das in der Körper-
zeichnung treffliche des Erzbischofs Jacob von
Liebenstein (st 1508) (Abb. 37) und das mit
prachtvoller Monumentalität entworfene des Erz-
bischofs Uriel von Gemmingen (st 1514), der,
von den hl. Martin und Bonifazius empfohlen,
vor dem Kruzisixe kniet. Die späteste Gotik mit
xxix
3
Phot. Frz. Krost
Abb. S1 (Text S. ig)
Peter v. Aspelt
Abb. 32 <Text S. 1K,
Phot. Frz. Krost
Siegsried v. Eppstein
anzuzweifeln — bei der des Erzbischofes Matthms
von Bucheck (-f 1328) (Abb.35). Das Werr rfr
interefsant, weil es die schon beim Aspeltreuei
erscheinende Architektur weiter ausbildet und ryr
die Form des mit runden Figuren geschmuckten
Kirchenportales gibt. Die Behandlung
litzes ist noch schematisch, die des Gewandes mr
seinem Faltenfluß außerordentlich schou-
Form und Ausstattung des Steines bewerist dai
auch er ein Sargdeckel gewesen rst. -lluS oer
späteren Zeit des Mittelalters ist das mrt scho-
nem Baldachin versehene Grabmal des Erz-
bischofs Konrad II. von Weinsberg (^^96),
ferner des 1434 verstorbenen Erzbischofs Korrrao
v. d. Daun (Abb. 33). Neben dem Eingange zur
„Memorie" bestndet sich das um 1500 erneuer e
Grabmal der Fastrada, der Gemahlin Karts oe
Großen. Zu hoher und freier Vollendung ge-
deiht die beim Aspelt- und Bucheck-Denkmal be-
ginnende Architekturdarstellung auf dem imnrer
noch an den Sargdeckel mahnenden Grabsterne
des Verwesers Adalbert von Sachsen (f 1482)
(Abb. 34).
Erst mit dem Eintritte der Renaissance ver-
liert sich diese Form; an die Stelle der Grabtafel
tritt das Bildnisdenkmal mit architektorrischem
Hintergrunde, der oft seinesteils mit reichsten
bildlichen Darstellungen — Szenen und Figuren
— bedeckt ist. Der Anfang des 16. Jahrhunderts
ist eine für die Mainzer Plastik bedeutungs-
volle Zeit infolge der Wirksamkeit des ausge-
zeichneten Bildhauers Hans Backofen. Von seinen
bedeutend, kraftvoll und schön angelegten, sein
charakterisierten Grabmälern erwähne ich das
großartige des Erzbischofs Berthold von Henne-
berg (st 1504) (Abb. 36), das in der Körper-
zeichnung treffliche des Erzbischofs Jacob von
Liebenstein (st 1508) (Abb. 37) und das mit
prachtvoller Monumentalität entworfene des Erz-
bischofs Uriel von Gemmingen (st 1514), der,
von den hl. Martin und Bonifazius empfohlen,
vor dem Kruzisixe kniet. Die späteste Gotik mit
xxix
3