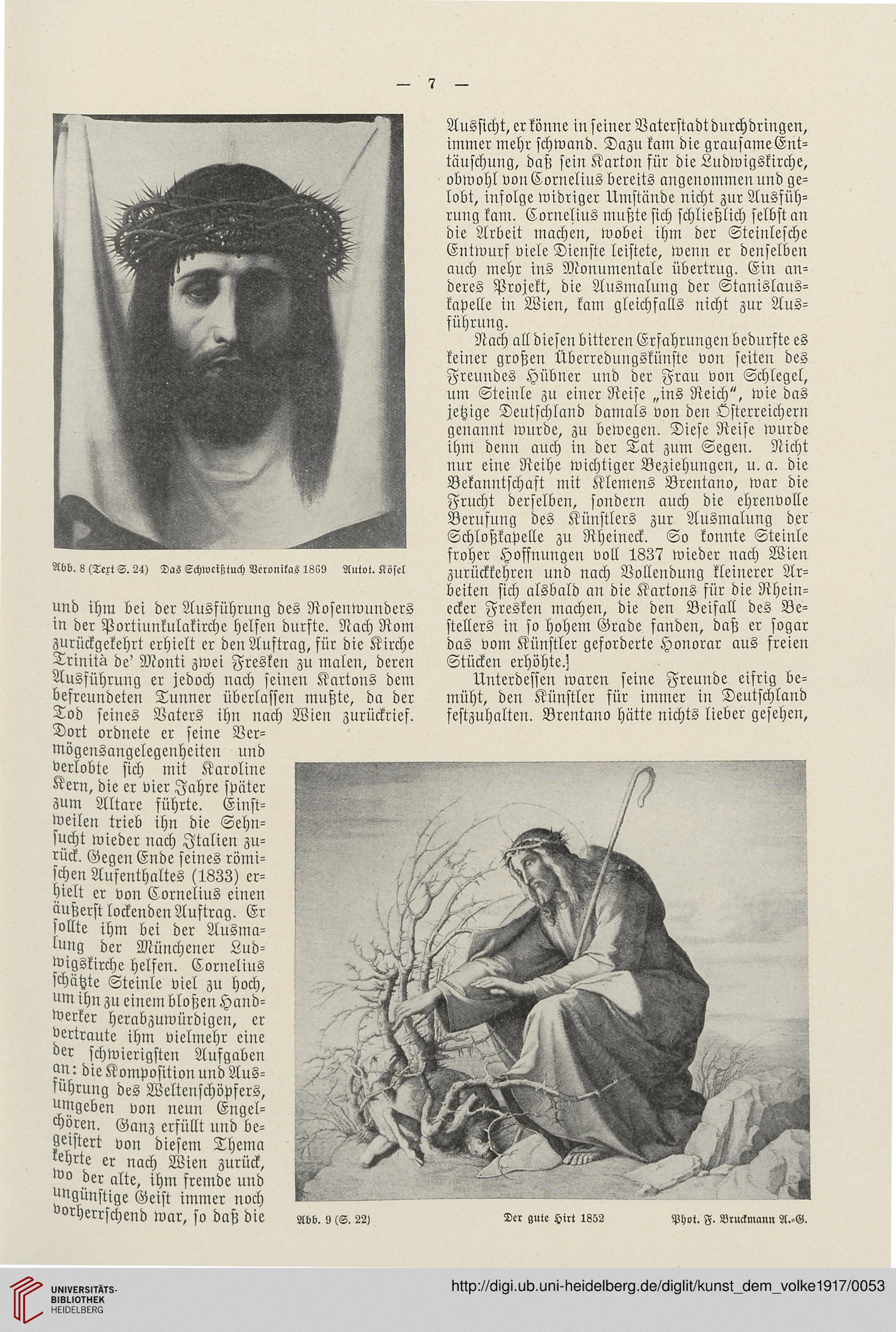7
Abb. 8 (Tc;t S. 24) DaL Cchwctßtuch Vcronikas 18SS Autot. Köscl
und ihm bei der Ausführung des Roseuwunders
in der Portiunkulakirche helfen durfte. Nach Rom
zurückgekehrt erhielt er den Auftrag, für die Kirche
Trinitü de' Monti zwei Fresken zu malen, deren
Ausführung er jedoch nach seinen Kartons dem
befreundeten Tunner überlassen mußte, da der
Tod seines Vaters ihn nach Wien zurückrief.
Dort ordnete er seine Ver-
mögensangelegenheiten und
verlobte sich mit Karoline
Kern, die er vier Jahre später
Ium Altare führte. Einst-
weilen trieb ihn die Sehn-
sucht wieder nach Jtalien zu-
rück. Gegen Ende seines römi-
schen Ausenthaltes (1833) er-
hielt er von Cornelius einen
äußerst lockendenAuftrag. Er
sollte ihm bei der Ausma-
lung twr Münchener Lud-
wigskirche helfen. Cornelius
schätzte Steinle viel zu hoch,
um ihn zu einem bloßen Hand-
werker herabzuwürdigen, er
bertraute ihm vielmehr eine
äer schwierigsten Ausgaben
un: die Komposition und Aus-
sührung des Weltenschöpfers,
urngeben von neun Engel-
chören. Ganz erfüllt und be-
geistert von diesem Thema
whrte er nach Wien zurück,
wo der alte, ihm sremde und
ungünstige Geist immer noch
urherrschend war, so daß die Abb. g(S. 22)
Aussicht,erkönne inseiner Vaterstadtdurchdringen,
immer mehr schwand. Dazu kam die grausameEnt-
täuschung, daß sein Karton für die Ludwigskirche,
obwohl vonCornelius bereits angenommen und ge-
lobt, infolge widriger Umstände nicht zur Ausfüh-
rung kam. Cornelius mußte sich schließlich selbst an
die Arbeit machen, wobei ihm der Steinlesche
Entwurf viele Dienste leistete, wenn er denselben
auch mehr ins Monumentale übertrug. Ein an-
deres Projekt, die Ausmalung der Stanislaus-
kapelle in Wien, kam gleichfalls nicht zur Aus-
führung.
Nach all diesen bitteren Erfahrungen bedurfte es
keiner großen Überredungskünste von seiten des
Freundes Hübner und der Frau von Schlegel,
um Steinle zu einer Reise „ins Reich", wie das
jetzige Deutschland damals von den Osterreichern
genannt wurde, zu bewegen. Diese Reise wurde
ihm denn auch in der Tat zum Segen. Nicht
nur eine Reihe wichtiger Beziehungen, u. a. die
Bekanntschaft mit Klemens Brentano, war die
Frucht derselben, sondern auch die ehrenvolle
Berufung des Künstlers zur Ausmalung der
Schloßkapelle zu Rheineck. So konnte Steinle
froher Hoffnungen voll 1837 wieder nach Wien
zurückkehren und nach Vollendung kleinerer Ar-
beiten sich alsbald an die Kartons für die Rhein-
ecker Fresken machen, die den Beifall des Be-
stellers in so hohem Grade fanden, daß er sogar
das vom Künstler geforderte Honorar aus freien
Stücken erhöhte.s
Unterdessen waren seine Freunde eifrig be-
müht, den Künstler für immer in Deutschland
sestzuhalten. Brentano hätte nichts lieber gesehen,
Der gute Hirt 1852
Phot. F. Bruclmann A.-G.
Abb. 8 (Tc;t S. 24) DaL Cchwctßtuch Vcronikas 18SS Autot. Köscl
und ihm bei der Ausführung des Roseuwunders
in der Portiunkulakirche helfen durfte. Nach Rom
zurückgekehrt erhielt er den Auftrag, für die Kirche
Trinitü de' Monti zwei Fresken zu malen, deren
Ausführung er jedoch nach seinen Kartons dem
befreundeten Tunner überlassen mußte, da der
Tod seines Vaters ihn nach Wien zurückrief.
Dort ordnete er seine Ver-
mögensangelegenheiten und
verlobte sich mit Karoline
Kern, die er vier Jahre später
Ium Altare führte. Einst-
weilen trieb ihn die Sehn-
sucht wieder nach Jtalien zu-
rück. Gegen Ende seines römi-
schen Ausenthaltes (1833) er-
hielt er von Cornelius einen
äußerst lockendenAuftrag. Er
sollte ihm bei der Ausma-
lung twr Münchener Lud-
wigskirche helfen. Cornelius
schätzte Steinle viel zu hoch,
um ihn zu einem bloßen Hand-
werker herabzuwürdigen, er
bertraute ihm vielmehr eine
äer schwierigsten Ausgaben
un: die Komposition und Aus-
sührung des Weltenschöpfers,
urngeben von neun Engel-
chören. Ganz erfüllt und be-
geistert von diesem Thema
whrte er nach Wien zurück,
wo der alte, ihm sremde und
ungünstige Geist immer noch
urherrschend war, so daß die Abb. g(S. 22)
Aussicht,erkönne inseiner Vaterstadtdurchdringen,
immer mehr schwand. Dazu kam die grausameEnt-
täuschung, daß sein Karton für die Ludwigskirche,
obwohl vonCornelius bereits angenommen und ge-
lobt, infolge widriger Umstände nicht zur Ausfüh-
rung kam. Cornelius mußte sich schließlich selbst an
die Arbeit machen, wobei ihm der Steinlesche
Entwurf viele Dienste leistete, wenn er denselben
auch mehr ins Monumentale übertrug. Ein an-
deres Projekt, die Ausmalung der Stanislaus-
kapelle in Wien, kam gleichfalls nicht zur Aus-
führung.
Nach all diesen bitteren Erfahrungen bedurfte es
keiner großen Überredungskünste von seiten des
Freundes Hübner und der Frau von Schlegel,
um Steinle zu einer Reise „ins Reich", wie das
jetzige Deutschland damals von den Osterreichern
genannt wurde, zu bewegen. Diese Reise wurde
ihm denn auch in der Tat zum Segen. Nicht
nur eine Reihe wichtiger Beziehungen, u. a. die
Bekanntschaft mit Klemens Brentano, war die
Frucht derselben, sondern auch die ehrenvolle
Berufung des Künstlers zur Ausmalung der
Schloßkapelle zu Rheineck. So konnte Steinle
froher Hoffnungen voll 1837 wieder nach Wien
zurückkehren und nach Vollendung kleinerer Ar-
beiten sich alsbald an die Kartons für die Rhein-
ecker Fresken machen, die den Beifall des Be-
stellers in so hohem Grade fanden, daß er sogar
das vom Künstler geforderte Honorar aus freien
Stücken erhöhte.s
Unterdessen waren seine Freunde eifrig be-
müht, den Künstler für immer in Deutschland
sestzuhalten. Brentano hätte nichts lieber gesehen,
Der gute Hirt 1852
Phot. F. Bruclmann A.-G.