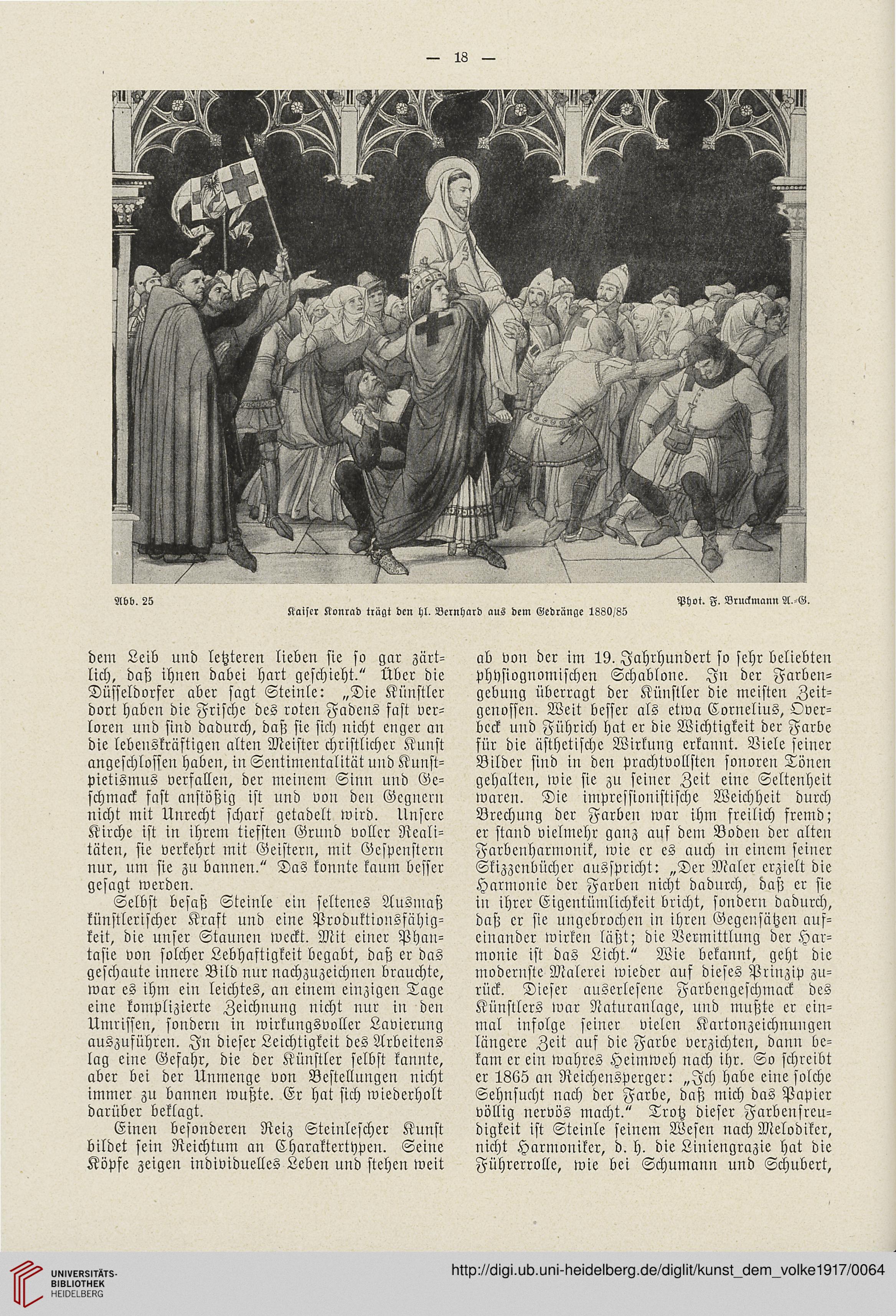Abb. 25
Kaiser Konrad trägt den hl. Bernhard aus dem Gedränge 1880/85
Phot. F. Bruckmann A.-G.
dem Leib und letzteren lieben sie so gar zärt-
lich, daß ihnen dabei hart geschieht." Über die
Düsseldorfer aber sagt Steinle: „Die Künstler
dort haben die Frische des roten Fadens sast ver-
loren und sind dadurch, daß sie sich nicht enger an
die lebenskräftigen alten Meister christlicher Kunst
angeschlossen haben, in Sentimentalität und Kunst-
pietismus verfallen, der meinem Sinn und Ge-
schmack fast anstößig ist und von den Gegnern
nicht mit Unrecht scharf getadelt wird. Unscre
Kirche ist in ihrem tiefsten Grund vollcr Neali-
täten, sie verkehrt mit Geistern, mit Gespenstern
nur, um sie zu bannen." Das konnte kaum besser
gesagt werden.
Selbst besaß Steinle ein seltenes Ausmaß
künstlerischer Kraft und eine Produktionsfähig-
keit, die unser Staunen weckt. Mit einer Phan-
tasie von solcher Lebhaftigkeit begabt, daß er das
geschaute innere Bild nur nachzuzeichnen brauchte,
war es ihm ein leichtes, an einem einzigen Tage
eine komplizierte Zeichnung nicht nur in den
Umrissen, sondern in wirkungsvoller Lavierung
auszuführen. Jn dieser Leichtigkeit des Arbeitens
lag eine Gefahr, die der Künstler selbst kannte,
aber bei der Unmenge von Bestellungen nicht
immer zu bannen wußte. Er hat sich wiederholt
darüber beklagt.
Einen besonderen Reiz Steinlescher Kunst
bildet sein Reichtum an Charaktertypen. Seine
Köpfe zeigen individuelles Leben und stehen weit
ab von der im 19. Jahrhundert so sehr beliebten
phhsiognomischen Schablone. Jn der Farben-
gebung überragt der Künstler die meisten Zeit-
genossen. Weit besser als etwa Cornelius, Over-
bcck und Führich hat er die Wichtigkeit der Farbe
für die ästhetische Wirkung erkannt. Viele seiner
Bilder sind in den prachtvollsten sonoren Tönen
gehalten, wie sie zu seiner Zeit eine Seltenheit
waren. Die impressionistische Weichheit durch
Brechung der Farben war ihm freilich fremd;
er stand vielmehr ganz auf dem Boden der alten
Farbenharmonik, wie cr es auch in einem seiner
Skizzenbücher ausspricht: „Der Maler erzielt die
Harmonie der Farben nicht dadurch, daß er sie
in ihrer Eigentümlichkeit bricht, sondern dadurch,
daß er sie ungebrochen in ihren Gegensätzen auf-
einander wirken läßt; die Vermittlung der Har-
monie ist das Licht." Wie bekannt, geht die
modernste Malerei wieder auf dieses Prinzip zu-
rück. Dieser auserlesene Farbengeschmack des
Künstlers war Naturanlage, und mußte er ein-
mal infolge seiner vielen Kartonzeichnungen
längere Zeit auf die Farbe verzichten, dann be-
kam er ein wahres Heimweh nach ihr. So schreibt
er 1865 an Reichensperger: „Jch habe eine solche
Sehnsucht nach der Farbe, daß mich das Papier
völlig nervös macht." Trotz dieser Farbensreu-
digkeit ist Steinle seinem Wesen nach Melodiker,
nicht Harmoniker, d. h. die Liniengrazie hat die
Führerrolle, wie bei Schumann und Schubert,
Kaiser Konrad trägt den hl. Bernhard aus dem Gedränge 1880/85
Phot. F. Bruckmann A.-G.
dem Leib und letzteren lieben sie so gar zärt-
lich, daß ihnen dabei hart geschieht." Über die
Düsseldorfer aber sagt Steinle: „Die Künstler
dort haben die Frische des roten Fadens sast ver-
loren und sind dadurch, daß sie sich nicht enger an
die lebenskräftigen alten Meister christlicher Kunst
angeschlossen haben, in Sentimentalität und Kunst-
pietismus verfallen, der meinem Sinn und Ge-
schmack fast anstößig ist und von den Gegnern
nicht mit Unrecht scharf getadelt wird. Unscre
Kirche ist in ihrem tiefsten Grund vollcr Neali-
täten, sie verkehrt mit Geistern, mit Gespenstern
nur, um sie zu bannen." Das konnte kaum besser
gesagt werden.
Selbst besaß Steinle ein seltenes Ausmaß
künstlerischer Kraft und eine Produktionsfähig-
keit, die unser Staunen weckt. Mit einer Phan-
tasie von solcher Lebhaftigkeit begabt, daß er das
geschaute innere Bild nur nachzuzeichnen brauchte,
war es ihm ein leichtes, an einem einzigen Tage
eine komplizierte Zeichnung nicht nur in den
Umrissen, sondern in wirkungsvoller Lavierung
auszuführen. Jn dieser Leichtigkeit des Arbeitens
lag eine Gefahr, die der Künstler selbst kannte,
aber bei der Unmenge von Bestellungen nicht
immer zu bannen wußte. Er hat sich wiederholt
darüber beklagt.
Einen besonderen Reiz Steinlescher Kunst
bildet sein Reichtum an Charaktertypen. Seine
Köpfe zeigen individuelles Leben und stehen weit
ab von der im 19. Jahrhundert so sehr beliebten
phhsiognomischen Schablone. Jn der Farben-
gebung überragt der Künstler die meisten Zeit-
genossen. Weit besser als etwa Cornelius, Over-
bcck und Führich hat er die Wichtigkeit der Farbe
für die ästhetische Wirkung erkannt. Viele seiner
Bilder sind in den prachtvollsten sonoren Tönen
gehalten, wie sie zu seiner Zeit eine Seltenheit
waren. Die impressionistische Weichheit durch
Brechung der Farben war ihm freilich fremd;
er stand vielmehr ganz auf dem Boden der alten
Farbenharmonik, wie cr es auch in einem seiner
Skizzenbücher ausspricht: „Der Maler erzielt die
Harmonie der Farben nicht dadurch, daß er sie
in ihrer Eigentümlichkeit bricht, sondern dadurch,
daß er sie ungebrochen in ihren Gegensätzen auf-
einander wirken läßt; die Vermittlung der Har-
monie ist das Licht." Wie bekannt, geht die
modernste Malerei wieder auf dieses Prinzip zu-
rück. Dieser auserlesene Farbengeschmack des
Künstlers war Naturanlage, und mußte er ein-
mal infolge seiner vielen Kartonzeichnungen
längere Zeit auf die Farbe verzichten, dann be-
kam er ein wahres Heimweh nach ihr. So schreibt
er 1865 an Reichensperger: „Jch habe eine solche
Sehnsucht nach der Farbe, daß mich das Papier
völlig nervös macht." Trotz dieser Farbensreu-
digkeit ist Steinle seinem Wesen nach Melodiker,
nicht Harmoniker, d. h. die Liniengrazie hat die
Führerrolle, wie bei Schumann und Schubert,