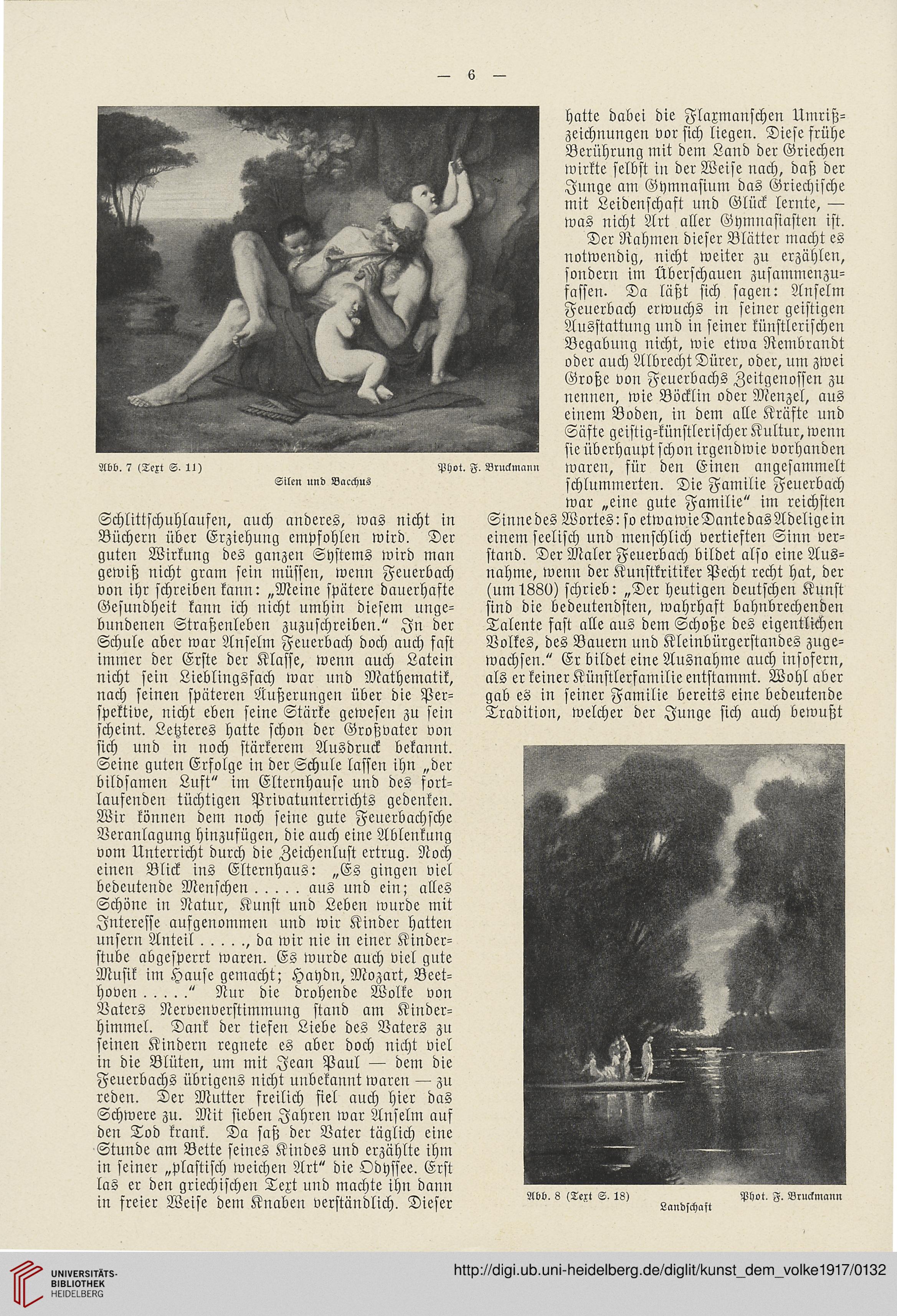6
Abb. 7 (Te;t S. II)
Silen und BacchuL
Schlittschuhlaufen, auch anderes, was nicht in
Büchern über Erziehung empfohlen wird. Der
guten Wirkung des ganzen Systems wird man
gewiß nicht gram sein müssen, wenn Feuerbach
von ihr schreiben kann: „Meine spätere dauerhafte
Gesundheit kann ich nicht umhin diesem unge-
bundenen Straßenleben zuzuschreiben." Jn der
Schule aber war Anselm Feuerbach doch auch fast
immer der Erste der Klasse, wenn auch Latein
nicht sein Lieblingsfach war und Mathematik,
nach seinen späteren Äußerungen über die Per-
spektive, nicht eben seine Stärke gewesen zu sein
scheint. Letzteres hatte schon der Großvater von
sich und in noch stärkerem Ausdruck bekannt.
Seine guten Erfolge in der Schule lassen ihn „der
bildsamen Luft" im Elternhause und des fort-
laufenden tüchtigen Privatunterrichts gedenken.
Wir können dem noch seine gute Feuerbachsche
Veranlagung hinzufügen, die auch eine Ablenkung
vom Unterricht durch die Zeichenlust ertrug. Noch
einen Blick ins Elternhaus: „Es gingen viel
bedeutende Menschen.aus und ein; alles
Schöne in Natur, Kunst und Leben wurde mit
Jnteresse aufgenommen und wir Kinder hatten
unsern Anteil., da wir nie in einer Kinder-
stube abgesperrt waren. Es wurde auch viel gute
Musik im Hause gemacht; Haydn, Mozart, Beet-
hoven." Nur die drohende Wolke von
Vaters Nervenverstimmung stand am Kinder-
himmel. Dank der tiefen Liebe des Vaters zu
seinen Kindern regnete es aber doch nicht viel
in die Blüten, um mit Jean Paul — dem die
Feuerbachs übrigens nicht unbekannt waren — zu
reden. Der Mutter freilich fiel auch hier das
Schwere zu. Mit sieben Jahren war Anselm auf
den Tod krank. Da saß der Vater täglich eine
Stunde am Bette seines Kindes und erzählte ihm
in seiner „plastisch weichen Art" die Odyssee. Erst
las er den griechischen Text und machte ihn dann
in freier Weise dem Knaben verständlich. Dieser
hatte dabei die Flaxmanschen Umriß-
zeichnungen vor sich liegen. Diese frühe
Berührung mit dem Land der Griechen
wirkte selbst in der Weise nach, daß der
Junge am Gymnasium das Griechische
mit Leidenschaft und Glück lernte, —
was nicht Art aller Gymnasiasten ist.
Der Rahmen dieser Blätter macht es
notwendig, nicht weiter zu erzählen,
sondern im Überschauen zusammenzu-
fassen- Da läßt sich sagen: Anselm
Feuerbach erwuchs in seiner geistigen
Ausstattung und in seiner künstlerischen
Begabung nicht, wie etwa Rembrandt
oder auch Albrecht Dürer, oder, um zwei
Große von Feuerbachs Zeitgenossen zu
nennen, wie Böcklin oder Menzel, aus
einem Boden, in dem alle Kräfte und
Säfte geistig-künstlerischerKultur, wenn
sie überhaupt schon irgendwie vorhanden
Phot. F. Brucimami waren, für den Einen angesammelt
schlummerten. Die Familie Feuerbach
war „eine gute Familie" im reichsten
Sinnedes Wortes: so etwawieDantedasAdeligein
einem seelisch und menschlich vertieften Sinn ver-
stand. Der Maler Feuerbach bildet also eine Aus-
nahme, wenn der Kunstkritiker Pecht recht hat, der
(um1880) schrieb: „Der heutigen deutschen Kunst
sind die bedeutendsten, wahrhaft bahnbrechenden
Talente sast alle aus dem Schoße des eigentlichen
Volkes, des Bauern und Kleinbürgerstandes zuge-
wachsen." Er bildet eine Ausnahme auch insofern,
als er keiner Künstlerfamilie entstammt. Wohl aber
gab es in seiner Familie bereits eine bedeutende
Tradition, welcher der Junge sich auch bewußt
Abb. 8 (Text S. 18)
Phot. F. Bruckmami
Landschast
Abb. 7 (Te;t S. II)
Silen und BacchuL
Schlittschuhlaufen, auch anderes, was nicht in
Büchern über Erziehung empfohlen wird. Der
guten Wirkung des ganzen Systems wird man
gewiß nicht gram sein müssen, wenn Feuerbach
von ihr schreiben kann: „Meine spätere dauerhafte
Gesundheit kann ich nicht umhin diesem unge-
bundenen Straßenleben zuzuschreiben." Jn der
Schule aber war Anselm Feuerbach doch auch fast
immer der Erste der Klasse, wenn auch Latein
nicht sein Lieblingsfach war und Mathematik,
nach seinen späteren Äußerungen über die Per-
spektive, nicht eben seine Stärke gewesen zu sein
scheint. Letzteres hatte schon der Großvater von
sich und in noch stärkerem Ausdruck bekannt.
Seine guten Erfolge in der Schule lassen ihn „der
bildsamen Luft" im Elternhause und des fort-
laufenden tüchtigen Privatunterrichts gedenken.
Wir können dem noch seine gute Feuerbachsche
Veranlagung hinzufügen, die auch eine Ablenkung
vom Unterricht durch die Zeichenlust ertrug. Noch
einen Blick ins Elternhaus: „Es gingen viel
bedeutende Menschen.aus und ein; alles
Schöne in Natur, Kunst und Leben wurde mit
Jnteresse aufgenommen und wir Kinder hatten
unsern Anteil., da wir nie in einer Kinder-
stube abgesperrt waren. Es wurde auch viel gute
Musik im Hause gemacht; Haydn, Mozart, Beet-
hoven." Nur die drohende Wolke von
Vaters Nervenverstimmung stand am Kinder-
himmel. Dank der tiefen Liebe des Vaters zu
seinen Kindern regnete es aber doch nicht viel
in die Blüten, um mit Jean Paul — dem die
Feuerbachs übrigens nicht unbekannt waren — zu
reden. Der Mutter freilich fiel auch hier das
Schwere zu. Mit sieben Jahren war Anselm auf
den Tod krank. Da saß der Vater täglich eine
Stunde am Bette seines Kindes und erzählte ihm
in seiner „plastisch weichen Art" die Odyssee. Erst
las er den griechischen Text und machte ihn dann
in freier Weise dem Knaben verständlich. Dieser
hatte dabei die Flaxmanschen Umriß-
zeichnungen vor sich liegen. Diese frühe
Berührung mit dem Land der Griechen
wirkte selbst in der Weise nach, daß der
Junge am Gymnasium das Griechische
mit Leidenschaft und Glück lernte, —
was nicht Art aller Gymnasiasten ist.
Der Rahmen dieser Blätter macht es
notwendig, nicht weiter zu erzählen,
sondern im Überschauen zusammenzu-
fassen- Da läßt sich sagen: Anselm
Feuerbach erwuchs in seiner geistigen
Ausstattung und in seiner künstlerischen
Begabung nicht, wie etwa Rembrandt
oder auch Albrecht Dürer, oder, um zwei
Große von Feuerbachs Zeitgenossen zu
nennen, wie Böcklin oder Menzel, aus
einem Boden, in dem alle Kräfte und
Säfte geistig-künstlerischerKultur, wenn
sie überhaupt schon irgendwie vorhanden
Phot. F. Brucimami waren, für den Einen angesammelt
schlummerten. Die Familie Feuerbach
war „eine gute Familie" im reichsten
Sinnedes Wortes: so etwawieDantedasAdeligein
einem seelisch und menschlich vertieften Sinn ver-
stand. Der Maler Feuerbach bildet also eine Aus-
nahme, wenn der Kunstkritiker Pecht recht hat, der
(um1880) schrieb: „Der heutigen deutschen Kunst
sind die bedeutendsten, wahrhaft bahnbrechenden
Talente sast alle aus dem Schoße des eigentlichen
Volkes, des Bauern und Kleinbürgerstandes zuge-
wachsen." Er bildet eine Ausnahme auch insofern,
als er keiner Künstlerfamilie entstammt. Wohl aber
gab es in seiner Familie bereits eine bedeutende
Tradition, welcher der Junge sich auch bewußt
Abb. 8 (Text S. 18)
Phot. F. Bruckmami
Landschast