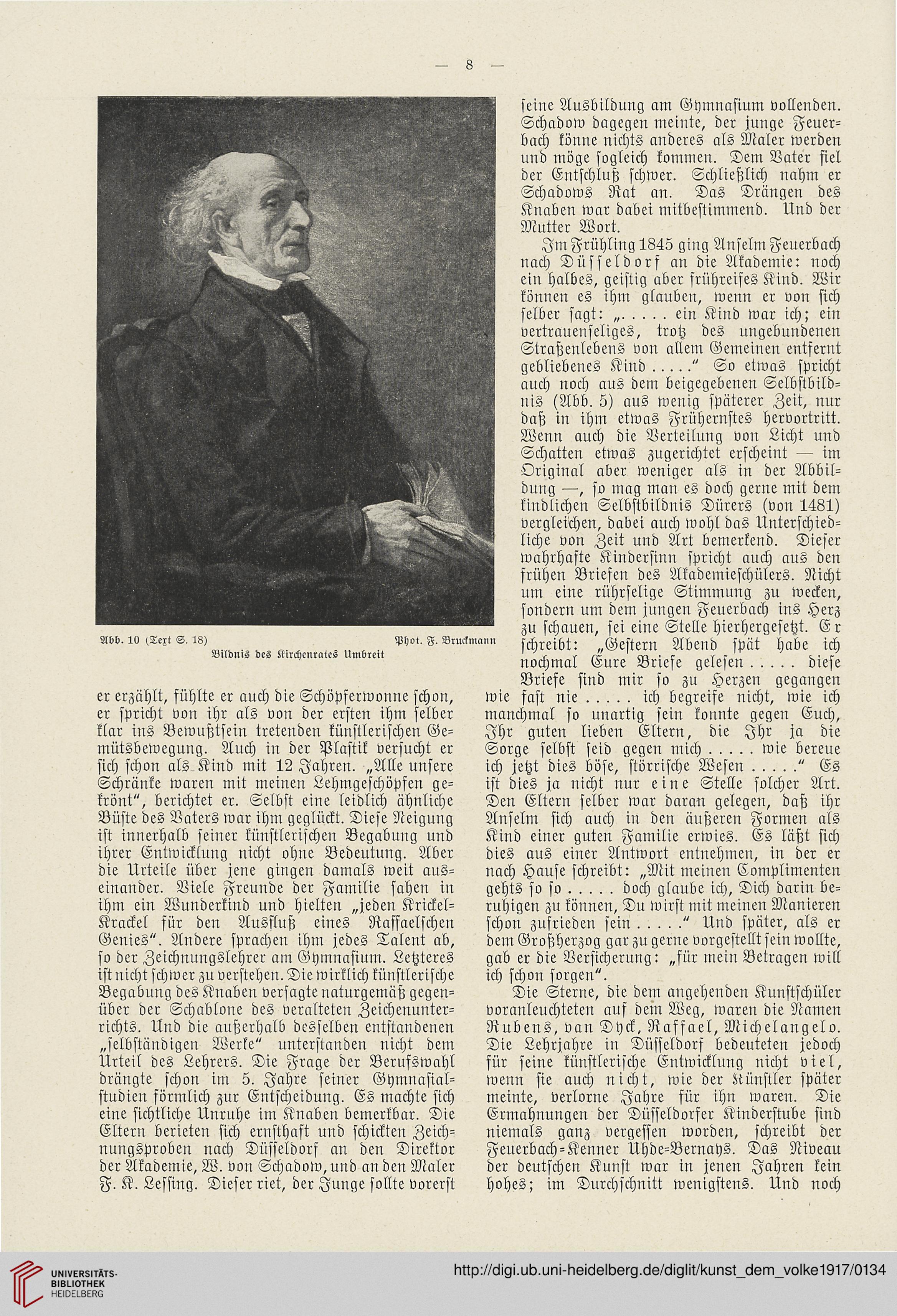8
Abb. 1ü (Text S. 18) Phot. F. Biuckmami
Bildnis des Kirchcnrates Umbreit
er erzählt, fühlte er auch die Schöpferwonne schon,
er spricht von ihr als von der ersten ihm selber
klar ins Bewußtsein tretenden künstlerischen Ge-
mütsbewegung. Auch in der Plastik versucht er
sich schon als Kind mit 12 Jahren. „Alle unsere
Schränke waren mit meinen Lehmgeschöpfen ge-
krönt", berichtet er. Selbst eine leidlich ähnliche
Büste des Vaters war ihm geglückt. Diese Neigung
ist innerhalb seiner künstlerischen Begabung und
ihrer Entwicklung nicht ohne Bedeutung. Aber
die Urteile über jene gingen damals weit aus-
einander. Viele Freunde der Familie sahen in
ihm ein Wunderkind und hielten „jeden Krickel-
Krackel für den Aussluß eines Raffaelschen
Genies". Andere sprachen ihm jedes Talent ab,
so der Zeichnungslehrer am Ghmnasium. Letzteres
istnicht schwer zu verstehen. Die wirklich künstlerische
Begabung des Knaben versagte naturgemäß gegen-
über der Schablone des veralteten Zeichenunter-
richts. Und die außerhalb desselben entstandenen
„selbständigen Werke" unterstanden nicht dem
Urteil des Lehrers. Die Frage der Berufswahl
drängte schon im 5. Jahre seiner Gymnasial-
studien förmlich zur Entscheidung. Es machte stch
eine sichtliche Unruhe im Knaben bemerkbar. Die
Eltern berieten sich ernsthaft und schickten Zeich-
nungsproben nach Düsseldorf an den Direktor
der Akademie, W. von Schadow, und an den Maler
F. K. Lessing. Dieser riet, der Junge sollte vorerst
seine Ausbildung am Gymnasium vollenden.
Schadow dagegen meinte, der junge Feuer-
bach könne nichts anderes als Maler werden
und möge sogleich kommen. Dem Vater fiel
der Entschluß schwer. Schließlich nahm er
Schadows Rat an. Das Drängen des
Knaben war dabei mitbestimmend. Und der
Mutter Wort.
Jm Frühling1845 ging Anselm Feuerbach
nach Düsseldorf an die Akademie: noch
ein halbes, geistig aber frühreifes Kind. Wir
können es ihm glauben, wenn er von sich
selber sagt: „.ein Kind war ich; ein
vertrauenseliges, trotz des ungebundenen
Straßenlebens von allem Gemeinen entfernt
gebliebenes Kind." So etwas spricht
auch noch aus dem beigegebenen Selbstbild-
nis (Abb. 5) aus wenig späterer Zeit, nur
daß in ihm etwas Frühernstes hervortritt.
Wenn auch die Verteilung von Licht und
Schatten etwas zugerichtet erscheint — im
Original aber weniger als in der Abbil-
dung —, so mag man es doch gerne mit dem
kindtichen Selbstbildnis Dürers (von 1481)
vergleichen, dabei auch wohl das Unterschied-
liche von Zeit und Art bemerkend. Dieser
wahrhafte Kindersinn spricht auch aus den
frühen Briefen des Akademieschülers. Nicht
um eine rührselige Stimmung zu wecken,
sondern um dem jungen Feuerbach ins Herz
zu schauen, sei eine Stelle hierhergesetzt. E r
schreibt: „Gestern Abend spät habe ich
nochmal Eure Briefe gelesen. diese
Briefe sind mir so zu Herzen gegangen
wie fast nie.ich begreife nicht, wie ich
manchmal so unartig sein konnte gegen Euch,
Jhr guten lieben Eltern, die Jhr ja die
Sorge selbst seid gegen mich.wie bereue
ich jetzt dies böse, störrische Wesen." Es
ist dies ja nicht nur eine Stelle solcher Art.
Den Eltern selber war daran gelegen, daß ihr
Anselm sich auch in den äußeren Formen als
Kind einer guten Familie erwies. Es läßt sich
dies aus einer Antwort entnehmen, in der er
nach Hause schreibt: „Mit meinen Complimenten
gehts so so.doch glaube ich, Dich darin be-
ruhigen zu können, Du wirst mit meinen Manieren
schon zufrieden sein." Und später, als er
dem Großherzog gar zu gerne vorgestellt sein wollte,
gab er die Versicherung: „für mein Betragen will
ich schon sorgen".
Die Sterne, die dem angehenden Kunstschüler
voranleuchteten auf dem Weg, waren die Namen
Rubens, van Dyck, Raffael, Michelangelo.
Die Lehrjahre in Düsseldorf bedeuteten jedoch
für seine künstlerische Entwicklung nicht viel,
wenn sie auch nicht, wie der Künstler später
meinte, verlorne Jahre für ihn waren. Die
Ermahnungen der Düsseldorfer Kinderstube sind
niemals ganz vergessen worden, schreibt der
Feuerbach-Kenner Uhde-Bernays. Das Niveau
der deutschen Kunst war in jenen Jahren kein
hohes; im Durchschnitt wenigstens. Und noch
Abb. 1ü (Text S. 18) Phot. F. Biuckmami
Bildnis des Kirchcnrates Umbreit
er erzählt, fühlte er auch die Schöpferwonne schon,
er spricht von ihr als von der ersten ihm selber
klar ins Bewußtsein tretenden künstlerischen Ge-
mütsbewegung. Auch in der Plastik versucht er
sich schon als Kind mit 12 Jahren. „Alle unsere
Schränke waren mit meinen Lehmgeschöpfen ge-
krönt", berichtet er. Selbst eine leidlich ähnliche
Büste des Vaters war ihm geglückt. Diese Neigung
ist innerhalb seiner künstlerischen Begabung und
ihrer Entwicklung nicht ohne Bedeutung. Aber
die Urteile über jene gingen damals weit aus-
einander. Viele Freunde der Familie sahen in
ihm ein Wunderkind und hielten „jeden Krickel-
Krackel für den Aussluß eines Raffaelschen
Genies". Andere sprachen ihm jedes Talent ab,
so der Zeichnungslehrer am Ghmnasium. Letzteres
istnicht schwer zu verstehen. Die wirklich künstlerische
Begabung des Knaben versagte naturgemäß gegen-
über der Schablone des veralteten Zeichenunter-
richts. Und die außerhalb desselben entstandenen
„selbständigen Werke" unterstanden nicht dem
Urteil des Lehrers. Die Frage der Berufswahl
drängte schon im 5. Jahre seiner Gymnasial-
studien förmlich zur Entscheidung. Es machte stch
eine sichtliche Unruhe im Knaben bemerkbar. Die
Eltern berieten sich ernsthaft und schickten Zeich-
nungsproben nach Düsseldorf an den Direktor
der Akademie, W. von Schadow, und an den Maler
F. K. Lessing. Dieser riet, der Junge sollte vorerst
seine Ausbildung am Gymnasium vollenden.
Schadow dagegen meinte, der junge Feuer-
bach könne nichts anderes als Maler werden
und möge sogleich kommen. Dem Vater fiel
der Entschluß schwer. Schließlich nahm er
Schadows Rat an. Das Drängen des
Knaben war dabei mitbestimmend. Und der
Mutter Wort.
Jm Frühling1845 ging Anselm Feuerbach
nach Düsseldorf an die Akademie: noch
ein halbes, geistig aber frühreifes Kind. Wir
können es ihm glauben, wenn er von sich
selber sagt: „.ein Kind war ich; ein
vertrauenseliges, trotz des ungebundenen
Straßenlebens von allem Gemeinen entfernt
gebliebenes Kind." So etwas spricht
auch noch aus dem beigegebenen Selbstbild-
nis (Abb. 5) aus wenig späterer Zeit, nur
daß in ihm etwas Frühernstes hervortritt.
Wenn auch die Verteilung von Licht und
Schatten etwas zugerichtet erscheint — im
Original aber weniger als in der Abbil-
dung —, so mag man es doch gerne mit dem
kindtichen Selbstbildnis Dürers (von 1481)
vergleichen, dabei auch wohl das Unterschied-
liche von Zeit und Art bemerkend. Dieser
wahrhafte Kindersinn spricht auch aus den
frühen Briefen des Akademieschülers. Nicht
um eine rührselige Stimmung zu wecken,
sondern um dem jungen Feuerbach ins Herz
zu schauen, sei eine Stelle hierhergesetzt. E r
schreibt: „Gestern Abend spät habe ich
nochmal Eure Briefe gelesen. diese
Briefe sind mir so zu Herzen gegangen
wie fast nie.ich begreife nicht, wie ich
manchmal so unartig sein konnte gegen Euch,
Jhr guten lieben Eltern, die Jhr ja die
Sorge selbst seid gegen mich.wie bereue
ich jetzt dies böse, störrische Wesen." Es
ist dies ja nicht nur eine Stelle solcher Art.
Den Eltern selber war daran gelegen, daß ihr
Anselm sich auch in den äußeren Formen als
Kind einer guten Familie erwies. Es läßt sich
dies aus einer Antwort entnehmen, in der er
nach Hause schreibt: „Mit meinen Complimenten
gehts so so.doch glaube ich, Dich darin be-
ruhigen zu können, Du wirst mit meinen Manieren
schon zufrieden sein." Und später, als er
dem Großherzog gar zu gerne vorgestellt sein wollte,
gab er die Versicherung: „für mein Betragen will
ich schon sorgen".
Die Sterne, die dem angehenden Kunstschüler
voranleuchteten auf dem Weg, waren die Namen
Rubens, van Dyck, Raffael, Michelangelo.
Die Lehrjahre in Düsseldorf bedeuteten jedoch
für seine künstlerische Entwicklung nicht viel,
wenn sie auch nicht, wie der Künstler später
meinte, verlorne Jahre für ihn waren. Die
Ermahnungen der Düsseldorfer Kinderstube sind
niemals ganz vergessen worden, schreibt der
Feuerbach-Kenner Uhde-Bernays. Das Niveau
der deutschen Kunst war in jenen Jahren kein
hohes; im Durchschnitt wenigstens. Und noch