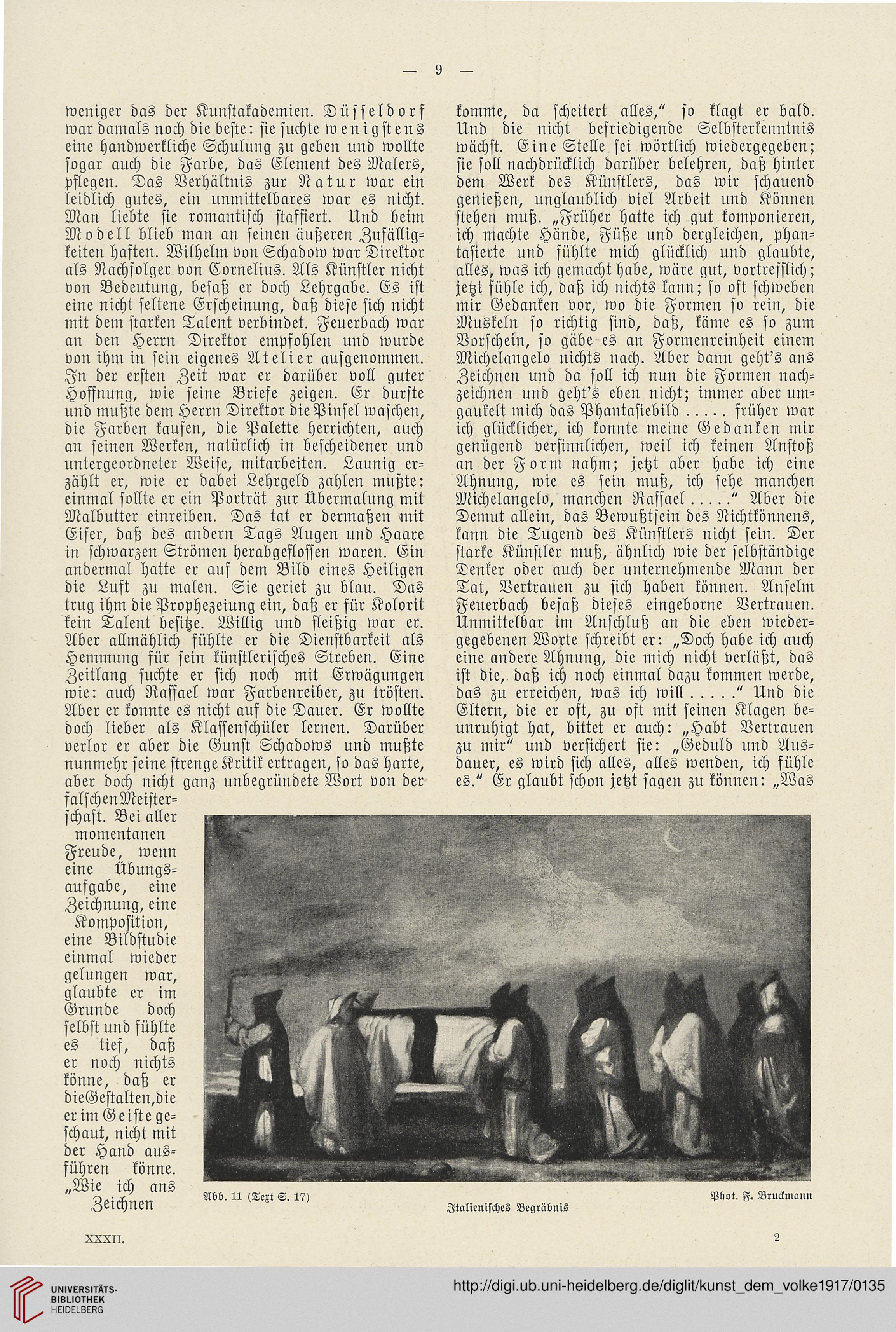9
weniger das der Kunstakademien. Düsseldorf
war damals noch die beste: sie suchte weni gstens
eine handwerkliche Schulung zu geben und wollte
sogar auch die Farbe, das Element des Malers,
pflegen. Das Verhältnis zur Natur war ein
leidlich gutes, ein unmittelbares war es nicht.
Man liebte sie romantisch staffiert. Und beim
Modell blieb man an seinen äußeren Zufällig-
keiten haften. Wilhelm von Schadow war Direktor
als Nachfolger von Cornelius. Als Künstler nicht
von Bedeutung, besaß er doch Lehrgabe. Es ist
eine nicht seltene Erscheinung, daß diese stch nicht
mit dem starken Talent verbindet. Feuerbach war
an den Herrn Direktor empfohlen und wurde
von ihm in sein eigenes Atelier aufgenommen.
Jn der ersten Zeit war er darüber voll guter
Hoffnung, wie seine Briefe zeigen. Er durfte
und mußte dem Herrn Direktor die Pinsel waschen,
die Farben kaufen, die Palette herrichten, auch
an seinen Werken, natürlich in bescheidener und
untergeordneter Weise, mitarbeiten. Launig er-
zählt er, wie er dabei Lehrgeld zahlen mußte:
einmal sollte er ein Porträt zur Übermalung mit
Malbutter einreiben. Das tat er dermaßen mit
Eifer, daß des andern Tags Augen und Haare
in schwarzen Strömen herabgeflossen waren. Ein
andermal hatte er auf dem Bild eines Heiligen
die Luft zu malen. Sie geriet zu blau. Das
trug ihm die Prophezeiung ein, daß er für Kolorit
kein Talent besitze. Willig und sleißig war er.
Aber allmählich fühlte er die Dienstbarkeit als
Hemmung für sein künstlerisches Streben. Eine
Zeitlang suchte er sich noch mit Erwägungen
wie: auch Raffael war Farbenreiber, zu trösten.
Aber er konnte es nicht auf die Dauer. Er wollte
doch lieber als Klassenschüler lernen. Darüber
verlor er aber die Gunst Schadows und mußte
nunmehr seine strenge Kritik ertragen, so das harte,
aber doch nicht ganz unbegründete Wort von der
falschenMeister-
schaft. Bei aller
momentanen
Freude, wenn
eine Qbungs-
aufgabe, eine
Zeichnung, eine
Komposition,
eine Bildstudie
einmal wieder
gelungen war,
glaubte er im
Grunde doch
selbst und fühlte
es tief, daß
er noch nichts
könne, daß er
dieGestalten,die
erim Geiste ge-
schaut, nicht mit
der Hand aus-
führen könne.
„Wie ich ans
Zeichnen
komme, da scheitert alles," so klagt er bald.
Und die nicht befriedigende Selbsterkenntnis
wächst. Eine Stelle sei wörtlich wiedergegeben;
ste soll nachdrücklich darüber belehren, daß hinter
dem Werk des Künstlers, das wir schauend
genießen, unglaublich viel Arbeit und Können
stehen muß. „Früher hatte ich gut komponieren,
ich machte Hände, Füße und dergleichen, phan-
tasierte und fühlte mich glücklich und glaubte,
alles, was ich gemacht habe, wäre gut, vortrefflich;
jetzt fühle ich, daß ich nichts kann; so oft schweben
mir Gedanken vor, wo die Formen so rein, die
Muskeln so richtig sind, daß, käme es so zum
Vorschein, so gäbe es an Formenreinheit einem
Michelangelo nichts nach. Aber dann geht's ans
Zeichnen und da soll ich nun die Formen nach-
zeichnen und geht's eben nicht; immer aber um-
gaukelt mich das Phantasiebild.früher war
ich glücklicher, ich konnte meine Gedanken mir
genügend versinnlichen, weil ich keinen Anstoß
an der Form nahm; jetzt aber habe ich eine
Ahnung, wie es sein muß, ich sehe manchen
Michelangelo, manchen Raffael." Aber die
Demut allein, das Bewußtsein des Nichtkönnens,
kann die Tugend des Künstlers nicht sein. Der
starke Künstler muß, ähnlich wie der selbständige
Denker oder auch dec unternehmende Mann der
Tat, Vertrauen zu sich haben können. Anselm
Feuerbach besaß dieses eingeborne Vertrauen.
Unmittelbar im Anschluß an die eben wieder-
gegebenen Worte schreibt er: „Doch habe ich auch
eine andere Ahnung, die mich nicht verläßt, das
ist die, daß ich noch einmal dazu kommen werde,
das zu erreichen, was ich will." Und die
Eltern, die er oft, zu oft mit seinen Klagen be-
unruhigt hat, bittet er auch: „Habt Verlrauen
zu mir" und versichert sie: „Geduld und Aus-
dauer, es wird sich alles, alles wenden, ich fühle
es." Er glaubt schon jetzt sagen zu können: „Was
Abb. 11 (Tcxt S. 17) Pbot. F. Bruckmann
Jtalienisches Begräbnis
XXXII.
2
weniger das der Kunstakademien. Düsseldorf
war damals noch die beste: sie suchte weni gstens
eine handwerkliche Schulung zu geben und wollte
sogar auch die Farbe, das Element des Malers,
pflegen. Das Verhältnis zur Natur war ein
leidlich gutes, ein unmittelbares war es nicht.
Man liebte sie romantisch staffiert. Und beim
Modell blieb man an seinen äußeren Zufällig-
keiten haften. Wilhelm von Schadow war Direktor
als Nachfolger von Cornelius. Als Künstler nicht
von Bedeutung, besaß er doch Lehrgabe. Es ist
eine nicht seltene Erscheinung, daß diese stch nicht
mit dem starken Talent verbindet. Feuerbach war
an den Herrn Direktor empfohlen und wurde
von ihm in sein eigenes Atelier aufgenommen.
Jn der ersten Zeit war er darüber voll guter
Hoffnung, wie seine Briefe zeigen. Er durfte
und mußte dem Herrn Direktor die Pinsel waschen,
die Farben kaufen, die Palette herrichten, auch
an seinen Werken, natürlich in bescheidener und
untergeordneter Weise, mitarbeiten. Launig er-
zählt er, wie er dabei Lehrgeld zahlen mußte:
einmal sollte er ein Porträt zur Übermalung mit
Malbutter einreiben. Das tat er dermaßen mit
Eifer, daß des andern Tags Augen und Haare
in schwarzen Strömen herabgeflossen waren. Ein
andermal hatte er auf dem Bild eines Heiligen
die Luft zu malen. Sie geriet zu blau. Das
trug ihm die Prophezeiung ein, daß er für Kolorit
kein Talent besitze. Willig und sleißig war er.
Aber allmählich fühlte er die Dienstbarkeit als
Hemmung für sein künstlerisches Streben. Eine
Zeitlang suchte er sich noch mit Erwägungen
wie: auch Raffael war Farbenreiber, zu trösten.
Aber er konnte es nicht auf die Dauer. Er wollte
doch lieber als Klassenschüler lernen. Darüber
verlor er aber die Gunst Schadows und mußte
nunmehr seine strenge Kritik ertragen, so das harte,
aber doch nicht ganz unbegründete Wort von der
falschenMeister-
schaft. Bei aller
momentanen
Freude, wenn
eine Qbungs-
aufgabe, eine
Zeichnung, eine
Komposition,
eine Bildstudie
einmal wieder
gelungen war,
glaubte er im
Grunde doch
selbst und fühlte
es tief, daß
er noch nichts
könne, daß er
dieGestalten,die
erim Geiste ge-
schaut, nicht mit
der Hand aus-
führen könne.
„Wie ich ans
Zeichnen
komme, da scheitert alles," so klagt er bald.
Und die nicht befriedigende Selbsterkenntnis
wächst. Eine Stelle sei wörtlich wiedergegeben;
ste soll nachdrücklich darüber belehren, daß hinter
dem Werk des Künstlers, das wir schauend
genießen, unglaublich viel Arbeit und Können
stehen muß. „Früher hatte ich gut komponieren,
ich machte Hände, Füße und dergleichen, phan-
tasierte und fühlte mich glücklich und glaubte,
alles, was ich gemacht habe, wäre gut, vortrefflich;
jetzt fühle ich, daß ich nichts kann; so oft schweben
mir Gedanken vor, wo die Formen so rein, die
Muskeln so richtig sind, daß, käme es so zum
Vorschein, so gäbe es an Formenreinheit einem
Michelangelo nichts nach. Aber dann geht's ans
Zeichnen und da soll ich nun die Formen nach-
zeichnen und geht's eben nicht; immer aber um-
gaukelt mich das Phantasiebild.früher war
ich glücklicher, ich konnte meine Gedanken mir
genügend versinnlichen, weil ich keinen Anstoß
an der Form nahm; jetzt aber habe ich eine
Ahnung, wie es sein muß, ich sehe manchen
Michelangelo, manchen Raffael." Aber die
Demut allein, das Bewußtsein des Nichtkönnens,
kann die Tugend des Künstlers nicht sein. Der
starke Künstler muß, ähnlich wie der selbständige
Denker oder auch dec unternehmende Mann der
Tat, Vertrauen zu sich haben können. Anselm
Feuerbach besaß dieses eingeborne Vertrauen.
Unmittelbar im Anschluß an die eben wieder-
gegebenen Worte schreibt er: „Doch habe ich auch
eine andere Ahnung, die mich nicht verläßt, das
ist die, daß ich noch einmal dazu kommen werde,
das zu erreichen, was ich will." Und die
Eltern, die er oft, zu oft mit seinen Klagen be-
unruhigt hat, bittet er auch: „Habt Verlrauen
zu mir" und versichert sie: „Geduld und Aus-
dauer, es wird sich alles, alles wenden, ich fühle
es." Er glaubt schon jetzt sagen zu können: „Was
Abb. 11 (Tcxt S. 17) Pbot. F. Bruckmann
Jtalienisches Begräbnis
XXXII.
2