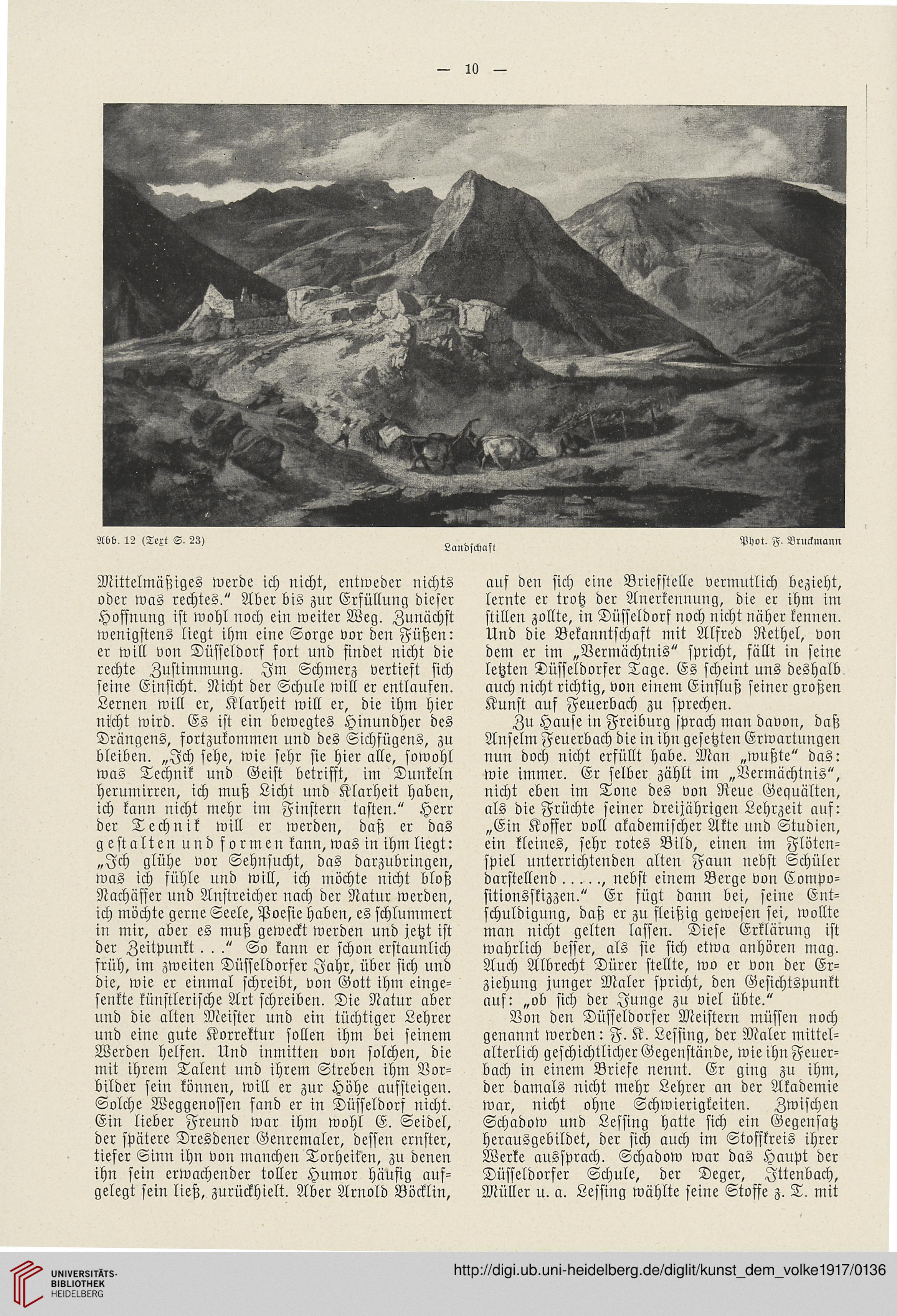10
Abb, 12 <Text S. 23)
Mittelmäßiges werde ich nicht, entweder nichts
oder was rechtes." Aber bis zur Erfüllung dieser
Hoffnung ist wohl noch ein weiter Weg. Zunächst
wenigstens liegt ihm eine Sorge vor den Füßen:
er will von Düsseldorf fort und findet nicht die
rechte Zustimmung. Jm Schmerz vertieft sich
seine Einsicht. Nicht der Schule will er entlaufen.
Lernen will er, Klarheit will er, die ihm hier
nicht wird. Es ist ein bewegtes Hinundher des
Drängens, fortzukommen und des Sichfügens, zu
bleiben. „Jch sehe, wie sehr sie hier alle, sowohl
was Technik und Geist betrifft, im Dunkeln
herumirren, ich muß Licht und Klarheit haben,
ich kann nicht mehr im Finstern tasten." Herr
der Technik will er werden, daß er das
g estalten und formen kann, was in ihm liegt:
„Jch glühe vor Sehnsucht, das darzubringen,
was ich fühle und will, ich möchte nicht bloß
Nachäffer und Anstreicher nach der Natur werden,
ich möchte gerne Seele, Poeste haben, es schlummert
in mir, aber es muß geweckt werden und jetzt ist
der Zeitpunkt. . ." So kann er schon erstaunlich
früh, im zweiten Düsseldorfer Jahr, über stch und
die, wie er einmal schreibt, von Gott ihm einge-
senkte künstlerische Art schreiben. Die Natur aber
und die alten Meister und ein tüchtiger Lehrer
und eine gute Korrektur sollen ihm bei seinem
Werden helfen. Und inmitten von solchen, die
mit ihrem Talent und ihrem Streben ihm Vor-
bilder sein können, will er zur Höhe aufsteigen.
Solche Weggenossen fand er in Düsseldorf nicht.
Ein lieber Freund war ihm wohl E. Seidel,
der spätere Dresdener Genremaler, dessen ernster,
tiefer Sinn ihn von manchen Torheiten, zu denen
ihn sein erwachender toller Humor häufig aus-
gelegt sein ließ, zurückhielt. Aber Arnold Böcklin,
Phot. F. Bruckmann
auf den sich eine Briefstelle vermutlich bezieht,
lernte er trotz der Anerkennung, die er ihm im
stillen zollte, in Düsseldorf noch nicht näher kennen.
Und die Bekanntschaft mit Alfred Rethel, von
dem er im „Vermächtnis" spricht, fällt in seine
letzten Düsseldorser Tage. Es scheint uns deshalb
auch nicht richtig, von einem Einfluß seiner großen
Kunst aus Feuerbach zu sprechen.
Zu Hause in Freiburg sprach man davon, daß
Anselm Feuerbach die in ihn gesetzten Erwartungen
nun doch nicht erfüllt habe. Man „wußte" das:
wie immer. Er selber zählt im „Vermächtnis",
nicht eben im Tone des von Reue Gequälten,
als die Früchte seiner dreijährigen Lehrzeit auf:
„Ein Koffer voll akademischer Akte und Studien,
ein kleines, sehr rotes Bild, einen im Flöten-
spiel unterrichtenden alten Faun nebst Schüler
darstellend., nebst einem Berge von Compo-
sitionsskizzen." Er fügt dann bei, seine Ent-
schuldigung, daß er zu sleißig gewesen sei, wollte
man nicht gelten lassen. Diese Erklärung ist
wahrlich besser, als sie sich etwa anhören mag.
Auch Albrecht Dürer stellte, wo er von der Er-
ziehung junger Maler spricht, den Gesichtspunkt
auf: „ob sich der Junge zu viel übte."
Von den Düsseldorfer Meistern müssen noch
genannt werden: F. K. Lessing, der Maler mittel-
alterlich geschichtlicher Gegenstände, wie ihn Feuer-
bach in einem Briefe nennt. Er ging zu ihm,
der damals nicht mehr Lehrer an der Akademie
war, nicht ohne Schwierigkeiten. Zwischen
Schadow und Lessing hatte sich ein Gegensatz
herausgebildet, der sich auch im Stoffkreis ihrer
Werke aussprach. Schadow war das Haupt der
Düsseldorfer Schule, der Deger, Jttenbach,
Müller u. a. Lessing wählte seine Stoffe z. T. mit
Landschast
Abb, 12 <Text S. 23)
Mittelmäßiges werde ich nicht, entweder nichts
oder was rechtes." Aber bis zur Erfüllung dieser
Hoffnung ist wohl noch ein weiter Weg. Zunächst
wenigstens liegt ihm eine Sorge vor den Füßen:
er will von Düsseldorf fort und findet nicht die
rechte Zustimmung. Jm Schmerz vertieft sich
seine Einsicht. Nicht der Schule will er entlaufen.
Lernen will er, Klarheit will er, die ihm hier
nicht wird. Es ist ein bewegtes Hinundher des
Drängens, fortzukommen und des Sichfügens, zu
bleiben. „Jch sehe, wie sehr sie hier alle, sowohl
was Technik und Geist betrifft, im Dunkeln
herumirren, ich muß Licht und Klarheit haben,
ich kann nicht mehr im Finstern tasten." Herr
der Technik will er werden, daß er das
g estalten und formen kann, was in ihm liegt:
„Jch glühe vor Sehnsucht, das darzubringen,
was ich fühle und will, ich möchte nicht bloß
Nachäffer und Anstreicher nach der Natur werden,
ich möchte gerne Seele, Poeste haben, es schlummert
in mir, aber es muß geweckt werden und jetzt ist
der Zeitpunkt. . ." So kann er schon erstaunlich
früh, im zweiten Düsseldorfer Jahr, über stch und
die, wie er einmal schreibt, von Gott ihm einge-
senkte künstlerische Art schreiben. Die Natur aber
und die alten Meister und ein tüchtiger Lehrer
und eine gute Korrektur sollen ihm bei seinem
Werden helfen. Und inmitten von solchen, die
mit ihrem Talent und ihrem Streben ihm Vor-
bilder sein können, will er zur Höhe aufsteigen.
Solche Weggenossen fand er in Düsseldorf nicht.
Ein lieber Freund war ihm wohl E. Seidel,
der spätere Dresdener Genremaler, dessen ernster,
tiefer Sinn ihn von manchen Torheiten, zu denen
ihn sein erwachender toller Humor häufig aus-
gelegt sein ließ, zurückhielt. Aber Arnold Böcklin,
Phot. F. Bruckmann
auf den sich eine Briefstelle vermutlich bezieht,
lernte er trotz der Anerkennung, die er ihm im
stillen zollte, in Düsseldorf noch nicht näher kennen.
Und die Bekanntschaft mit Alfred Rethel, von
dem er im „Vermächtnis" spricht, fällt in seine
letzten Düsseldorser Tage. Es scheint uns deshalb
auch nicht richtig, von einem Einfluß seiner großen
Kunst aus Feuerbach zu sprechen.
Zu Hause in Freiburg sprach man davon, daß
Anselm Feuerbach die in ihn gesetzten Erwartungen
nun doch nicht erfüllt habe. Man „wußte" das:
wie immer. Er selber zählt im „Vermächtnis",
nicht eben im Tone des von Reue Gequälten,
als die Früchte seiner dreijährigen Lehrzeit auf:
„Ein Koffer voll akademischer Akte und Studien,
ein kleines, sehr rotes Bild, einen im Flöten-
spiel unterrichtenden alten Faun nebst Schüler
darstellend., nebst einem Berge von Compo-
sitionsskizzen." Er fügt dann bei, seine Ent-
schuldigung, daß er zu sleißig gewesen sei, wollte
man nicht gelten lassen. Diese Erklärung ist
wahrlich besser, als sie sich etwa anhören mag.
Auch Albrecht Dürer stellte, wo er von der Er-
ziehung junger Maler spricht, den Gesichtspunkt
auf: „ob sich der Junge zu viel übte."
Von den Düsseldorfer Meistern müssen noch
genannt werden: F. K. Lessing, der Maler mittel-
alterlich geschichtlicher Gegenstände, wie ihn Feuer-
bach in einem Briefe nennt. Er ging zu ihm,
der damals nicht mehr Lehrer an der Akademie
war, nicht ohne Schwierigkeiten. Zwischen
Schadow und Lessing hatte sich ein Gegensatz
herausgebildet, der sich auch im Stoffkreis ihrer
Werke aussprach. Schadow war das Haupt der
Düsseldorfer Schule, der Deger, Jttenbach,
Müller u. a. Lessing wählte seine Stoffe z. T. mit
Landschast