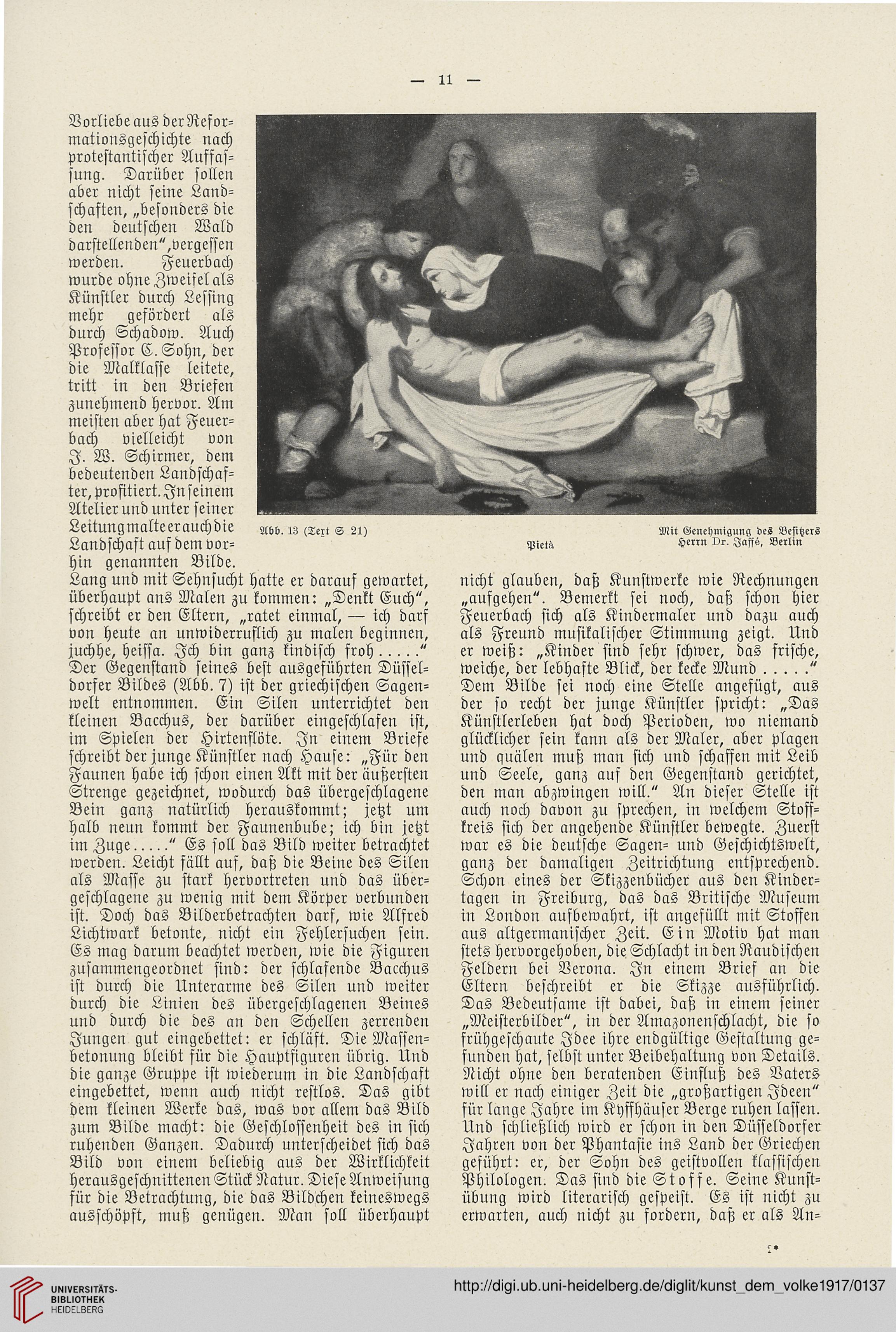11
Vorliebeaus derRefor-
mationsgeschichte nach
protestantischer Auffas-
sung. Darüber sollen
aber nicht seine Land-
schaften, „besonders die
den deutschen Wald
darstellenden",vergessen
werden. Feuerbach
wurde ohne Zweifel als
Künstler durch Lessing
mehr gefördert als
durch Schadow. Auch
Professor C. Sohn, der
die Malklasse leitete,
tritt in den Briefen
zunehmend hervor. Am
meisten aber hat Feuer-
bach vielleicht von
I. W. Schirmer, dem
bedeutenden Landschaf-
ter, profitiert. Jn seinem
Atelierund unter seiner
Leitungmalteerauchdie Abb. 18 cTert S 21)
Landschaft auf dem vor-
hin genannten Bilde.
Lang und mit Sehnsucht hatte er darauf gewartet,
überhaupt ans Malen zu kommen: „Denkt Euch",
schreibt er den Eltern, „ratet einmal, — ich darf
von heute an unwiderruflich zu malen beginnen,
juchhe, heissa. Jch bin ganz kindisch froh."
Der Gegenstand seines best ausgeführten Düssel-
dorfer Bildes (Abb. 7) ist der griechischen Sagen-
welt entnommen. Ein Silen unterrichtet den
kleinen Bacchus, der darüber eingeschlafen ist,
im Spielen der Hirtenflöte. Jn einem Briefe
schreibt der junge Künstler nach Hause: „Für den
Faunen habe ich schon einen Akt mit der äußersten
Strenge gezeichnet, wodurch das übergeschlagene
Bein ganz natürlich herauskommt; jetzt um
halb neun kommt der Faunenbube; ich bin jetzt
im Zuge." Es soll das Bild weiter betrachtet
werden. Leicht fällt auf, daß die Beine des Silen
als Masse zu stark hervortreten und das über-
geschlagene zu wenig mit dem Körper verbunden
ist. Doch das Bilderbetrachten darf, wie Alfred
Lichtwark betonte, nicht ein Fehlersuchen sein.
Es mag darum beachtet werden, wie die Figuren
zusammengeordnet sind: der schlafende Bacchus
ist durch die Unterarme des Silen und weiter
durch die Linien des übergeschlagenen Beines
und durch die des an den Schellen zerrenden
Jungen gut eingebettet: er schläft. Die Massen-
betonung bleibt für die Hauptfiguren übrig. Und
die ganze Gruppe ist wiederum in die Landschaft
eingebettet, wenn auch nicht restlos. Das gibt
dem kleinen Werke das, was vor allem das Bild
zum Bilde macht: die Geschlossenheit des in sich
ruhenden Ganzen. Dadurch uuterscheidet sich das
Bild von einem beliebig aus der Wirklichkeit
herausgeschnittenen Stück Natur. Diese Anweisung
für die Betrachtung, die das Bildchen keineswegs
ausschöpft, muß genügen. Man soll überhaupt
Mit Genehmigung des Bcsitzers
PietL Herrn vr. Jaffo. Berlin
nicht glauben, daß Kunstwerke wie Rechnungen
„aufgehen". Bemerkt sei noch, daß schon hier
Feuerbach sich als Kindermaler und dazu auch
als Freund musikalischer Stimmung zeigt. Und
er weiß: „Kinder sind sehr schwer, das frische,
weiche, der lebhafte Blick, der kecke Mund."
Dem Bilde sei noch eine Stelle angefügt, aus
der so recht der junge Künstler spricht: „Das
Künstlerleben hat doch Perioden, wo niemand
glücklicher sein kann als der Maler, aber plagen
und quälen muß man sich und schaffen mit Leib
und Seele, ganz auf den Gegenstand gerichtet,
den man abzwingen will." An dieser Stelle ist
auch noch davon zu sprechen, in welchem Stoff-
kreis sich der angehende Künstler bewegte. Zuerst
war es die deutsche Sagen- und Geschichtswelt,
ganz der damaligen Zeitrichtung entsprechend.
Schon eines der Skizzenbücher aus den Kinder-
tagen in Freiburg, das das Britische Museum
in London aufbewahrt, ist angefüllt mit Stoffen
aus altgermanischer Zeit. Ein Motiv hat man
stets hervorgehoben, die Schlacht in den Raudischen
Feldern bei Verona. Jn einem Brief an die
Eltern beschreibt er die Skizze ausführlich.
Das Bedeutsame ist dabei, daß in einem seiner
„Meisterbilder", in der Amazonenschlacht, die so
frühgeschaute Jdee ihre endgültige Gestaltung ge-
funden hat, selbst unter Beibehaltung von Details.
Nicht ohne den beratenden Einfluß des Vaters
will er nach einiger Zeit die „großartigen Jdeen"
für lange Jahre im Kyffhäuser Berge ruhen lassen.
Und schließlich wird er schon in den Düsseldorfer
Jahren von der Phantasie ins Land der Griechen
geführt: er, der Sohn des geistvollen klassischen
Philologen. Das sind die Stoffe. Seine Kunst-
übung wird literarisch gespeist. Es ist nicht zu
erwarten, auch nicht zu fordern, daß er als An-
Vorliebeaus derRefor-
mationsgeschichte nach
protestantischer Auffas-
sung. Darüber sollen
aber nicht seine Land-
schaften, „besonders die
den deutschen Wald
darstellenden",vergessen
werden. Feuerbach
wurde ohne Zweifel als
Künstler durch Lessing
mehr gefördert als
durch Schadow. Auch
Professor C. Sohn, der
die Malklasse leitete,
tritt in den Briefen
zunehmend hervor. Am
meisten aber hat Feuer-
bach vielleicht von
I. W. Schirmer, dem
bedeutenden Landschaf-
ter, profitiert. Jn seinem
Atelierund unter seiner
Leitungmalteerauchdie Abb. 18 cTert S 21)
Landschaft auf dem vor-
hin genannten Bilde.
Lang und mit Sehnsucht hatte er darauf gewartet,
überhaupt ans Malen zu kommen: „Denkt Euch",
schreibt er den Eltern, „ratet einmal, — ich darf
von heute an unwiderruflich zu malen beginnen,
juchhe, heissa. Jch bin ganz kindisch froh."
Der Gegenstand seines best ausgeführten Düssel-
dorfer Bildes (Abb. 7) ist der griechischen Sagen-
welt entnommen. Ein Silen unterrichtet den
kleinen Bacchus, der darüber eingeschlafen ist,
im Spielen der Hirtenflöte. Jn einem Briefe
schreibt der junge Künstler nach Hause: „Für den
Faunen habe ich schon einen Akt mit der äußersten
Strenge gezeichnet, wodurch das übergeschlagene
Bein ganz natürlich herauskommt; jetzt um
halb neun kommt der Faunenbube; ich bin jetzt
im Zuge." Es soll das Bild weiter betrachtet
werden. Leicht fällt auf, daß die Beine des Silen
als Masse zu stark hervortreten und das über-
geschlagene zu wenig mit dem Körper verbunden
ist. Doch das Bilderbetrachten darf, wie Alfred
Lichtwark betonte, nicht ein Fehlersuchen sein.
Es mag darum beachtet werden, wie die Figuren
zusammengeordnet sind: der schlafende Bacchus
ist durch die Unterarme des Silen und weiter
durch die Linien des übergeschlagenen Beines
und durch die des an den Schellen zerrenden
Jungen gut eingebettet: er schläft. Die Massen-
betonung bleibt für die Hauptfiguren übrig. Und
die ganze Gruppe ist wiederum in die Landschaft
eingebettet, wenn auch nicht restlos. Das gibt
dem kleinen Werke das, was vor allem das Bild
zum Bilde macht: die Geschlossenheit des in sich
ruhenden Ganzen. Dadurch uuterscheidet sich das
Bild von einem beliebig aus der Wirklichkeit
herausgeschnittenen Stück Natur. Diese Anweisung
für die Betrachtung, die das Bildchen keineswegs
ausschöpft, muß genügen. Man soll überhaupt
Mit Genehmigung des Bcsitzers
PietL Herrn vr. Jaffo. Berlin
nicht glauben, daß Kunstwerke wie Rechnungen
„aufgehen". Bemerkt sei noch, daß schon hier
Feuerbach sich als Kindermaler und dazu auch
als Freund musikalischer Stimmung zeigt. Und
er weiß: „Kinder sind sehr schwer, das frische,
weiche, der lebhafte Blick, der kecke Mund."
Dem Bilde sei noch eine Stelle angefügt, aus
der so recht der junge Künstler spricht: „Das
Künstlerleben hat doch Perioden, wo niemand
glücklicher sein kann als der Maler, aber plagen
und quälen muß man sich und schaffen mit Leib
und Seele, ganz auf den Gegenstand gerichtet,
den man abzwingen will." An dieser Stelle ist
auch noch davon zu sprechen, in welchem Stoff-
kreis sich der angehende Künstler bewegte. Zuerst
war es die deutsche Sagen- und Geschichtswelt,
ganz der damaligen Zeitrichtung entsprechend.
Schon eines der Skizzenbücher aus den Kinder-
tagen in Freiburg, das das Britische Museum
in London aufbewahrt, ist angefüllt mit Stoffen
aus altgermanischer Zeit. Ein Motiv hat man
stets hervorgehoben, die Schlacht in den Raudischen
Feldern bei Verona. Jn einem Brief an die
Eltern beschreibt er die Skizze ausführlich.
Das Bedeutsame ist dabei, daß in einem seiner
„Meisterbilder", in der Amazonenschlacht, die so
frühgeschaute Jdee ihre endgültige Gestaltung ge-
funden hat, selbst unter Beibehaltung von Details.
Nicht ohne den beratenden Einfluß des Vaters
will er nach einiger Zeit die „großartigen Jdeen"
für lange Jahre im Kyffhäuser Berge ruhen lassen.
Und schließlich wird er schon in den Düsseldorfer
Jahren von der Phantasie ins Land der Griechen
geführt: er, der Sohn des geistvollen klassischen
Philologen. Das sind die Stoffe. Seine Kunst-
übung wird literarisch gespeist. Es ist nicht zu
erwarten, auch nicht zu fordern, daß er als An-