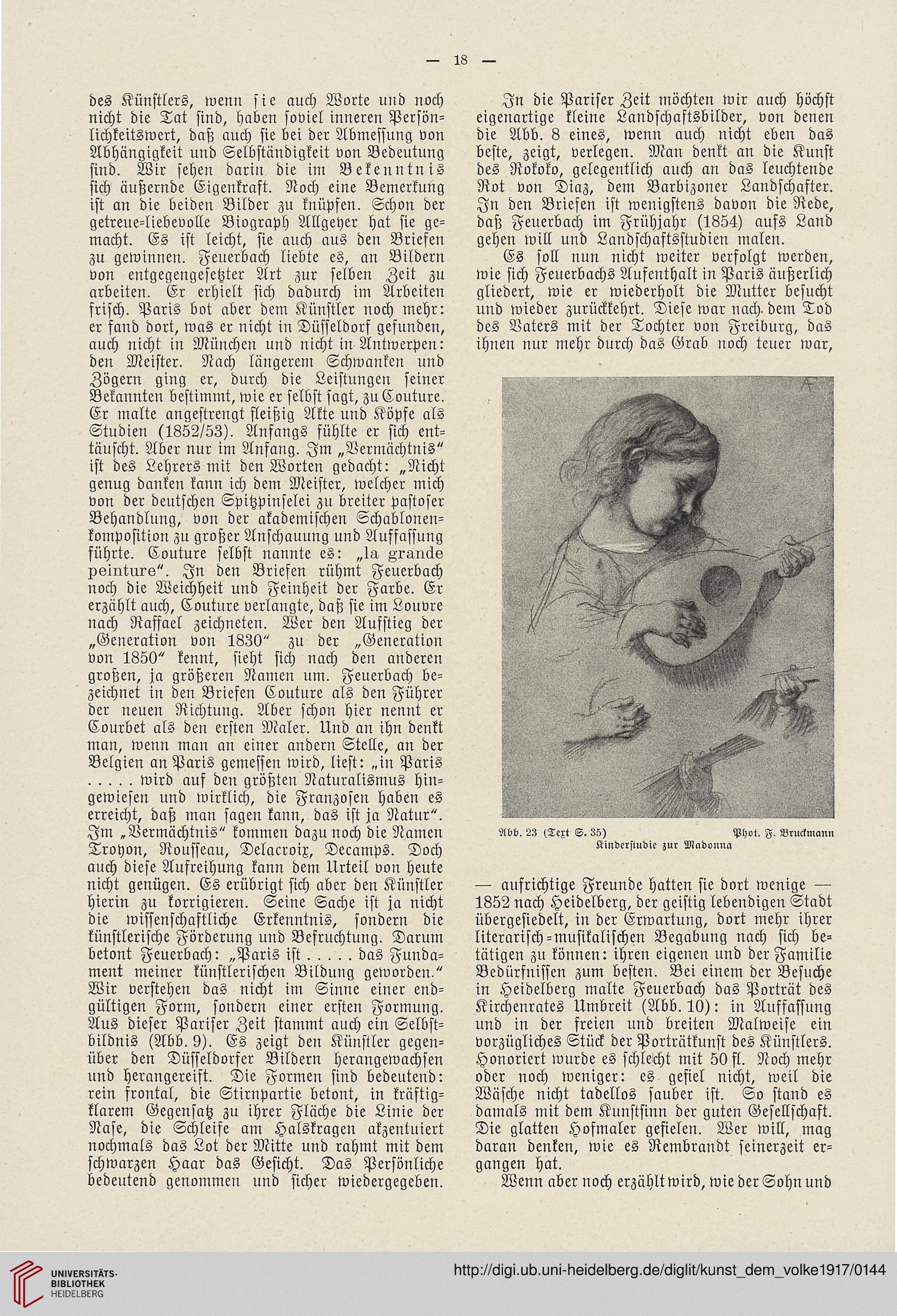18
des Künstlers, wenn sie auch Worte und noch
nicht die Tat sind, haben soviel inneren Persön-
lichkeitswert, daß auch sie bei der Abmessung von
Abhängigkeit und Selbständigkeit von Bedeutung
sind. Wir sehen darin die im Bekenntnis
sich äußernde Eigenkraft. Noch eine Bemerkung
ist an die beiden Bilder zu knüpfen. Schon der
getreue-Iiebevolle Biograph Allgeyer hat sie ge-
macht. Es ist leicht, sie auch aus den Briefen
zu gewinnen. Feuerbach liebte es, an Bildern
von entgegengesetzter Art zur selben Zeit zu
arbeiten. Er erhielt sich dadurch im Arbeiten
frisch. Paris bot aber dem Künstler noch mehr:
er fand dort, was er nicht in Düsseldorf gefunden,
auch nicht in München und nicht in Antwerpen:
den Meister. Nach längerem Schwanken und
Zögern ging er, durch die Leistungen seiner
Bekannten bestimmt, wie er selbst sagt, zu Couture.
Er malte angestrengt fleißig Akte und Köpfe als
Studien (1852/53). Anfangs fühlte er sich ent-
täuscht. Aber nur im Anfang. Jm „Vermächtnis"
ist des Lehrers mit den Worten gedacht: „Nicht
genug danken kann ich dem Meister, welcher mich
von der deutschen Spitzpinselei zu breiter pastoser
Behandlung, von der akademischen Schablonen-
komposition zu großer Anschauung und Auffassung
führte. Couture selbst nannte es: „is, Ai-uiiäk
psiiitm-k". Jn den Briefen rühmt Feuerbach
noch die Weichheit und Feinheit der Farbe. Er
erzählt auch, Couture verlangte, daß sie im Louvre
nach Raffael zeichneten. Wer den Aufstieg der
„Generation von 1830" zu der „Generation
von 1850" kennt, steht sich nach den anderen
großen, ja größeren Namen um. Feuerbach be-
zeichnet in den Briefen Couture als den Führer
der neuen Richtung. Aber schon hier nennt er
Courbet als den ersten Maler. Und an ihn denkt
man, wenn man an einer andern Stelle, an der
Belgien an Paris gemessen wird, liest: „in Paris
.wird auf den größten Naturalismus hin-
gewiesen und wirklich, die Franzosen haben es
erreicht, daß man sagen kann, das ist ja Natur".
Jm „Vermächtnis" kommen dazu noch die Namen
Troyon, Rouffeau, Delacroix, Decamps. Doch
auch diese Aufreihung kann dem Urteil von heute
nicht genügen. Es erübrigt sich aber den Künstler
hierin zu korrigieren. Seine Sache ist ja nicht
die wissenschaftliche Erkenntnis, sondern die
künstlerische Förderung und Besruchtung. Darum
betont Feuerbach: „Paris ist.das Funda-
ment meiner künstlerischen Bildung geworden."
Wir verstehen das nicht im Sinne einer end-
gültigen Form, sondern einer ersten Formung.
Aus dieser Pariser Zeit stammt auch ein Selbst-
bildnis (Abb. 9). Es zeigt den Künstler gegen-
über den Düsseldorfer Bildern herangewachsen
und herangereift. Die Formen sind bedeutend:
rein frontal, die Stirnpartie betont, in kräftig-
klarem Gegensatz zu ihrer Fläche die Linie der
Nase, die Schleife am Halskragen akzentuiert
nochmals das Lot der Mitte und rahmt mit dem
schwarzen Haar das Gesicht. Das Persönliche
bedeutend genommen und sicher wiedergegeben.
Jn die Pariser Zeit möchten wir auch höchst
eigenartige kleine Landschaftsbilder, von denen
die Abb. 8 eines, wenn auch nicht eben das
beste, zeigt, verlegen. Man denkt an die Kunst
des Rokoko, gelegentlich auch an das leuchtende
Rot von Diaz, dem Barbizoner Landschaster.
Jn den Briefen ist wenigstens davon die Rede,
daß Feuerbach im Frühjahr (1854) aufs Land
gehen will und Landschaftsstudien malen.
Es soll nun nicht weiter verfolgt werden,
wie stch Feuerbachs Aufenthalt in Paris äußerlich
gliedert, wie er wiederholt die Mutter besucht
und wieder zurückkehrt. Diese war nach. dem Tod
des Vaters mit der Tochter von Freiburg, das
ihnen nur mehr durch das Grab noch teuer war,
Abb. 23 (Text S. 35) Phot. F. BruÄmann
Kinderstudie zur Madonna
— aufrichtige Freunde hatten sie dort wcnige —
1852 nach Heidelberg, der geistig lebendigen Stadt
übergesiedelt, in der Erwartung, dort mehr ihrer
literarisch-musikalischen Begabung nach sich be-
tätigen zu können: ihren eigenen und der Familie
Bedürfnissen zum besten. Bei einem der Besuche
in Heidelberg malte Feuerbach das Porträt des
Kirchenrates Umbreit (Abb. 10): in Aufsassung
und in der freien und breiten Malweise ein
vorzügliches Stück der Porträtkunst des Künstlers.
Honoriert wurde es schlecht mit 50 fl. Noch mehr
oder noch weniger: es gefiel nicht, weil die
Wäsche nicht tadellos sauber ist. So stand es
damals mit dem Kunstsinn der guten Gesellschaft.
Die glatten Hofmaler gefielen. Wer will, mag
daran denken, wie es Rembrandt seinerzeit er-
gangen hat.
Wenn aber noch erzählt wird, wie der Sohn und
des Künstlers, wenn sie auch Worte und noch
nicht die Tat sind, haben soviel inneren Persön-
lichkeitswert, daß auch sie bei der Abmessung von
Abhängigkeit und Selbständigkeit von Bedeutung
sind. Wir sehen darin die im Bekenntnis
sich äußernde Eigenkraft. Noch eine Bemerkung
ist an die beiden Bilder zu knüpfen. Schon der
getreue-Iiebevolle Biograph Allgeyer hat sie ge-
macht. Es ist leicht, sie auch aus den Briefen
zu gewinnen. Feuerbach liebte es, an Bildern
von entgegengesetzter Art zur selben Zeit zu
arbeiten. Er erhielt sich dadurch im Arbeiten
frisch. Paris bot aber dem Künstler noch mehr:
er fand dort, was er nicht in Düsseldorf gefunden,
auch nicht in München und nicht in Antwerpen:
den Meister. Nach längerem Schwanken und
Zögern ging er, durch die Leistungen seiner
Bekannten bestimmt, wie er selbst sagt, zu Couture.
Er malte angestrengt fleißig Akte und Köpfe als
Studien (1852/53). Anfangs fühlte er sich ent-
täuscht. Aber nur im Anfang. Jm „Vermächtnis"
ist des Lehrers mit den Worten gedacht: „Nicht
genug danken kann ich dem Meister, welcher mich
von der deutschen Spitzpinselei zu breiter pastoser
Behandlung, von der akademischen Schablonen-
komposition zu großer Anschauung und Auffassung
führte. Couture selbst nannte es: „is, Ai-uiiäk
psiiitm-k". Jn den Briefen rühmt Feuerbach
noch die Weichheit und Feinheit der Farbe. Er
erzählt auch, Couture verlangte, daß sie im Louvre
nach Raffael zeichneten. Wer den Aufstieg der
„Generation von 1830" zu der „Generation
von 1850" kennt, steht sich nach den anderen
großen, ja größeren Namen um. Feuerbach be-
zeichnet in den Briefen Couture als den Führer
der neuen Richtung. Aber schon hier nennt er
Courbet als den ersten Maler. Und an ihn denkt
man, wenn man an einer andern Stelle, an der
Belgien an Paris gemessen wird, liest: „in Paris
.wird auf den größten Naturalismus hin-
gewiesen und wirklich, die Franzosen haben es
erreicht, daß man sagen kann, das ist ja Natur".
Jm „Vermächtnis" kommen dazu noch die Namen
Troyon, Rouffeau, Delacroix, Decamps. Doch
auch diese Aufreihung kann dem Urteil von heute
nicht genügen. Es erübrigt sich aber den Künstler
hierin zu korrigieren. Seine Sache ist ja nicht
die wissenschaftliche Erkenntnis, sondern die
künstlerische Förderung und Besruchtung. Darum
betont Feuerbach: „Paris ist.das Funda-
ment meiner künstlerischen Bildung geworden."
Wir verstehen das nicht im Sinne einer end-
gültigen Form, sondern einer ersten Formung.
Aus dieser Pariser Zeit stammt auch ein Selbst-
bildnis (Abb. 9). Es zeigt den Künstler gegen-
über den Düsseldorfer Bildern herangewachsen
und herangereift. Die Formen sind bedeutend:
rein frontal, die Stirnpartie betont, in kräftig-
klarem Gegensatz zu ihrer Fläche die Linie der
Nase, die Schleife am Halskragen akzentuiert
nochmals das Lot der Mitte und rahmt mit dem
schwarzen Haar das Gesicht. Das Persönliche
bedeutend genommen und sicher wiedergegeben.
Jn die Pariser Zeit möchten wir auch höchst
eigenartige kleine Landschaftsbilder, von denen
die Abb. 8 eines, wenn auch nicht eben das
beste, zeigt, verlegen. Man denkt an die Kunst
des Rokoko, gelegentlich auch an das leuchtende
Rot von Diaz, dem Barbizoner Landschaster.
Jn den Briefen ist wenigstens davon die Rede,
daß Feuerbach im Frühjahr (1854) aufs Land
gehen will und Landschaftsstudien malen.
Es soll nun nicht weiter verfolgt werden,
wie stch Feuerbachs Aufenthalt in Paris äußerlich
gliedert, wie er wiederholt die Mutter besucht
und wieder zurückkehrt. Diese war nach. dem Tod
des Vaters mit der Tochter von Freiburg, das
ihnen nur mehr durch das Grab noch teuer war,
Abb. 23 (Text S. 35) Phot. F. BruÄmann
Kinderstudie zur Madonna
— aufrichtige Freunde hatten sie dort wcnige —
1852 nach Heidelberg, der geistig lebendigen Stadt
übergesiedelt, in der Erwartung, dort mehr ihrer
literarisch-musikalischen Begabung nach sich be-
tätigen zu können: ihren eigenen und der Familie
Bedürfnissen zum besten. Bei einem der Besuche
in Heidelberg malte Feuerbach das Porträt des
Kirchenrates Umbreit (Abb. 10): in Aufsassung
und in der freien und breiten Malweise ein
vorzügliches Stück der Porträtkunst des Künstlers.
Honoriert wurde es schlecht mit 50 fl. Noch mehr
oder noch weniger: es gefiel nicht, weil die
Wäsche nicht tadellos sauber ist. So stand es
damals mit dem Kunstsinn der guten Gesellschaft.
Die glatten Hofmaler gefielen. Wer will, mag
daran denken, wie es Rembrandt seinerzeit er-
gangen hat.
Wenn aber noch erzählt wird, wie der Sohn und