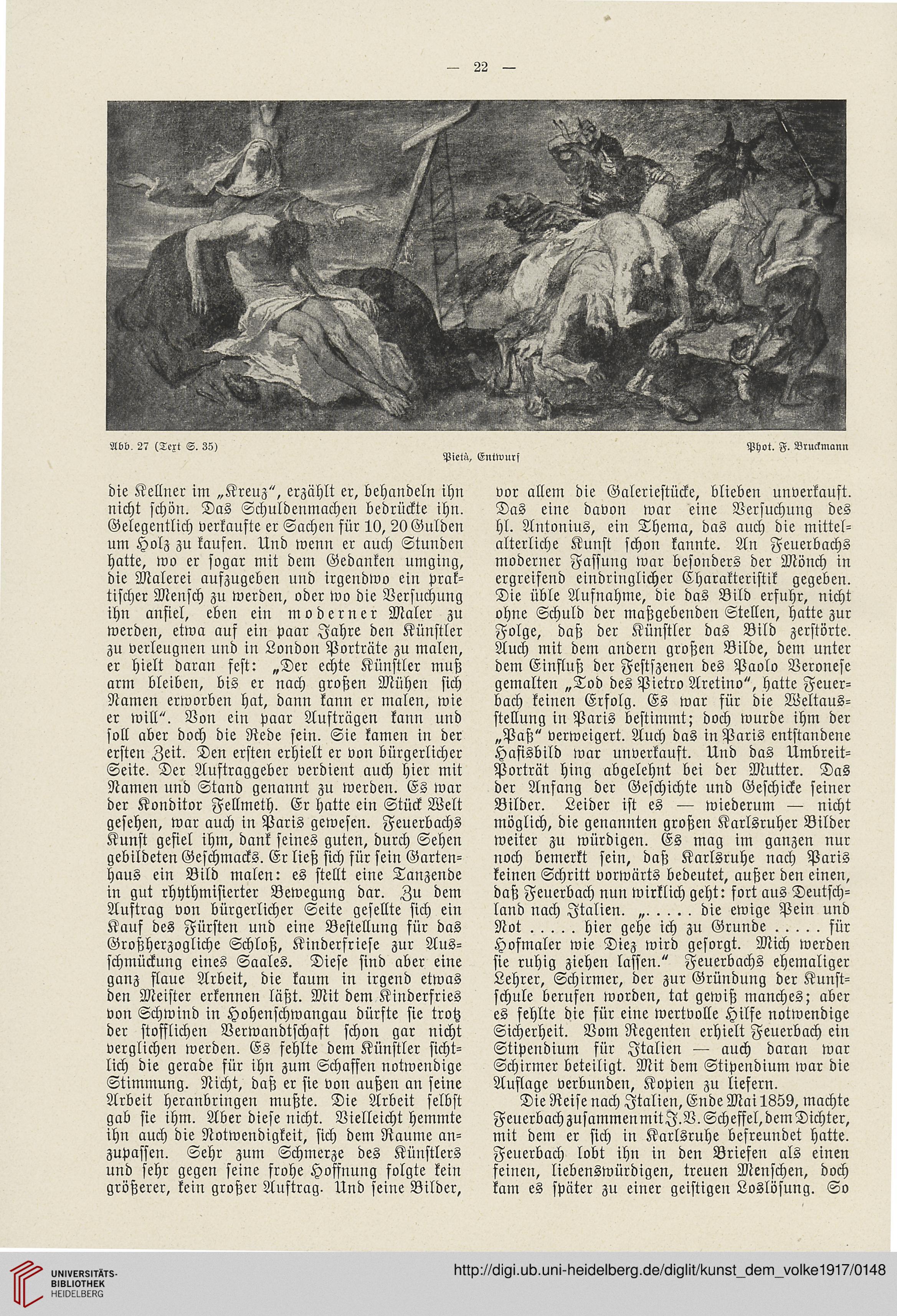22
Abb. 27 (Text S. 3S>
PietL, Entwurf
Phot. F. Bruclmann
die Kellner im „Kreuz", erzählt er, behandeln ihn
nicht schön. Das Schuldenmachen bedrückte ihn.
Gelegentlich verkaufte er Sachen für 10, 20Gulden
um Holz zu kaufen. Und wenn er auch Stunden
hatte, wo er sogar mit dem Gedanken umging,
die Malerei aufzugeben und irgendwo ein prak-
tischer Mensch zu werden, oder wo die Versuchung
ihn anfiel, eben ein moderner Maler zu
werden, etwa auf ein paar Jahre den Künstler
zu verleugnen und in London Porträte zu malen,
er hielt daran fest: „Der echte Künftler muß
arm bleiben, bis er nach großen Mühen stch
Namen erworben hat, dann kann er malen, wie
er will". Von ein paar Aufträgen kann und
soll aber doch die Rede sein. Sie kamen in der
ersten Zeit. Den ersten erhielt er von bürgerlicher
Seite. Der Auftraggeber verdient auch hier mit
Namen und Stand genannt zu werden. Es war
der Konditor Fellmeth. Er hatte ein Stück Welt
gesehen, war auch in Paris gewesen. Feuerbachs
Kunst gestel ihm, dank seines guten, durch Sehen
gebildeten Geschmacks. Er ließ fich für sein Garten-
haus ein Bild malen: es stellt eine Tanzende
in gut rhythmisierter Bewegung dar. Zu dem
Auftrag von bürgerlicher Seite gesellte fich ein
Kauf des Fürsten und eine Bestellung für das
Großherzogliche Schloß, Kinderfriese zur Aus-
schmückung eines Saales. Diese find aber eine
ganz flaue Arbeit, die kaum in irgend etwas
den Meister erkennen läßt. Mit dem Kinderfries
von Schwind in Hohenschwangau dürfte sie trotz
der ftofflichen Verwandtschaft schon gar nicht
verglichen werden. Es fehlte dem Künstler ficht-
lich die gerade für ihn zum Schaffen notwendige
Stimmung. Nicht, daß er sie von außen an seine
Arbeit heranbringen mußte. Die Arbeit selbst
gab fie ihm. Aber diese nicht. Vielleicht hemmte
ihn auch die Notwendigkeit, fich dem Raume an-
zupassen. Sehr zum Schmerze des Künstlers
und sehr gegen seine frohe Hoffnung folgte kein
größerer, kein großer Auftrag. Und seine Bilder,
vor allem die Galeriestücke, blieben unverkauft.
Das eine davon war eine Versuchung des
hl. Antonius, ein Thema, das auch die mittel-
alterliche Kunst schon kannte. An Feuerbachs
moderner Fassung war besonders der Mönch in
ergreisend eindringlicher Charakteristik gegeben.
Die üble Aufnahme, die das Bild erfuhr, nicht
ohne Schuld der maßgebenden Stellen, hatte zur
Folge, daß der Künstler das Bild zerstörte.
Auch mit dem andern großen Bilde, dem unter
dem Einfluß der Festszenen des Paolo Veronese
gemalten „Tod des Pietro Aretino", hatte Feuer-
bach keinen Erfolg. Es war für die Weltaus-
stellung in Paris bestimmt; doch wurde ihm der
„Paß" verweigert. Auch das in Paris entstandene
Hafisbild war unverkauft. Und das Umbreit-
Porträt hing abgelehnt bei der Mutter. Das
der Anfang der Geschichte und Geschicke seiner
Bilder. Leider ist es — wiederum — nicht
möglich, die genannten großen Karlsruher Bilder
weiter zu würdigen. Es mag im ganzen nur
noch bemerkt sein, daß Karlsruhe nach Paris
keinen Schritt vorwärts bedeutet, außer den einen,
daß Feuerbach nun wirklich geht: fort aus Deutsch-
land nach Jtalien. „.die ewige Pein und
Not.hier gehe ich zu Grunde.für
Hofmaler wie Diez wird gesorgt. Mich werden
sie ruhig ziehen lassen." Feuerbachs ehemaliger
Lehrer, Schirmer, der zur Gründung der Kunst-
schule berufen worden, tat gewiß manches; aber
es fehlte die für eine wertvolle Hilfe notwendige
Sicherheit. Vom Regenten erhielt Feuerbach ein
Stipendium für Jtalien — auch daran war
Schirmer beteiligt. Mit dem Stipendium war die
Auflage verbunden, Kopien zu liefern.
Die Reise nach Jtalien, Ende Mai 1859, machte
Feuerbach zusammenmitJ.V.Scheffel,demDichter,
mit dem er sich in Karlsruhe befreundet hatte.
Feuerbach lobt ihn in den Briefen als einen
feinen, liebenswürdigen, treuen Menschen, doch
kam es später zu einer geistigen Loslösung. So
Abb. 27 (Text S. 3S>
PietL, Entwurf
Phot. F. Bruclmann
die Kellner im „Kreuz", erzählt er, behandeln ihn
nicht schön. Das Schuldenmachen bedrückte ihn.
Gelegentlich verkaufte er Sachen für 10, 20Gulden
um Holz zu kaufen. Und wenn er auch Stunden
hatte, wo er sogar mit dem Gedanken umging,
die Malerei aufzugeben und irgendwo ein prak-
tischer Mensch zu werden, oder wo die Versuchung
ihn anfiel, eben ein moderner Maler zu
werden, etwa auf ein paar Jahre den Künstler
zu verleugnen und in London Porträte zu malen,
er hielt daran fest: „Der echte Künftler muß
arm bleiben, bis er nach großen Mühen stch
Namen erworben hat, dann kann er malen, wie
er will". Von ein paar Aufträgen kann und
soll aber doch die Rede sein. Sie kamen in der
ersten Zeit. Den ersten erhielt er von bürgerlicher
Seite. Der Auftraggeber verdient auch hier mit
Namen und Stand genannt zu werden. Es war
der Konditor Fellmeth. Er hatte ein Stück Welt
gesehen, war auch in Paris gewesen. Feuerbachs
Kunst gestel ihm, dank seines guten, durch Sehen
gebildeten Geschmacks. Er ließ fich für sein Garten-
haus ein Bild malen: es stellt eine Tanzende
in gut rhythmisierter Bewegung dar. Zu dem
Auftrag von bürgerlicher Seite gesellte fich ein
Kauf des Fürsten und eine Bestellung für das
Großherzogliche Schloß, Kinderfriese zur Aus-
schmückung eines Saales. Diese find aber eine
ganz flaue Arbeit, die kaum in irgend etwas
den Meister erkennen läßt. Mit dem Kinderfries
von Schwind in Hohenschwangau dürfte sie trotz
der ftofflichen Verwandtschaft schon gar nicht
verglichen werden. Es fehlte dem Künstler ficht-
lich die gerade für ihn zum Schaffen notwendige
Stimmung. Nicht, daß er sie von außen an seine
Arbeit heranbringen mußte. Die Arbeit selbst
gab fie ihm. Aber diese nicht. Vielleicht hemmte
ihn auch die Notwendigkeit, fich dem Raume an-
zupassen. Sehr zum Schmerze des Künstlers
und sehr gegen seine frohe Hoffnung folgte kein
größerer, kein großer Auftrag. Und seine Bilder,
vor allem die Galeriestücke, blieben unverkauft.
Das eine davon war eine Versuchung des
hl. Antonius, ein Thema, das auch die mittel-
alterliche Kunst schon kannte. An Feuerbachs
moderner Fassung war besonders der Mönch in
ergreisend eindringlicher Charakteristik gegeben.
Die üble Aufnahme, die das Bild erfuhr, nicht
ohne Schuld der maßgebenden Stellen, hatte zur
Folge, daß der Künstler das Bild zerstörte.
Auch mit dem andern großen Bilde, dem unter
dem Einfluß der Festszenen des Paolo Veronese
gemalten „Tod des Pietro Aretino", hatte Feuer-
bach keinen Erfolg. Es war für die Weltaus-
stellung in Paris bestimmt; doch wurde ihm der
„Paß" verweigert. Auch das in Paris entstandene
Hafisbild war unverkauft. Und das Umbreit-
Porträt hing abgelehnt bei der Mutter. Das
der Anfang der Geschichte und Geschicke seiner
Bilder. Leider ist es — wiederum — nicht
möglich, die genannten großen Karlsruher Bilder
weiter zu würdigen. Es mag im ganzen nur
noch bemerkt sein, daß Karlsruhe nach Paris
keinen Schritt vorwärts bedeutet, außer den einen,
daß Feuerbach nun wirklich geht: fort aus Deutsch-
land nach Jtalien. „.die ewige Pein und
Not.hier gehe ich zu Grunde.für
Hofmaler wie Diez wird gesorgt. Mich werden
sie ruhig ziehen lassen." Feuerbachs ehemaliger
Lehrer, Schirmer, der zur Gründung der Kunst-
schule berufen worden, tat gewiß manches; aber
es fehlte die für eine wertvolle Hilfe notwendige
Sicherheit. Vom Regenten erhielt Feuerbach ein
Stipendium für Jtalien — auch daran war
Schirmer beteiligt. Mit dem Stipendium war die
Auflage verbunden, Kopien zu liefern.
Die Reise nach Jtalien, Ende Mai 1859, machte
Feuerbach zusammenmitJ.V.Scheffel,demDichter,
mit dem er sich in Karlsruhe befreundet hatte.
Feuerbach lobt ihn in den Briefen als einen
feinen, liebenswürdigen, treuen Menschen, doch
kam es später zu einer geistigen Loslösung. So