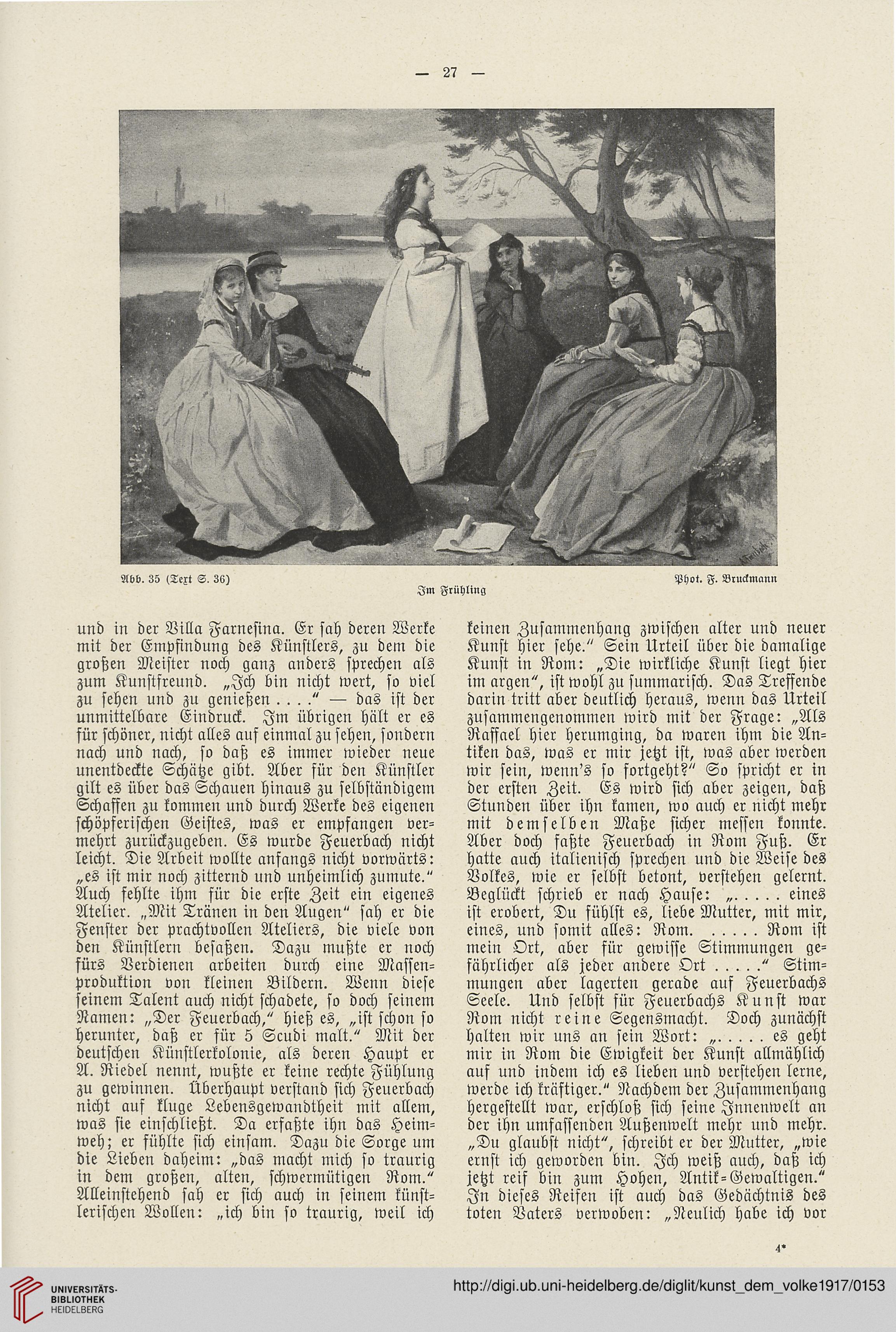27
Abb. 35 (Text S. 36) Phot. F. Bruckmami
Jm Frühling
und in der Villa Farnesina. Er sah deren Werke
mit der Empfindung des Künstlers, zu dem die
großen Meister noch ganz anders sprechen als
zum Kunstfreund. „Jch bin nicht wert, so viel
zu sehen und zu genießen . . . ." — das ist der
unmittelbare Eindruck. Jm übrigen hält er es
für schöner, nicht alles auf einmal zu sehen, sondern
nach und nach, so daß es immer wieder neue
unentdeckte Schätze gibt. Aber für den Künstler
gilt es über das Schauen hinaus zu selbständigem
Schaffen zu kommen und durch Werke des eigenen
schöpferischen Geistes, was er empsangen ver-
mehrt zurückzugeben. Es wurde Feuerbach nicht
leicht. Die Arbeit wollte anfangs nicht vorwärts:
„es ist mir noch zitternd und unheimlich zumute."
Auch fehlte ihm für die erste Zeit ein eigenes
Atelier. „Mit Tränen in den Augen" sah er die
Fenster der prachtvollen Ateliers, die viele von
den Künstlern besaßen. Dazu mußte er noch
fürs Verdienen arbeiten durch eine Massen-
produktion von kleinen Bildern. Wenn diese
seinem Talent auch nicht schadete, so doch seinem
Namen: „Der Feuerbach," hieß es, „ist schon so
herunter, daß er für 5 Scudi malt." Mit der
deutschen Künstlerkolonie, als deren Haupt er
A. Riedel nennt, wußte er keine rechte Fühlung
zu gewinnen. Qberhaupt verstand stch Feuerbach
nicht auf kluge Lebensgewandtheit mit allem,
was sie einschließt. Da erfaßte ihn das Heim-
weh; er fühlte sich einsam. Dazu die Sorge um
die Lieben daheim: „das macht mich so traurig
in dem großen, alten, schwermütigen Rom."
Alleinstehend sah er sich auch in seinem künst-
lerischen Wollen: „ich bin so traurig, weil ich
keinen Zusammenhang zwischen alter und neuer
Kunst hier sehe." Sein Urteil über die damalige
Kunst in Rom: „Die wirkliche Kunst liegt hier
im argen", ist wohl zu summarisch. Das Treffende
darin tritt aber deutlich heraus, wenn das Urteil
zusammengenommen wird mit der Frage: „Als
Raffael hier herumging, da waren ihm die An-
tiken das, was er mir jetzt ist, was aber werden
wir sein, wenn's so fortgeht?" So spricht er in
der ersten Zeit. Es wird sich aber zeigen, daß
Stunden über ihn kamen, wo auch er nicht mehr
mit demselben Maße sicher messen konnte.
Aber doch faßte Feuerbach in Rom Fuß. Er
hatte auch italienisch sprechen und die Weise des
Volkes, wie er selbst betont, verstehen gelernt.
Beglückt schrieb er nach Hause: „.eines
ist erobert, Du fühlst es, liebe Mutter, mit mir,
eines, und somit alles: Rom.Rom ist
mein Ort, aber für gewisse Stimmungen ge-
fährlicher als jeder andere Ort." Stim-
mungen aber lagerten gerade auf Feuerbachs
Seele. Und selbst für Feuerbachs Kunst war
Rom nicht reine Segensmacht. Doch zunächst
halten wir uns an sein Wort: „.es geht
mir in Rom die Ewigkeit der Kunst allmählich
auf und indem ich es lieben und vecstehen lerne,
werde ich kräftiger." Nachdem der Zusammenhang
hergestellt war, erschloß stch seine Jnnenwelt an
der ihn umsassenden Außenwelt mehr und mehr.
„Du glaubst nicht", schreibt er der Mutter, „wie
ernst ich geworden bin. Jch weiß auch, daß ich
jetzt reif bin zum Hohen, Antik-Gewaltigen."
Jn dieses Reisen ist auch das Gedächtnis des
toten Vaters verwoben: „Neulich habe ich vor
4'
Abb. 35 (Text S. 36) Phot. F. Bruckmami
Jm Frühling
und in der Villa Farnesina. Er sah deren Werke
mit der Empfindung des Künstlers, zu dem die
großen Meister noch ganz anders sprechen als
zum Kunstfreund. „Jch bin nicht wert, so viel
zu sehen und zu genießen . . . ." — das ist der
unmittelbare Eindruck. Jm übrigen hält er es
für schöner, nicht alles auf einmal zu sehen, sondern
nach und nach, so daß es immer wieder neue
unentdeckte Schätze gibt. Aber für den Künstler
gilt es über das Schauen hinaus zu selbständigem
Schaffen zu kommen und durch Werke des eigenen
schöpferischen Geistes, was er empsangen ver-
mehrt zurückzugeben. Es wurde Feuerbach nicht
leicht. Die Arbeit wollte anfangs nicht vorwärts:
„es ist mir noch zitternd und unheimlich zumute."
Auch fehlte ihm für die erste Zeit ein eigenes
Atelier. „Mit Tränen in den Augen" sah er die
Fenster der prachtvollen Ateliers, die viele von
den Künstlern besaßen. Dazu mußte er noch
fürs Verdienen arbeiten durch eine Massen-
produktion von kleinen Bildern. Wenn diese
seinem Talent auch nicht schadete, so doch seinem
Namen: „Der Feuerbach," hieß es, „ist schon so
herunter, daß er für 5 Scudi malt." Mit der
deutschen Künstlerkolonie, als deren Haupt er
A. Riedel nennt, wußte er keine rechte Fühlung
zu gewinnen. Qberhaupt verstand stch Feuerbach
nicht auf kluge Lebensgewandtheit mit allem,
was sie einschließt. Da erfaßte ihn das Heim-
weh; er fühlte sich einsam. Dazu die Sorge um
die Lieben daheim: „das macht mich so traurig
in dem großen, alten, schwermütigen Rom."
Alleinstehend sah er sich auch in seinem künst-
lerischen Wollen: „ich bin so traurig, weil ich
keinen Zusammenhang zwischen alter und neuer
Kunst hier sehe." Sein Urteil über die damalige
Kunst in Rom: „Die wirkliche Kunst liegt hier
im argen", ist wohl zu summarisch. Das Treffende
darin tritt aber deutlich heraus, wenn das Urteil
zusammengenommen wird mit der Frage: „Als
Raffael hier herumging, da waren ihm die An-
tiken das, was er mir jetzt ist, was aber werden
wir sein, wenn's so fortgeht?" So spricht er in
der ersten Zeit. Es wird sich aber zeigen, daß
Stunden über ihn kamen, wo auch er nicht mehr
mit demselben Maße sicher messen konnte.
Aber doch faßte Feuerbach in Rom Fuß. Er
hatte auch italienisch sprechen und die Weise des
Volkes, wie er selbst betont, verstehen gelernt.
Beglückt schrieb er nach Hause: „.eines
ist erobert, Du fühlst es, liebe Mutter, mit mir,
eines, und somit alles: Rom.Rom ist
mein Ort, aber für gewisse Stimmungen ge-
fährlicher als jeder andere Ort." Stim-
mungen aber lagerten gerade auf Feuerbachs
Seele. Und selbst für Feuerbachs Kunst war
Rom nicht reine Segensmacht. Doch zunächst
halten wir uns an sein Wort: „.es geht
mir in Rom die Ewigkeit der Kunst allmählich
auf und indem ich es lieben und vecstehen lerne,
werde ich kräftiger." Nachdem der Zusammenhang
hergestellt war, erschloß stch seine Jnnenwelt an
der ihn umsassenden Außenwelt mehr und mehr.
„Du glaubst nicht", schreibt er der Mutter, „wie
ernst ich geworden bin. Jch weiß auch, daß ich
jetzt reif bin zum Hohen, Antik-Gewaltigen."
Jn dieses Reisen ist auch das Gedächtnis des
toten Vaters verwoben: „Neulich habe ich vor
4'