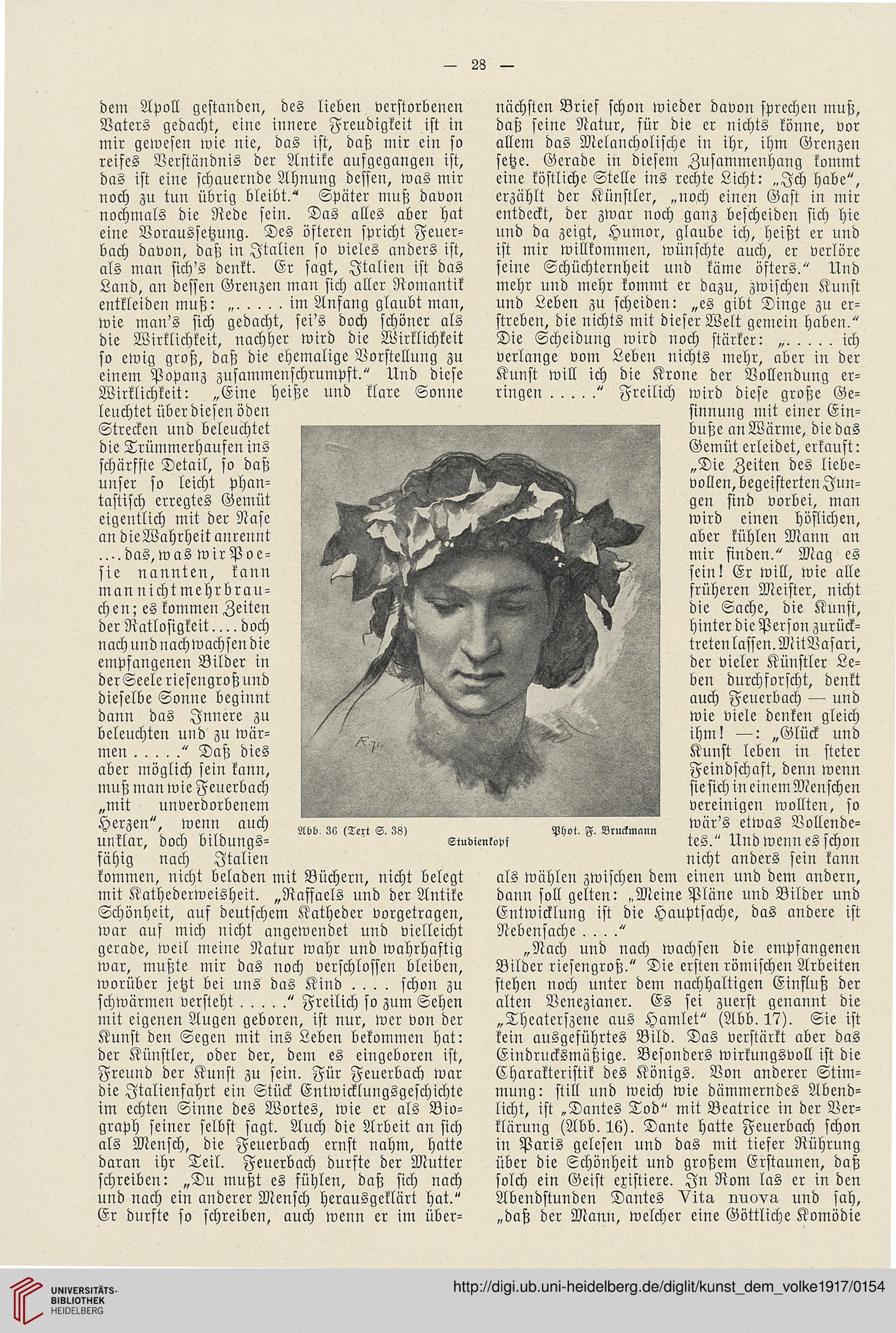23
dem Apoll gestanden, des lieben verstorbenen
Vaters gedacht, eine innere Freudigkeit ist in
mir gewesen wie nie, das ist, daß mir ein so
reifes Verständnis der Antike aufgegangen ist,
das ist eine schauernde Ahnung dessen, was mir
noch zu tun übrig bleibt." Später muß davon
nochmals die Rede sein. Das alles aber hat
eine Voraussetzung. Des öfteren spricht Feuer-
bach davon, daß in Jtalien so vieles anders ist,
als man sich's denkt. Er sagt, Jtalien ist das
Land, an dessen Grenzen man sich aller Romantik
entkleiden muß: „.im Anfang glaubt man,
wie man's sich gedacht, sei's doch schöner als
die Wirklichkeit, nachher wird die Wirklichkeit
so ewig groß, daß die ehemalige Vorstellung zu
einem Popanz zusammenschrumpft." Und diese
Wirklichkeit: „Eine heiße und klare Sonne
leuchtet überdiesenöden
Strecken und beleuchtet
die Trümmerhaufen ins
schärfste Detail, so daß
unser so leicht phan-
tastisch erregtes Gemüt
eigentlich mit der Nase
an dieWahrheit anrennt
....das,was wirPoe-
sie nannten, kann
mannichtmehrbrau-
chen; es kommen Zeiten
der Ratlosigkeit.... doch
nachundnachwachsendie
empfangenen Bilder in
der Seele riesengroß und
dieselbe Sonne beginnt
dann das Jnnere zu
beleuchten und zu wär-
men." Daß dies
aber möglich sein kann,
muß man wie Feuerbach
„mit unverdorbenem
Herzen", wenn auch
unklar, doch bildungs-
fähig nach Jtalien
kommen, nicht beladen mit Büchern, nicht belegt
mit Kathederweisheit. „Raffaels und der Antike
Schönheit, auf deutschem Katheder vorgetragen,
war auf mich nicht angewendet und vielleicht
gerade, weil meine Natur wahr und wahrhastig
war, mußte mir das noch verschlossen bleiben,
worüber jetzt bei uns das Kind .... schon zu
schwärmen versteht." Freilich so zum Sehen
mit eigenen Augen geboren, ist nur, wer von der
Kunst den Segen mit ins Leben bekommen hat:
der Künstler, oder der, dem es eingeboren ist,
Freund der Kunst zu sein. Für Feuerbach war
die Jtalienfahrt ein Stück Entwicklungsgeschichte
im echten Sinne des Wortes, wie er als Bio-
graph seiner selbst sagt. Auch die Arbeit an sich
als Mensch, die Feuerbach ernst nahm, hatte
daran ihr Teil. Feuerbach durste der Mutter
schreiben: „Du mußt es fühlen, daß sich nach
und nach ein anderer Mensch herausgeklärt hat."
Er durfte so schreiben, auch wenn er im über-
nächsten Brief schon wieder davon sprechen muß,
daß seine Natur, für die er nichts könne, vor
allem das Melancholische in ihr, ihm Grenzen
setze. Gerade in diesem Zusammenhang kommt
eine köstliche Stelle ins rechte Licht: „Jch habe",
erzählt der Künstler, „noch einen Gast in mir
entdeckt, der zwar noch ganz bescheiden sich hie
und da zeigt, Humor, glaube ich, heißt er und
ist mir willkommen, wünschte auch, er verlöre
seine Schüchternheit und käme öfters." Und
mehr und mehr kommt er dazu, zwischen Kunst
und Leben zu scheiden: „es gibt Dinge zu er-
streben, die nichts mit dieser Welt gemein haben."
Die Scheidung wird noch stärker: „.ich
verlange vom Leben nichts mehr, aber in der
Kunst will ich die Krone der Vollendung er-
ringen." Freilich wird diese große Ge-
sinnung mit einer Ein-
buße anWärme, diedas
Gemüt erleidet, erkauft:
„Die Zeiten des liebe-
vollen, begeisterten Jun-
gen sind vorbei, man
wird einen höflichen,
aber kühlen Mann an
mir finden." Mag es
sein! Er will, wie alle
früheren Meister, nicht
die Sache, die Kunst,
hinterdiePerson zurück-
tretenlassen.MitVasari,
der vieler Künstler Le-
ben durchforscht, denkt
auch Feuerbach — und
wie viele denken gleich
ihm! —: „Glück und
Kunst leben in steter
Feindschaft, denn wenn
siesich in einem Menschen
vereinigen wollten, so
wär's etwas Vollende-
tes." Undwennesschon
nicht anders sein kann
als wählen zwischen dem einen und dem andern,
dann soll gelten: „Meine Pläne und Bilder und
Entwicklung ist die Hauptsache, das andere ist
Nebensache. . . ."
„Nach und nach wachsen die empfangenen
Bilder riesengroß." Die ersten römischen Arbeiten
stehen noch unter dem nachhaltigen Einfluß der
alten Venezianer. Es sei zuerst genannt die
„Theaterszene aus Hamlet" (Abb. 17). Sie ist
kein ausgeführtes Bild. Das verstärkt aber das
Eindrucksmäßige. Besonders wirkungsvoll ist die
Charakteristik des Königs. Von anderer Stim-
mung: still und weich wie dämmerndes Abend-
licht, ist „Dantes Tod" mit Beatrice in der Ver-
klärung (Abb. 16). Dante hatte Feuerbach schon
in Paris gelesen und das mit tiefer Rührung
über die Schönheit und großem Erstaunen, daß
solch ein Geist existiere. Jn Rom las er in den
Abendstunden Dantes Vltn nnovn und sah,
„daß der Mann, welcher eine Göttliche Komödie
Abb, 38 <Tert S. 38) Phot. F. Bruclmann
Studienkops
dem Apoll gestanden, des lieben verstorbenen
Vaters gedacht, eine innere Freudigkeit ist in
mir gewesen wie nie, das ist, daß mir ein so
reifes Verständnis der Antike aufgegangen ist,
das ist eine schauernde Ahnung dessen, was mir
noch zu tun übrig bleibt." Später muß davon
nochmals die Rede sein. Das alles aber hat
eine Voraussetzung. Des öfteren spricht Feuer-
bach davon, daß in Jtalien so vieles anders ist,
als man sich's denkt. Er sagt, Jtalien ist das
Land, an dessen Grenzen man sich aller Romantik
entkleiden muß: „.im Anfang glaubt man,
wie man's sich gedacht, sei's doch schöner als
die Wirklichkeit, nachher wird die Wirklichkeit
so ewig groß, daß die ehemalige Vorstellung zu
einem Popanz zusammenschrumpft." Und diese
Wirklichkeit: „Eine heiße und klare Sonne
leuchtet überdiesenöden
Strecken und beleuchtet
die Trümmerhaufen ins
schärfste Detail, so daß
unser so leicht phan-
tastisch erregtes Gemüt
eigentlich mit der Nase
an dieWahrheit anrennt
....das,was wirPoe-
sie nannten, kann
mannichtmehrbrau-
chen; es kommen Zeiten
der Ratlosigkeit.... doch
nachundnachwachsendie
empfangenen Bilder in
der Seele riesengroß und
dieselbe Sonne beginnt
dann das Jnnere zu
beleuchten und zu wär-
men." Daß dies
aber möglich sein kann,
muß man wie Feuerbach
„mit unverdorbenem
Herzen", wenn auch
unklar, doch bildungs-
fähig nach Jtalien
kommen, nicht beladen mit Büchern, nicht belegt
mit Kathederweisheit. „Raffaels und der Antike
Schönheit, auf deutschem Katheder vorgetragen,
war auf mich nicht angewendet und vielleicht
gerade, weil meine Natur wahr und wahrhastig
war, mußte mir das noch verschlossen bleiben,
worüber jetzt bei uns das Kind .... schon zu
schwärmen versteht." Freilich so zum Sehen
mit eigenen Augen geboren, ist nur, wer von der
Kunst den Segen mit ins Leben bekommen hat:
der Künstler, oder der, dem es eingeboren ist,
Freund der Kunst zu sein. Für Feuerbach war
die Jtalienfahrt ein Stück Entwicklungsgeschichte
im echten Sinne des Wortes, wie er als Bio-
graph seiner selbst sagt. Auch die Arbeit an sich
als Mensch, die Feuerbach ernst nahm, hatte
daran ihr Teil. Feuerbach durste der Mutter
schreiben: „Du mußt es fühlen, daß sich nach
und nach ein anderer Mensch herausgeklärt hat."
Er durfte so schreiben, auch wenn er im über-
nächsten Brief schon wieder davon sprechen muß,
daß seine Natur, für die er nichts könne, vor
allem das Melancholische in ihr, ihm Grenzen
setze. Gerade in diesem Zusammenhang kommt
eine köstliche Stelle ins rechte Licht: „Jch habe",
erzählt der Künstler, „noch einen Gast in mir
entdeckt, der zwar noch ganz bescheiden sich hie
und da zeigt, Humor, glaube ich, heißt er und
ist mir willkommen, wünschte auch, er verlöre
seine Schüchternheit und käme öfters." Und
mehr und mehr kommt er dazu, zwischen Kunst
und Leben zu scheiden: „es gibt Dinge zu er-
streben, die nichts mit dieser Welt gemein haben."
Die Scheidung wird noch stärker: „.ich
verlange vom Leben nichts mehr, aber in der
Kunst will ich die Krone der Vollendung er-
ringen." Freilich wird diese große Ge-
sinnung mit einer Ein-
buße anWärme, diedas
Gemüt erleidet, erkauft:
„Die Zeiten des liebe-
vollen, begeisterten Jun-
gen sind vorbei, man
wird einen höflichen,
aber kühlen Mann an
mir finden." Mag es
sein! Er will, wie alle
früheren Meister, nicht
die Sache, die Kunst,
hinterdiePerson zurück-
tretenlassen.MitVasari,
der vieler Künstler Le-
ben durchforscht, denkt
auch Feuerbach — und
wie viele denken gleich
ihm! —: „Glück und
Kunst leben in steter
Feindschaft, denn wenn
siesich in einem Menschen
vereinigen wollten, so
wär's etwas Vollende-
tes." Undwennesschon
nicht anders sein kann
als wählen zwischen dem einen und dem andern,
dann soll gelten: „Meine Pläne und Bilder und
Entwicklung ist die Hauptsache, das andere ist
Nebensache. . . ."
„Nach und nach wachsen die empfangenen
Bilder riesengroß." Die ersten römischen Arbeiten
stehen noch unter dem nachhaltigen Einfluß der
alten Venezianer. Es sei zuerst genannt die
„Theaterszene aus Hamlet" (Abb. 17). Sie ist
kein ausgeführtes Bild. Das verstärkt aber das
Eindrucksmäßige. Besonders wirkungsvoll ist die
Charakteristik des Königs. Von anderer Stim-
mung: still und weich wie dämmerndes Abend-
licht, ist „Dantes Tod" mit Beatrice in der Ver-
klärung (Abb. 16). Dante hatte Feuerbach schon
in Paris gelesen und das mit tiefer Rührung
über die Schönheit und großem Erstaunen, daß
solch ein Geist existiere. Jn Rom las er in den
Abendstunden Dantes Vltn nnovn und sah,
„daß der Mann, welcher eine Göttliche Komödie
Abb, 38 <Tert S. 38) Phot. F. Bruclmann
Studienkops