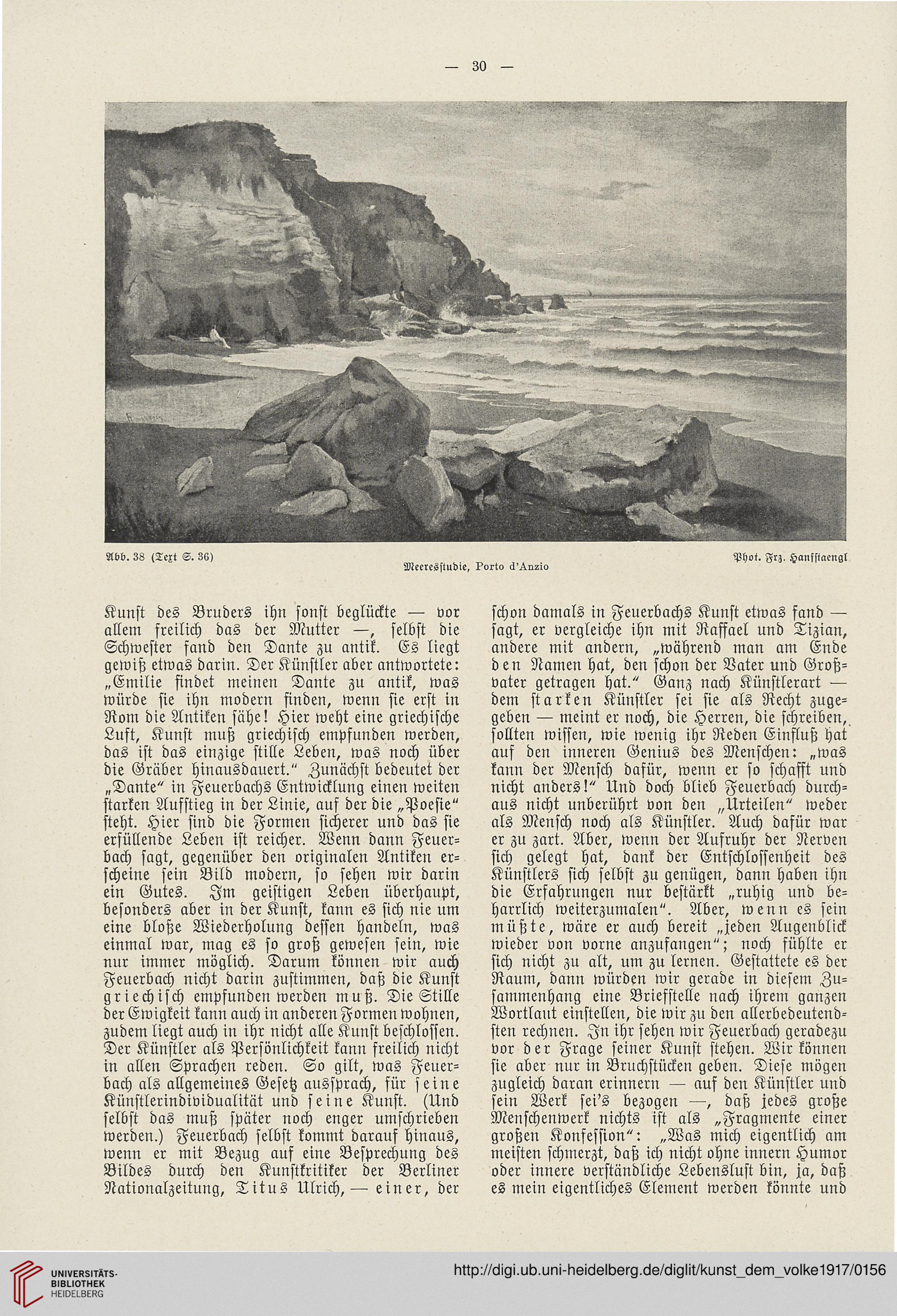30
Kunst des Bruders ihn sonst beglückte — vor
allem freilich das der Mutter —, selbst die
Schwester fand den Dante zu antik. Es liegt
gewiß etwas darin. Der Künstler aber antwortete:
„Emilie findet meinen Dante zu antik, was
würde sie ihn modern finden, wenn ste erst in
Rom die Antiken sähe! Hier weht eine griechische
Luft, Kunst muß griechisch empfunden werden,
das ist das einzige stille Leben, was noch über
die Gräber hinausdauert." Zunächst bedeutet der
„Dante" in Feuerbachs Entwicklung einen weiten
starken Aufstieg in der Linie, auf der die „Poesie"
steht. Hier sind die Formen sicherer und das sie
erfüllende Leben ist reicher. Wenn dann Feuer-
bach sagt, gegenüber den originalen Antiken er-
scheine sein Bild modern, so sehen wir darin
ein Gutes. Jm geistigen Leben überhaupt,
besonders aber in der Kunst, kann es sich nie um
eine bloße Wiederholung dessen handeln, was
einmal war, mag es so groß gewesen sein, wie
nur immer möglich. Darum können wir auch
Feuerbach nicht darin zustimmen, daß die Kunst
griechisch empfunden werden muß. Die Stille
der Ewigkeit kann auch in anderen Formen wohnen,
zudem liegt auch in ihr nicht alle Kunst beschlossen.
Der Künstler als Persönlichkeit kann freilich nicht
in allen Sprachen reden. So gilt, was Feuer-
bach als allgemeines Gesetz aussprach, für seine
Künstlerindividualität und seine Kunst. (Und
selbst das muß später noch enger umschrieben
werden.) Feuerbach selbst kommt darauf hinaus,
wenn er mit Bezug auf eine Besprechung des
Bildes durch den Kunstkritiker der Berliner
Nationalzeitung, Titus Ulrich,—- einer, der
schon damals in Feuerbachs Kunst etwas fand —
sagt, er vergleiche ihn mit Raffael und Tizian,
andere mit andern, „während man am Ende
d en Namen hat, den schon der Vater und Groß-
vater getragen hat." Ganz nach Künstlerart —
dem starken Künstler sei sie als Recht zuge-
geben — meint er noch, die Herren, die schreiben,
sollten wissen, wie wenig ihr Reden Einsluß hat
auf den inneren Genius des Menschen: „was
kann der Mensch dafür, wenn er so schafft und
nicht anders!" Und doch blieb Feuerbach durch-
aus nicht unberührt von den „Urteilen" weder
als Mensch noch als Künstler. Auch dafür war
er zu zart. Aber, wenn der Aufruhr der Nerven
stch gelegt hat, dank der Entschlossenheit des
Künstlers sich selbst zu genügen, dann haben ihn
die Erfahrungen nur bestärkt „ruhig und be-
harrlich weiterzumalen". Aber, wenn es sein
müßte, wäre er auch bereit „jeden Augenblick
wieder von vorne anzufangen"; noch fühlte er
sich nicht zu alt, um zu lernen. Gestattete es der
Raum, dann würden wir gerade in diesem Zu-
sammenhang eine Briefstelle nach ihrem ganzen
Wortlant einstellen, die wir zu den allerbedeutend-
sten rechnen. Jn ihr sehen wir Feuerbach geradezu
vor d er Frage seiner Kunst stehen. Wir können
ste aber nur in Bruchstücken geben. Diese mögen
zugleich daran erinnern — auf den Künstler und
sein Werk sei's bezogen —, daß jedes große
Menschenwerk nichts ist als „Fragmente einer
großen Konfession": „Was mich eigentlich am
meisten schmerzt, daß ich nicht ohne innern Humor
oder innere verständliche Lebenslust bin, ja, daß
es mein eigentliches Element werden könnte und
Kunst des Bruders ihn sonst beglückte — vor
allem freilich das der Mutter —, selbst die
Schwester fand den Dante zu antik. Es liegt
gewiß etwas darin. Der Künstler aber antwortete:
„Emilie findet meinen Dante zu antik, was
würde sie ihn modern finden, wenn ste erst in
Rom die Antiken sähe! Hier weht eine griechische
Luft, Kunst muß griechisch empfunden werden,
das ist das einzige stille Leben, was noch über
die Gräber hinausdauert." Zunächst bedeutet der
„Dante" in Feuerbachs Entwicklung einen weiten
starken Aufstieg in der Linie, auf der die „Poesie"
steht. Hier sind die Formen sicherer und das sie
erfüllende Leben ist reicher. Wenn dann Feuer-
bach sagt, gegenüber den originalen Antiken er-
scheine sein Bild modern, so sehen wir darin
ein Gutes. Jm geistigen Leben überhaupt,
besonders aber in der Kunst, kann es sich nie um
eine bloße Wiederholung dessen handeln, was
einmal war, mag es so groß gewesen sein, wie
nur immer möglich. Darum können wir auch
Feuerbach nicht darin zustimmen, daß die Kunst
griechisch empfunden werden muß. Die Stille
der Ewigkeit kann auch in anderen Formen wohnen,
zudem liegt auch in ihr nicht alle Kunst beschlossen.
Der Künstler als Persönlichkeit kann freilich nicht
in allen Sprachen reden. So gilt, was Feuer-
bach als allgemeines Gesetz aussprach, für seine
Künstlerindividualität und seine Kunst. (Und
selbst das muß später noch enger umschrieben
werden.) Feuerbach selbst kommt darauf hinaus,
wenn er mit Bezug auf eine Besprechung des
Bildes durch den Kunstkritiker der Berliner
Nationalzeitung, Titus Ulrich,—- einer, der
schon damals in Feuerbachs Kunst etwas fand —
sagt, er vergleiche ihn mit Raffael und Tizian,
andere mit andern, „während man am Ende
d en Namen hat, den schon der Vater und Groß-
vater getragen hat." Ganz nach Künstlerart —
dem starken Künstler sei sie als Recht zuge-
geben — meint er noch, die Herren, die schreiben,
sollten wissen, wie wenig ihr Reden Einsluß hat
auf den inneren Genius des Menschen: „was
kann der Mensch dafür, wenn er so schafft und
nicht anders!" Und doch blieb Feuerbach durch-
aus nicht unberührt von den „Urteilen" weder
als Mensch noch als Künstler. Auch dafür war
er zu zart. Aber, wenn der Aufruhr der Nerven
stch gelegt hat, dank der Entschlossenheit des
Künstlers sich selbst zu genügen, dann haben ihn
die Erfahrungen nur bestärkt „ruhig und be-
harrlich weiterzumalen". Aber, wenn es sein
müßte, wäre er auch bereit „jeden Augenblick
wieder von vorne anzufangen"; noch fühlte er
sich nicht zu alt, um zu lernen. Gestattete es der
Raum, dann würden wir gerade in diesem Zu-
sammenhang eine Briefstelle nach ihrem ganzen
Wortlant einstellen, die wir zu den allerbedeutend-
sten rechnen. Jn ihr sehen wir Feuerbach geradezu
vor d er Frage seiner Kunst stehen. Wir können
ste aber nur in Bruchstücken geben. Diese mögen
zugleich daran erinnern — auf den Künstler und
sein Werk sei's bezogen —, daß jedes große
Menschenwerk nichts ist als „Fragmente einer
großen Konfession": „Was mich eigentlich am
meisten schmerzt, daß ich nicht ohne innern Humor
oder innere verständliche Lebenslust bin, ja, daß
es mein eigentliches Element werden könnte und