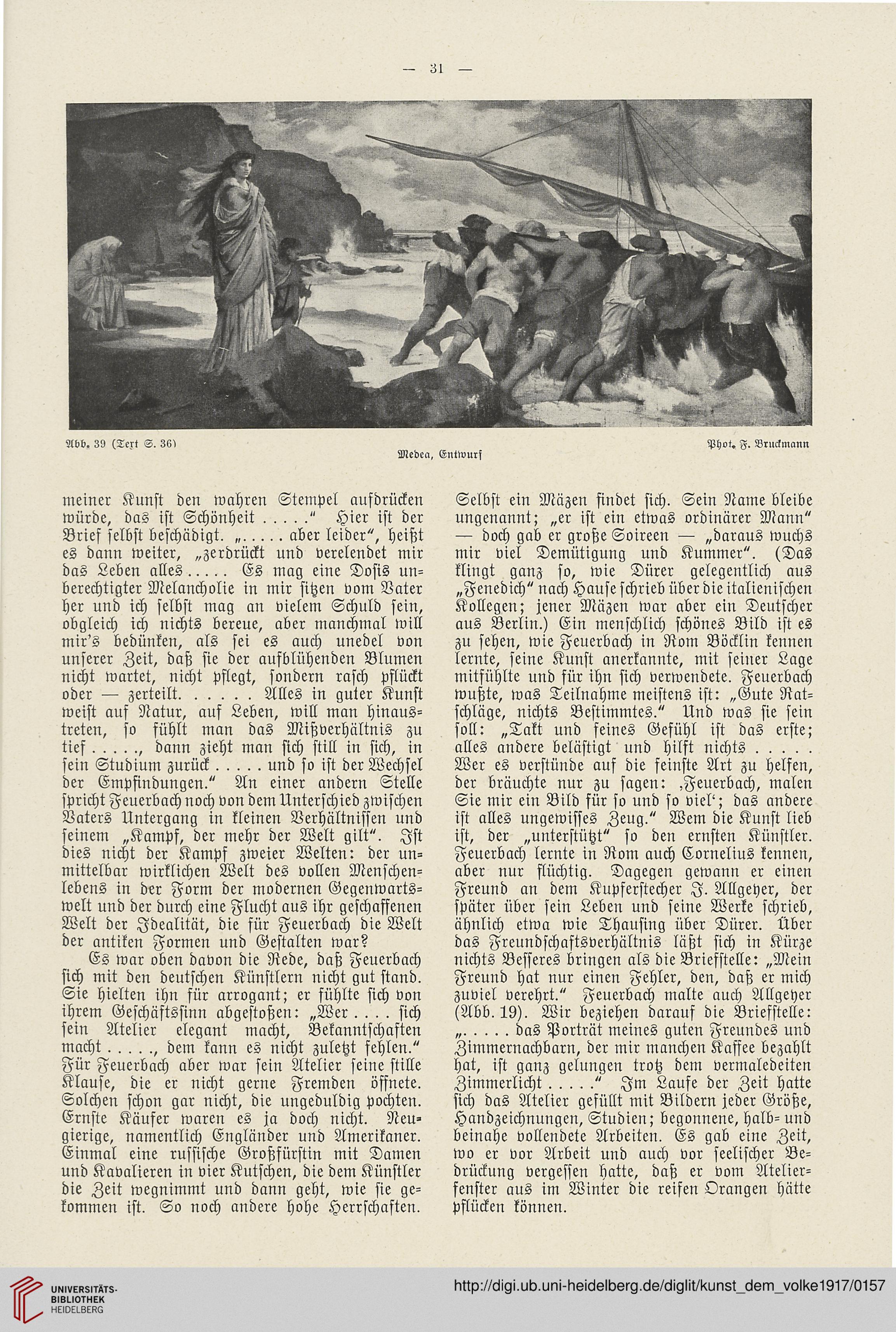31
Abb. SS (Tcrt S. Skt
Medea, Entwurs
Phot, F. Bruckmann
meiner Kunst den wahren Stempel aufdrücken
würde, das ist Schönheit." Hier ist der
Brief selbst beschädigt. „.aber leider", heißt
es dann weiter, „zerdrückt und verelendet mir
das Leben alles. Es mag eine Dosis un-
berechtigter Melancholie in mir sitzen vom Vater
her und ich selbst mag an vielem Schuld sein,
obgleich ich nichts bereue, aber manchmal will
mir's bedünken, als sei es auch unedel von
unserer Zeit, daß sie der aufblühenden Blumen
nicht wartet, nicht pflegt, sondern rasch pflückt
oder — zerteilt.Alles in guter Kunst
weist auf Natur, auf Leben, will man hinaus-
treten, so fühlt man das Mißverhältnis zu
tief., dann zieht man sich still in sich, in
sein Studium zurück.und so ist der Wechsel
der Empfindungen." An einer andern Stelle
spricht Feuerbach noch von dem Unterschied zwischen
Vaters Untergang in kleinen Verhältnissen und
seinem „Kampf, der mehr der Welt gilt". Jst
dies nicht der Kampf zweier Welten: der un-
mittelbar wirklichen Welt des vollen Menschen-
lebens in der Form der modernen Gegenwarts-
welt und der durch eine Flucht aus ihr geschaffenen
Welt der Jdealität, die für Feuerbach die Welt
der antiken Formen und Gestalten war?
Es war oben davon die Rede, daß Feuerbach
sich mit den deutschen Künstlern nicht gut stand.
Sie hielten ihn sür arrogant; er fühlte sich von
ihrem Geschästssinn abgestoßen: „Wer. . . . sich
sein Atelier elegant macht, Bekanntschaften
macht., dem kann es nicht zuletzt fehlen."
Für Feuerbach aber war sein Atelier seine stille
Klause, die er nicht gerne Fremden öffnete.
Solchen schon gar nicht, die ungeduldig pochten.
Ernste Käuser waren es ja doch nicht. Neu-
gierige, namentlich Engländer und Amerikaner.
Einmal eine russische Großfürstin mit Damen
und Kavalieren in vier Kutschen, die dem Künstler
die Zeit wegnimmt und dann geht, wie sie ge-
kommen ist. So noch andere hohe Herrschaften.
Selbst ein Mäzen findet sich. Sein Name bleibe
ungenannt; „er ist ein etwas ordinärer Mann"
— doch gab er große Soireen — „daraus wuchs
mir viel Demütigung und Kummer". (Das
klingt ganz so, wie Dürer gelegentlich aus
„Fenedich" nach Hauseschrieb überdie italienischen
Kollegen; jener Mäzen war aber ein Deutscher
aus Berlin.) Ein menschlich schönes Bild ist es
zu sehen, wie Feuerbach in Rom Böcklin kennen
lernte, seine Kunst anerkannte, mit seiuer Lage
mitfühlte und für ihn sich verwendete. Feuerbach
wußte, was Teilnahme meistens ist: „Gute Rat-
schläge, nichts Bestimmtes." Und was sie sein
soll: „Takt und feines Gefühl ist das erste;
alles andere belästigt und hilft nichts.
Wer es verstünde auf die feinste Art zu helfen,
der bräuchte nur zu sagen: ,Feuerbach, malen
Sie mir ein Bild für so und so viell; das andere
ist alles ungewisses Zeug." Wem die Kunst lieb
ist, der „unterstützt" so den ernsten Künstler.
Feuerbach lernte in Rom auch Cornelius kennen,
aber nur flüchtig. Dagegen gewann er einen
Freund an dem Kupferstecher I. Allgeyer, der
später über sein Leben und seine Werke schrieb,
ähnlich etwa wie Thausing über Dürer. Uber
das Freundschaftsverhältnis läßt sich in Kürze
nichts Besseres bringen als die Briefstelle: „Mein
Freund hat nur einen Fehler, den, daß er mich
zuviel verehrt." Feuerbach malte auch Allgeyer
(Abb. 19). Wir beziehen darauf die Briefstelle:
„.das Porträt meines guten Freundes und
Zimmernachbarn, der mir manchen Kaffee bezahlt
hat, ist ganz gelungen trotz dem vermaledeiten
Zimmerlicht." Jm Laufe der Zeit hatte
sich das Atelier gefüllt mit Bildern jeder Größe,
Handzeichnungen, Studien; begonnene, halb- und
beinahe vollendete Arbeiten. Es gab eine Zeit,
wo er vor Arbeit und auch vor seelischer Be-
drückung vergessen hatte, daß er vom Atelier-
fenster aus im Winter die reifen Orangen hätte
pflücken können.
Abb. SS (Tcrt S. Skt
Medea, Entwurs
Phot, F. Bruckmann
meiner Kunst den wahren Stempel aufdrücken
würde, das ist Schönheit." Hier ist der
Brief selbst beschädigt. „.aber leider", heißt
es dann weiter, „zerdrückt und verelendet mir
das Leben alles. Es mag eine Dosis un-
berechtigter Melancholie in mir sitzen vom Vater
her und ich selbst mag an vielem Schuld sein,
obgleich ich nichts bereue, aber manchmal will
mir's bedünken, als sei es auch unedel von
unserer Zeit, daß sie der aufblühenden Blumen
nicht wartet, nicht pflegt, sondern rasch pflückt
oder — zerteilt.Alles in guter Kunst
weist auf Natur, auf Leben, will man hinaus-
treten, so fühlt man das Mißverhältnis zu
tief., dann zieht man sich still in sich, in
sein Studium zurück.und so ist der Wechsel
der Empfindungen." An einer andern Stelle
spricht Feuerbach noch von dem Unterschied zwischen
Vaters Untergang in kleinen Verhältnissen und
seinem „Kampf, der mehr der Welt gilt". Jst
dies nicht der Kampf zweier Welten: der un-
mittelbar wirklichen Welt des vollen Menschen-
lebens in der Form der modernen Gegenwarts-
welt und der durch eine Flucht aus ihr geschaffenen
Welt der Jdealität, die für Feuerbach die Welt
der antiken Formen und Gestalten war?
Es war oben davon die Rede, daß Feuerbach
sich mit den deutschen Künstlern nicht gut stand.
Sie hielten ihn sür arrogant; er fühlte sich von
ihrem Geschästssinn abgestoßen: „Wer. . . . sich
sein Atelier elegant macht, Bekanntschaften
macht., dem kann es nicht zuletzt fehlen."
Für Feuerbach aber war sein Atelier seine stille
Klause, die er nicht gerne Fremden öffnete.
Solchen schon gar nicht, die ungeduldig pochten.
Ernste Käuser waren es ja doch nicht. Neu-
gierige, namentlich Engländer und Amerikaner.
Einmal eine russische Großfürstin mit Damen
und Kavalieren in vier Kutschen, die dem Künstler
die Zeit wegnimmt und dann geht, wie sie ge-
kommen ist. So noch andere hohe Herrschaften.
Selbst ein Mäzen findet sich. Sein Name bleibe
ungenannt; „er ist ein etwas ordinärer Mann"
— doch gab er große Soireen — „daraus wuchs
mir viel Demütigung und Kummer". (Das
klingt ganz so, wie Dürer gelegentlich aus
„Fenedich" nach Hauseschrieb überdie italienischen
Kollegen; jener Mäzen war aber ein Deutscher
aus Berlin.) Ein menschlich schönes Bild ist es
zu sehen, wie Feuerbach in Rom Böcklin kennen
lernte, seine Kunst anerkannte, mit seiuer Lage
mitfühlte und für ihn sich verwendete. Feuerbach
wußte, was Teilnahme meistens ist: „Gute Rat-
schläge, nichts Bestimmtes." Und was sie sein
soll: „Takt und feines Gefühl ist das erste;
alles andere belästigt und hilft nichts.
Wer es verstünde auf die feinste Art zu helfen,
der bräuchte nur zu sagen: ,Feuerbach, malen
Sie mir ein Bild für so und so viell; das andere
ist alles ungewisses Zeug." Wem die Kunst lieb
ist, der „unterstützt" so den ernsten Künstler.
Feuerbach lernte in Rom auch Cornelius kennen,
aber nur flüchtig. Dagegen gewann er einen
Freund an dem Kupferstecher I. Allgeyer, der
später über sein Leben und seine Werke schrieb,
ähnlich etwa wie Thausing über Dürer. Uber
das Freundschaftsverhältnis läßt sich in Kürze
nichts Besseres bringen als die Briefstelle: „Mein
Freund hat nur einen Fehler, den, daß er mich
zuviel verehrt." Feuerbach malte auch Allgeyer
(Abb. 19). Wir beziehen darauf die Briefstelle:
„.das Porträt meines guten Freundes und
Zimmernachbarn, der mir manchen Kaffee bezahlt
hat, ist ganz gelungen trotz dem vermaledeiten
Zimmerlicht." Jm Laufe der Zeit hatte
sich das Atelier gefüllt mit Bildern jeder Größe,
Handzeichnungen, Studien; begonnene, halb- und
beinahe vollendete Arbeiten. Es gab eine Zeit,
wo er vor Arbeit und auch vor seelischer Be-
drückung vergessen hatte, daß er vom Atelier-
fenster aus im Winter die reifen Orangen hätte
pflücken können.