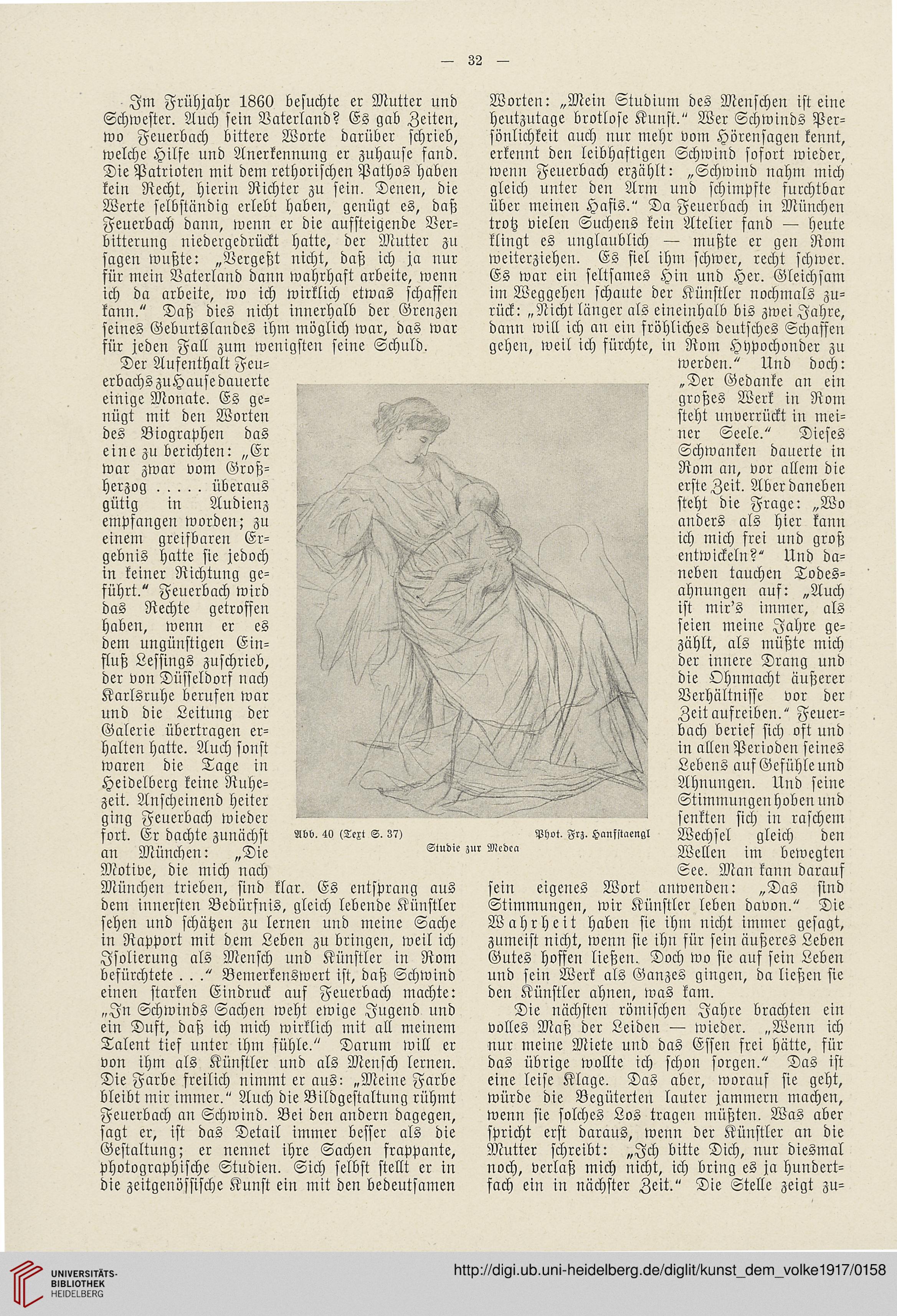32
Jm Frühjahr 1860 besuchte er Mutter und
Schwester. Auch sein Vaterland? Es gab Zeiten,
wo Feuerbach bittere Worte darüber schrieb,
welche Hilfe und Anerkennung er zuhause fand.
Die Patrioten mit dem rethorischen Pathos haben
kein Recht, hierin Richter zu sein. Denen, die
Werte selbständig erlebt haben, genügt es, daß
Feuerbach dann, wenn er die aufsteigende Ver-
bitterung niedergedrückt hatte, der Mutter zu
sagen wußte: „Vergeßt nicht, daß ich ja nur
für mein Vaterland dann wahrhaft arbeite, weun
ich da arbeite, wo ich wirklich etwas schaffen
kann." Daß dies nicht innerhalb der Grenzen
seines Geburtslandes ihm möglich war, das war
für jeden Fall zum wenigsten seine Schuld.
Der Aufenthalt Feu-
erbachs zuHaus e dauerte
einige Monate. Es ge-
uügt mit den Worten
des Biographen das
eine zu berichteu: „Er
war zwar vom Groß-
herzog.überaus
gütig in Audienz
empfangen worden; zu
einem greifbaren Er-
gebnis hatte sie jedoch
in keiner Richtung ge-
führt." Feuerbach wird
das Rechte getroffen
haben, wenn er es
dem ungünstigen Ein-
fluß Lesfings zuschrieb,
der von Düsseldorf nach
Karlsruhe berufen war
und die Leitung der
Galerie übertragen er-
halten hatte. Auch sonst
waren die Tage in
Heidelberg keine Ruhe-
zeit. Anscheinend heiter
ging Feuerbach wieder
fort. Er dachte zunächst
an München: „Die
Motive, die mich nach
München trieben, sind klar. Es entspraug aus
dem innersten Bedürfnis, gleich lebende Künstler
sehen und schätzen zu lernen und meine Sache
in Rapport mit dem Leben zu bringen, weil ich
Jsolierung als Mensch und Künstler in Rom
befürchtete . . ." Bemerkenswert ist, daß Schwind
einen starken Eindruck auf Feuerbach machte:
„Jn Schwinds Sachen weht ewige Jugend und
ein Duft, daß ich mich wirklich mit all meinem
Talent tief unter ihm fühle." Darum will er
von ihm als Künstler und als Mensch lernen.
Die Farbe freilich nimmt er aus: „Meine Farbe
bleibt mir immer." Auch die Bildgestaltung rühmt
Feuerbach an Schwind. Bei den andern dagegen,
sagt er, ist das Detail immer besser als die
Gestaltung; er nennet ihre Sachen frappante,
photographische Studien. Sich selbst stellt er in
die zeitgenössische Kunst ein mit den bedeutsamen
Worten: „Mein Studium des Menschen ist eine
heutzutage brotlose Kunst." Wer Schwinds Per-
sönlichkeit auch uur mehr vom Hörensagen kennt,
erkennt den leibhaftigen Schwind sofort wieder,
wenn Feuerbach erzählt: „Schwind nahm mich
gleich unter den Arm und schimpfte furchtbar
über meinen Hafis." Da Feuerbach in München
trotz vielen Suchens kein Atelier fand — heute
klingt es unglaublich — mußte er gen Rom
weiterziehen. Es fiel ihm schwer, recht schwer.
Es war ein seltsames Hm und Her. Gleichsam
im Weggehen schaute der Künstler nochmals zu-
rück: „Nicht länger als eineinhalb bis zwei Jahre,
dann will ich an ein fröhkiches deutsches Schaffen
gehen, weil ich fürchte, in Rom Hypochonder zu
werden." Und doch:
„Der Gedanke an eiu
großes Werk in Rom
steht unverrückt in mei-
ner Seele." Dieses
Schwanken dauerte in
Rom an, vor allem die
ersteZeit. Aberdaneben
steht die Frage: „Wo
anders als hier kann
ich mich frei und groß
entwickeln?" Und da-
neben tauchen Todes-
ahnungen aus: „Auch
ist mir's immer, als
seien meine Jahre ge-
zählt, als müßte mich
der innere Drang und
die Ohnmacht äußerer
Verhältnisse vor der
Zeitausreiben." Feuer-
bach berief sich oft und
in allen Perioden seines
Lebens aufGefühleund
Ahnungen. Und seine
Stimmungen hoben und
senkten sich in raschem
Wechsel gleich den
Wellen im bewegten
See. Man kann darauf
eigenes Wort anwenden: „Das sind
Stimmungen, wir Künstler leben davon." Die
Wahrheit haben sie ihm nicht immer gesagt,
zumeist nicht, wenn sie ihn für sein äußeres Leben
Gutes hoffen ließen. Doch wo sie auf sein Leben
und sein Werk als Ganzes gingen, da ließeu sie
den Künstler ahnen, was kam.
Die nächsten römischeu Jahre brachten ein
volles Maß der Leiden — wieder. „Wenn ich
nur meine Miete und das Essen frei hätte, für
das übrige wollte ich schon sorgen." Das ist
eine leise Klage. Das aber, worauf sie geht,
würde die Begüterten lauter jammern machen,
wenn sie solches Los tragen müßten. Was aber
spricht erst daraus, wenn der Künstler an die
Mutter schreibt: „Jch bitte Dich, nur diesmal
noch, verlaß mich nicht, ich bring es ja hundert-
fach ein in nächster Zeit." Die Stelle zeigt zu-
sein
Jm Frühjahr 1860 besuchte er Mutter und
Schwester. Auch sein Vaterland? Es gab Zeiten,
wo Feuerbach bittere Worte darüber schrieb,
welche Hilfe und Anerkennung er zuhause fand.
Die Patrioten mit dem rethorischen Pathos haben
kein Recht, hierin Richter zu sein. Denen, die
Werte selbständig erlebt haben, genügt es, daß
Feuerbach dann, wenn er die aufsteigende Ver-
bitterung niedergedrückt hatte, der Mutter zu
sagen wußte: „Vergeßt nicht, daß ich ja nur
für mein Vaterland dann wahrhaft arbeite, weun
ich da arbeite, wo ich wirklich etwas schaffen
kann." Daß dies nicht innerhalb der Grenzen
seines Geburtslandes ihm möglich war, das war
für jeden Fall zum wenigsten seine Schuld.
Der Aufenthalt Feu-
erbachs zuHaus e dauerte
einige Monate. Es ge-
uügt mit den Worten
des Biographen das
eine zu berichteu: „Er
war zwar vom Groß-
herzog.überaus
gütig in Audienz
empfangen worden; zu
einem greifbaren Er-
gebnis hatte sie jedoch
in keiner Richtung ge-
führt." Feuerbach wird
das Rechte getroffen
haben, wenn er es
dem ungünstigen Ein-
fluß Lesfings zuschrieb,
der von Düsseldorf nach
Karlsruhe berufen war
und die Leitung der
Galerie übertragen er-
halten hatte. Auch sonst
waren die Tage in
Heidelberg keine Ruhe-
zeit. Anscheinend heiter
ging Feuerbach wieder
fort. Er dachte zunächst
an München: „Die
Motive, die mich nach
München trieben, sind klar. Es entspraug aus
dem innersten Bedürfnis, gleich lebende Künstler
sehen und schätzen zu lernen und meine Sache
in Rapport mit dem Leben zu bringen, weil ich
Jsolierung als Mensch und Künstler in Rom
befürchtete . . ." Bemerkenswert ist, daß Schwind
einen starken Eindruck auf Feuerbach machte:
„Jn Schwinds Sachen weht ewige Jugend und
ein Duft, daß ich mich wirklich mit all meinem
Talent tief unter ihm fühle." Darum will er
von ihm als Künstler und als Mensch lernen.
Die Farbe freilich nimmt er aus: „Meine Farbe
bleibt mir immer." Auch die Bildgestaltung rühmt
Feuerbach an Schwind. Bei den andern dagegen,
sagt er, ist das Detail immer besser als die
Gestaltung; er nennet ihre Sachen frappante,
photographische Studien. Sich selbst stellt er in
die zeitgenössische Kunst ein mit den bedeutsamen
Worten: „Mein Studium des Menschen ist eine
heutzutage brotlose Kunst." Wer Schwinds Per-
sönlichkeit auch uur mehr vom Hörensagen kennt,
erkennt den leibhaftigen Schwind sofort wieder,
wenn Feuerbach erzählt: „Schwind nahm mich
gleich unter den Arm und schimpfte furchtbar
über meinen Hafis." Da Feuerbach in München
trotz vielen Suchens kein Atelier fand — heute
klingt es unglaublich — mußte er gen Rom
weiterziehen. Es fiel ihm schwer, recht schwer.
Es war ein seltsames Hm und Her. Gleichsam
im Weggehen schaute der Künstler nochmals zu-
rück: „Nicht länger als eineinhalb bis zwei Jahre,
dann will ich an ein fröhkiches deutsches Schaffen
gehen, weil ich fürchte, in Rom Hypochonder zu
werden." Und doch:
„Der Gedanke an eiu
großes Werk in Rom
steht unverrückt in mei-
ner Seele." Dieses
Schwanken dauerte in
Rom an, vor allem die
ersteZeit. Aberdaneben
steht die Frage: „Wo
anders als hier kann
ich mich frei und groß
entwickeln?" Und da-
neben tauchen Todes-
ahnungen aus: „Auch
ist mir's immer, als
seien meine Jahre ge-
zählt, als müßte mich
der innere Drang und
die Ohnmacht äußerer
Verhältnisse vor der
Zeitausreiben." Feuer-
bach berief sich oft und
in allen Perioden seines
Lebens aufGefühleund
Ahnungen. Und seine
Stimmungen hoben und
senkten sich in raschem
Wechsel gleich den
Wellen im bewegten
See. Man kann darauf
eigenes Wort anwenden: „Das sind
Stimmungen, wir Künstler leben davon." Die
Wahrheit haben sie ihm nicht immer gesagt,
zumeist nicht, wenn sie ihn für sein äußeres Leben
Gutes hoffen ließen. Doch wo sie auf sein Leben
und sein Werk als Ganzes gingen, da ließeu sie
den Künstler ahnen, was kam.
Die nächsten römischeu Jahre brachten ein
volles Maß der Leiden — wieder. „Wenn ich
nur meine Miete und das Essen frei hätte, für
das übrige wollte ich schon sorgen." Das ist
eine leise Klage. Das aber, worauf sie geht,
würde die Begüterten lauter jammern machen,
wenn sie solches Los tragen müßten. Was aber
spricht erst daraus, wenn der Künstler an die
Mutter schreibt: „Jch bitte Dich, nur diesmal
noch, verlaß mich nicht, ich bring es ja hundert-
fach ein in nächster Zeit." Die Stelle zeigt zu-
sein