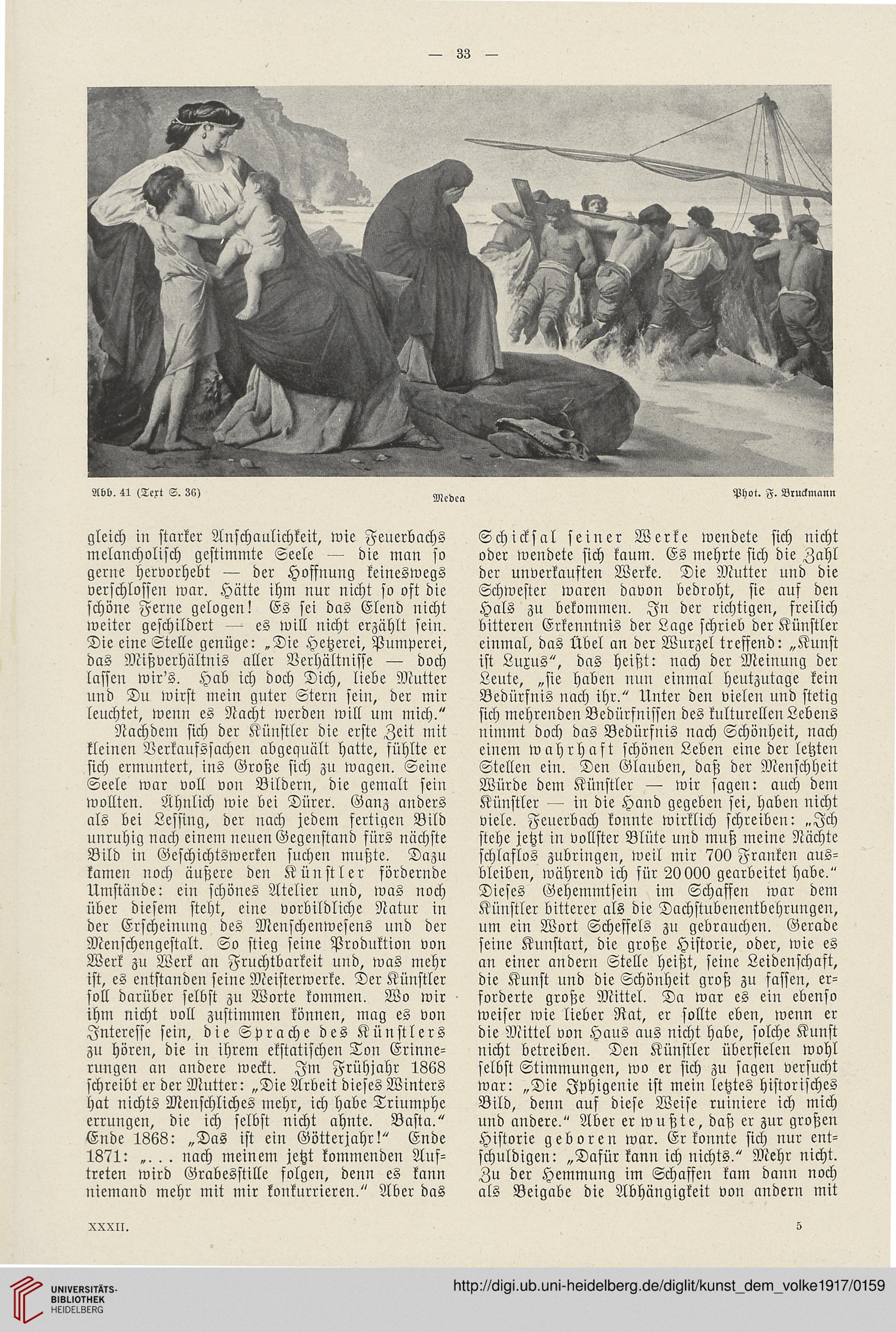Abb. 41 (Text S. 36)
Medca
Phot. F. Bructmann
gleich in starker Anschaulichkeit, wie Feuerbachs
melancholisch gestimmte Seele — die man so
gerne hervorhebt — der Hoffnung keineswegs
verschlossen war. Hätte ihm nur nicht so ost die
schöne Ferne gelogen! Es sei das Elend nicht
weiter geschildert — es will nicht erzählt sein.
Die eine Stelle genüge: „Die Hetzerei, Pumperei,
das Mißverhältnis aller Verhältnisse — doch
lassen wir's. Hab ich doch Dich, liebe Mutter
und Du wirst mein guter Stern sein, der mir
leuchtet, wenn es Nacht werden will um mich."
Nachdem sich der Künstler die erste Zeit mit
kleinen Verkanfssachen abgequält hatte, fühlte er
sich ermuntert, ins Große sich zu wagen. Seine
Seele war voll von Bildern, die gemalt sein
wollten. Ahnlich wie bei Dürer. Ganz anders
als bei Lessing, der nach jedem fertigen Bild
unruhig nach einem neuen Gegenstand fürs nächste
Bild in Geschichtswerken suchen mußte. Dazu
kamen noch äußere den Künstler fördernde
Umstände: ein schönes Atelier und, was noch
über diesem steht, eine vorbildliche Natur in
der Erscheinung des Menschenwesens und der
Menschengestalt. So stieg seine Produktion von
Werk zu Werk an Fruchtbarkeit und, was mehr
ist, es entstanden seine Meisterwerke. Der Künstler
soll darüber selbst zu Worte kommen. Wo wir
ihm nicht voll zustimmen können, mag es von
Jnteresse sein, die Sprache des Künstlers
zu hören, die in ihrem ekstatischen Ton Erinne-
rungen an andere weckt. Jm Frühjahr 1868
schreibt er der Mutter: „Die Arbeit dieses Winters
hat nichts Menschliches mehr, ich habe Triumphe
errungen, die ich selbst nicht ahnte. Basta."
Ende 1868: „Das ist ein Götterjahr!" Ende
1871: „. . . nach meinem jetzt kommenden Auf-
treten wird Grabesstille folgen, denn es kann
niemand mehr mit mir konkurrieren." Aber das
Schicksal seiner Werke wendete sich nicht
oder wendete sich kaum. Es mehrte sich die Zahl
der unverkauften Werke. Die Mutter und die
Schwester waren davon bedroht, sie auf den
Hals zu bekommen. Jn der richtigen, freilich
bitteren Erkenntnis der Lage schrieb der Künstler
einmal, das Übel an der Wurzel treffend: „Kunst
ist Luxus", das heißt: nach der Meinung der
Leute, „sie haben nun einmal heutzutage kein
Bedürfnis nach ihr." Unter den vielen und stetig
sich mehrenden Bedürfnissen des kulturellen Lebens
nimmt doch das Bedürfnis nach Schönheit, nach
einem wahrh aft schönen Leben eine der letzten
Stellen ein. Den Glauben, daß der Menschheit
Würde dem Künstler — wir sagen: auch dem
Künstler — in die Hand gegeben sei, haben nicht
viele. Feuerbach konnte wirklich schreiben: „Jch
stehe jetzt in vollster Blüte und muß meine Nächte
schlaflos zubringen, weil mir 700 Franken aus-
bleiben, während ich für 20000 gearbeitet habe."
Dieses Gehemmtsein im Schaffen war dem
Künstler bitterer als die Dachstubenentbehrungen,
um ein Wort Scheffels zu gebrauchen. Gerade
seine Kunstart, die große Historie, oder, wie es
an einer andern Stelle heißt, seine Leidenschaft,
die Kunst und die Schönheit groß zu fassen, er-
forderte große Mittel. Da war es ein ebenso
weiser wie lieber Rat, er sollte eben, wenn er
die Mittel von Haus aus nicht habe, solche Kunst
nicht betreiben. Den Künstler überfielen wohl
selbst Stimmungen, wo er sich zu sagen versucht
war: „Die Jphigenie ist mein letztes historisches
Bild, denn auf diese Weise ruiniere ich mich
und andere." Aber er wußte, daß er zur großen
Historie geboren war. Er konnte sich nur ent-
schuldigen: „Dafür kann ich nichts." Mehr nicht.
Zu der Hemmung im Schaffen kam dann noch
als Beigabe die Abhängigkeit von andern mit
XXXII.
s
Medca
Phot. F. Bructmann
gleich in starker Anschaulichkeit, wie Feuerbachs
melancholisch gestimmte Seele — die man so
gerne hervorhebt — der Hoffnung keineswegs
verschlossen war. Hätte ihm nur nicht so ost die
schöne Ferne gelogen! Es sei das Elend nicht
weiter geschildert — es will nicht erzählt sein.
Die eine Stelle genüge: „Die Hetzerei, Pumperei,
das Mißverhältnis aller Verhältnisse — doch
lassen wir's. Hab ich doch Dich, liebe Mutter
und Du wirst mein guter Stern sein, der mir
leuchtet, wenn es Nacht werden will um mich."
Nachdem sich der Künstler die erste Zeit mit
kleinen Verkanfssachen abgequält hatte, fühlte er
sich ermuntert, ins Große sich zu wagen. Seine
Seele war voll von Bildern, die gemalt sein
wollten. Ahnlich wie bei Dürer. Ganz anders
als bei Lessing, der nach jedem fertigen Bild
unruhig nach einem neuen Gegenstand fürs nächste
Bild in Geschichtswerken suchen mußte. Dazu
kamen noch äußere den Künstler fördernde
Umstände: ein schönes Atelier und, was noch
über diesem steht, eine vorbildliche Natur in
der Erscheinung des Menschenwesens und der
Menschengestalt. So stieg seine Produktion von
Werk zu Werk an Fruchtbarkeit und, was mehr
ist, es entstanden seine Meisterwerke. Der Künstler
soll darüber selbst zu Worte kommen. Wo wir
ihm nicht voll zustimmen können, mag es von
Jnteresse sein, die Sprache des Künstlers
zu hören, die in ihrem ekstatischen Ton Erinne-
rungen an andere weckt. Jm Frühjahr 1868
schreibt er der Mutter: „Die Arbeit dieses Winters
hat nichts Menschliches mehr, ich habe Triumphe
errungen, die ich selbst nicht ahnte. Basta."
Ende 1868: „Das ist ein Götterjahr!" Ende
1871: „. . . nach meinem jetzt kommenden Auf-
treten wird Grabesstille folgen, denn es kann
niemand mehr mit mir konkurrieren." Aber das
Schicksal seiner Werke wendete sich nicht
oder wendete sich kaum. Es mehrte sich die Zahl
der unverkauften Werke. Die Mutter und die
Schwester waren davon bedroht, sie auf den
Hals zu bekommen. Jn der richtigen, freilich
bitteren Erkenntnis der Lage schrieb der Künstler
einmal, das Übel an der Wurzel treffend: „Kunst
ist Luxus", das heißt: nach der Meinung der
Leute, „sie haben nun einmal heutzutage kein
Bedürfnis nach ihr." Unter den vielen und stetig
sich mehrenden Bedürfnissen des kulturellen Lebens
nimmt doch das Bedürfnis nach Schönheit, nach
einem wahrh aft schönen Leben eine der letzten
Stellen ein. Den Glauben, daß der Menschheit
Würde dem Künstler — wir sagen: auch dem
Künstler — in die Hand gegeben sei, haben nicht
viele. Feuerbach konnte wirklich schreiben: „Jch
stehe jetzt in vollster Blüte und muß meine Nächte
schlaflos zubringen, weil mir 700 Franken aus-
bleiben, während ich für 20000 gearbeitet habe."
Dieses Gehemmtsein im Schaffen war dem
Künstler bitterer als die Dachstubenentbehrungen,
um ein Wort Scheffels zu gebrauchen. Gerade
seine Kunstart, die große Historie, oder, wie es
an einer andern Stelle heißt, seine Leidenschaft,
die Kunst und die Schönheit groß zu fassen, er-
forderte große Mittel. Da war es ein ebenso
weiser wie lieber Rat, er sollte eben, wenn er
die Mittel von Haus aus nicht habe, solche Kunst
nicht betreiben. Den Künstler überfielen wohl
selbst Stimmungen, wo er sich zu sagen versucht
war: „Die Jphigenie ist mein letztes historisches
Bild, denn auf diese Weise ruiniere ich mich
und andere." Aber er wußte, daß er zur großen
Historie geboren war. Er konnte sich nur ent-
schuldigen: „Dafür kann ich nichts." Mehr nicht.
Zu der Hemmung im Schaffen kam dann noch
als Beigabe die Abhängigkeit von andern mit
XXXII.
s